Blog Update und Zusammenfassung älterer Blogbeiträge zum Thema

Raphaels Fresko „Die Schule von Athen“ Sie schufen die Grundlagen der antiken Philosophie Platon (Mitte links) und Aristoteles (rechts daneben)

Wer ausserordentliche Leistungen vollbringen will, braucht geistige, körperliche und geistig-seelische Fitness. Und Fitness beginnt im Kopf. durch Denkhygiene. Denken ist die Arbeit des Intellekts.
Philosophie (altgr. φιλοσοφία philosophía, wörtlich „Liebe zur Weisheit“) ist diejenige Wissenschaft, welche versucht, tiefere Erkenntnisse und ein weiteres Verständnis über die menschliche (subjektive) Existenz und das (objektive) Dasein der Welt zu erlangen. „Philosophie ist Wissen um einen Weltzusammenhang.“ Bei der modernen und umstrittenen Begrifflichkeit „Kulturphilosophie“ handelt es sich um die Deutung der Entstehungsbedingungen von Kultur überhaupt einschließlich des vielfältigen kulturellen Ausdruckes des Menschen. Philosophie ist die Sprache des Lebens in einem großen Kopfe.“ — Oswald Spengler
Die griechische Philosophie der Antike (Hellenische Philosophie) oder kurz Griechische Philosophie steht für die Anfänge der Philosophie überhaupt, welche die alten Griechen entwickelten. Sie gilt als Wiege der gesamten abendländischen Philosophie, für deren ganze fernere Entwicklung sie bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts bestimmend geblieben ist.
 Die griechische Philosophie der Antike begann um das Jahr 600 v. Chr. und entstand ursprünglich aus der Frage nach dem Ursprung und Beginn der Welt. Immer mehr Menschen hinterfragten das göttliche Einwirken auf die Erde und suchten nach natur- und vernunftgemäßen Ursachen, die die Philosophie schließlich zu einer eigenständigen Wissenschaft entstehen ließen. Zu den bekanntesten griechischen Philosophen zählten Sokrates, Platon, Aristoteles und Epikur. Die Philosophie erlebte nach dem Sieg Athens in den Perserkriegen und dem Beginn der Athenischen Demokratie im 5. Jhd. v. Chr. ihre Blütezeit.
Die griechische Philosophie der Antike begann um das Jahr 600 v. Chr. und entstand ursprünglich aus der Frage nach dem Ursprung und Beginn der Welt. Immer mehr Menschen hinterfragten das göttliche Einwirken auf die Erde und suchten nach natur- und vernunftgemäßen Ursachen, die die Philosophie schließlich zu einer eigenständigen Wissenschaft entstehen ließen. Zu den bekanntesten griechischen Philosophen zählten Sokrates, Platon, Aristoteles und Epikur. Die Philosophie erlebte nach dem Sieg Athens in den Perserkriegen und dem Beginn der Athenischen Demokratie im 5. Jhd. v. Chr. ihre Blütezeit.
Sokrates
 Mit Sokrates setzte der Beginn der klassischen griechischen Philosophie ein. Seine Lehre entstand aus seiner Auseinandersetzung mit den Sophisten und deren Menschenbild. Er kritisierte diese dafür, dass sie alles zu wissen glaubten und konterte ihnen mit seinem Ideal des “Nichts-Wissens”. Sokrates wollte die Menschen auf diese Weise zum ständigen Hinterfragen ihres eigenen “Ichs” bringen. Indem er die Athener auf den Straßen ansprach und die Gespräche mit ihnen bis ins Unendliche hinauszögerte, begründete Sokrates das Prinzip des “In-Frage-Stellens” und kritischen Denkens. Dadurch versuchte er bei den Menschen die Tugenden der Gerechtigkeit, Tapferkeit und Besonnenheit hervorzurufen. Sokrates wurde in Athen 399 v. Chr. zum Tode verurteilt, weil ihm Gotteslästerung und “Verführung der Jugend” vorgeworfen wurden. Anlass für sein Todesurteil war der verloren gegangene Peloponnesische Krieg, durch den Athen stark geschwächt wurde und politische Gegner zunehmend verfolgt wurden. Sokrates’ Ideen wurden später von Platon, der zu dessen Schülern zählte, an die Öffentlichkeit gebracht.
Mit Sokrates setzte der Beginn der klassischen griechischen Philosophie ein. Seine Lehre entstand aus seiner Auseinandersetzung mit den Sophisten und deren Menschenbild. Er kritisierte diese dafür, dass sie alles zu wissen glaubten und konterte ihnen mit seinem Ideal des “Nichts-Wissens”. Sokrates wollte die Menschen auf diese Weise zum ständigen Hinterfragen ihres eigenen “Ichs” bringen. Indem er die Athener auf den Straßen ansprach und die Gespräche mit ihnen bis ins Unendliche hinauszögerte, begründete Sokrates das Prinzip des “In-Frage-Stellens” und kritischen Denkens. Dadurch versuchte er bei den Menschen die Tugenden der Gerechtigkeit, Tapferkeit und Besonnenheit hervorzurufen. Sokrates wurde in Athen 399 v. Chr. zum Tode verurteilt, weil ihm Gotteslästerung und “Verführung der Jugend” vorgeworfen wurden. Anlass für sein Todesurteil war der verloren gegangene Peloponnesische Krieg, durch den Athen stark geschwächt wurde und politische Gegner zunehmend verfolgt wurden. Sokrates’ Ideen wurden später von Platon, der zu dessen Schülern zählte, an die Öffentlichkeit gebracht.
Platon
 Platon entstammte einer Adelsfamilie in Athen und galt als Schüler Sokrates’. Er übernahm einige seiner Lehren, schrieb seine philosophischen Dialoge auf und gründete 387 v. Chr. die Akademie. Ähnlich wie Sokrates fragte Platon nach dem wahrhaften “Seienden” und lehrte, dass das Gute Ziel und Herkunft aller Dinge sei. Der Mensch solle zur Idee des Guten gelangen und machte dies durch sein Höhlengleichnis deutlich. Platon unterteilte die menschliche Seele in Weisheit, Tapferkeit und Mäßigung auf und schrieb jedem Seelenteil eine Tugend zu. Wenn alle drei ihre Aufgabe erfüllten, dann entstehe die Tugend der Gerechtigkeit. Damit legte Platon den Grundstein für die vier Kardinaltugenden. In seiner Staatslehre stellte er den Idealstaat vor, der auf Gerechtigkeit, Tugend und Weisheit beruhe. Er unterteilte den Staat in die Stände der Herrschenden, Wächter und Bauern. Gerechtigkeit im Staat würde es dann geben, wenn alle drei Stände in Harmonie zueinander ständen.
Platon entstammte einer Adelsfamilie in Athen und galt als Schüler Sokrates’. Er übernahm einige seiner Lehren, schrieb seine philosophischen Dialoge auf und gründete 387 v. Chr. die Akademie. Ähnlich wie Sokrates fragte Platon nach dem wahrhaften “Seienden” und lehrte, dass das Gute Ziel und Herkunft aller Dinge sei. Der Mensch solle zur Idee des Guten gelangen und machte dies durch sein Höhlengleichnis deutlich. Platon unterteilte die menschliche Seele in Weisheit, Tapferkeit und Mäßigung auf und schrieb jedem Seelenteil eine Tugend zu. Wenn alle drei ihre Aufgabe erfüllten, dann entstehe die Tugend der Gerechtigkeit. Damit legte Platon den Grundstein für die vier Kardinaltugenden. In seiner Staatslehre stellte er den Idealstaat vor, der auf Gerechtigkeit, Tugend und Weisheit beruhe. Er unterteilte den Staat in die Stände der Herrschenden, Wächter und Bauern. Gerechtigkeit im Staat würde es dann geben, wenn alle drei Stände in Harmonie zueinander ständen.
Aristoteles
 Philosoph Aristoteles war zunächst Schüler Platons, distanzierte sich im Laufe der Zeit jedoch zunehmend von dessen Lehre und gründete 334 v. Chr. in Athen die Peripatetische Schule. Er befasste sich mit Naturerscheinungen und der Existenz des Menschen. Aristoteles teilte Stoff und Materie in Kategorien auf und kam es zu dem Entschluss, dass alles erforschbar und beschreibbar sei. Damit wurde er zum Universalgelehrten und legte den Grundstein für die Entwicklung der Naturwissenschaften. Aristoteles bezeichnete die Vernunft als höchstes Gut, durch das der Mensch die Glückseligkeit erlange. Er betonte vor allem den Mittelweg zwischen zwei Extremen: Tapferkeit, Mäßigung und Großzügigkeit. In seiner Staatslehre unterschied er mit dem Königtum, der Aristokratie und der Demokratie drei politische Systeme und deren Ausartungen. Für ihn beruhte die beste staatliche Gemeinschaft auf einen ausgewogenen Mittelstand, der jede Ausartung ins Extreme vermeiden würde.
Philosoph Aristoteles war zunächst Schüler Platons, distanzierte sich im Laufe der Zeit jedoch zunehmend von dessen Lehre und gründete 334 v. Chr. in Athen die Peripatetische Schule. Er befasste sich mit Naturerscheinungen und der Existenz des Menschen. Aristoteles teilte Stoff und Materie in Kategorien auf und kam es zu dem Entschluss, dass alles erforschbar und beschreibbar sei. Damit wurde er zum Universalgelehrten und legte den Grundstein für die Entwicklung der Naturwissenschaften. Aristoteles bezeichnete die Vernunft als höchstes Gut, durch das der Mensch die Glückseligkeit erlange. Er betonte vor allem den Mittelweg zwischen zwei Extremen: Tapferkeit, Mäßigung und Großzügigkeit. In seiner Staatslehre unterschied er mit dem Königtum, der Aristokratie und der Demokratie drei politische Systeme und deren Ausartungen. Für ihn beruhte die beste staatliche Gemeinschaft auf einen ausgewogenen Mittelstand, der jede Ausartung ins Extreme vermeiden würde.
Epikur
 Der antike Philosoph Epikur begründete in seinem Garten in Athen mit dem Epikureismus eine eigene philosophische Strömung. Er bezeichnete die Lust als das höchste Gut und Schmerz als das größte Übel. Gemäß seiner Lehre müsse der Mensch ein vernünftiges und maßvolles Leben in Seelenruhe verbringen. Durch diese Lebensweise würde sich der Mensch von negativen Ängsten und Begierden befreien. Indem der Mensch zurückgezogen im Kreis seiner Bekannten lebe, könne er zur Verwirklichung seiner individuellen Freude gelangen. Epikurs Lehre wurde später vor allem von der Stoa und dessen römischen Anhängern wie Cicero und Seneca entschieden abgelehnt.
Der antike Philosoph Epikur begründete in seinem Garten in Athen mit dem Epikureismus eine eigene philosophische Strömung. Er bezeichnete die Lust als das höchste Gut und Schmerz als das größte Übel. Gemäß seiner Lehre müsse der Mensch ein vernünftiges und maßvolles Leben in Seelenruhe verbringen. Durch diese Lebensweise würde sich der Mensch von negativen Ängsten und Begierden befreien. Indem der Mensch zurückgezogen im Kreis seiner Bekannten lebe, könne er zur Verwirklichung seiner individuellen Freude gelangen. Epikurs Lehre wurde später vor allem von der Stoa und dessen römischen Anhängern wie Cicero und Seneca entschieden abgelehnt.
Stoa
 Die Stoa wurde 300 v. Chr. von Zenon auf der Agora in Athen als neue philosophische Richtung gegründet. Entgegen des Epikureismus sahen die Stoiker die Vernunft als höchstes Gut und Ziel des menschlichen Lebens an. Die philosophische Lehre der Stoa unterschied die Menschen strikt zwischen Weisen und Nicht-Weisen. Nur ein weiser Mensch könne sittlich gut handeln, da er Tugend besitze und damit frei und glücklich sei. Dies sei ihm daher möglich, da er von keinen Leidenschaften beeinträchtigt werde und über eine unbeschränkte Seelenruhe verfüge. Die Stoa entwickelte sich später zur führenden Philosophieschule und ermöglichte eine Verbindung zwischen hellenistischer und römischer Philosophie. Die Kernaussagen der Stoa wurden vor allem von Cicero übernommen. Mit dem Aufstieg Roms zur Weltmacht mündeten die Wurzeln der griechischen schließlich in der römischen Philosophie. Die Ideen der altgriechischen Philosophen wurden von den Vordenkern der Aufklärung in der Frühen Neuzeit wieder aufgegriffen.
Die Stoa wurde 300 v. Chr. von Zenon auf der Agora in Athen als neue philosophische Richtung gegründet. Entgegen des Epikureismus sahen die Stoiker die Vernunft als höchstes Gut und Ziel des menschlichen Lebens an. Die philosophische Lehre der Stoa unterschied die Menschen strikt zwischen Weisen und Nicht-Weisen. Nur ein weiser Mensch könne sittlich gut handeln, da er Tugend besitze und damit frei und glücklich sei. Dies sei ihm daher möglich, da er von keinen Leidenschaften beeinträchtigt werde und über eine unbeschränkte Seelenruhe verfüge. Die Stoa entwickelte sich später zur führenden Philosophieschule und ermöglichte eine Verbindung zwischen hellenistischer und römischer Philosophie. Die Kernaussagen der Stoa wurden vor allem von Cicero übernommen. Mit dem Aufstieg Roms zur Weltmacht mündeten die Wurzeln der griechischen schließlich in der römischen Philosophie. Die Ideen der altgriechischen Philosophen wurden von den Vordenkern der Aufklärung in der Frühen Neuzeit wieder aufgegriffen.
Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung
2. Auflage, Tübingen 1862
3. Auflage, Leipzig 1869 (PDF-Dateien): Erster Theil, Erster Theil Zweite Hälfte, Zweiter Theil, Zweiter Theil Zweite Abtheilung, Dritter Theil Erste Abtheilung, Dritter Theil Zweite Abtheilung (verschiedene Auflagen und Einlesequalitäten)
Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie (PDF-Datei)
Nichts in der Schöpfung ist ein Produkt des Zufalls – alles hat eine Bedeutung, eine Funktion, einen Zweck. Alles kann für uns zum Wegweiser werden, wenn wir uns auf die Suche nach dem Sinn einlassen.
Als europäische Tradition markiert Philosophie ursprünglich einen Wesensunterschied zwischen hiesiger und nicht-europäischer Zivilisation, insofern, als daß außerhalb Europas eigentlich nirgendwo forschendes Denken unabhängig von magischem oder institutionell-religiösem Denken institutionalisiert worden ist (wie die antike aristotelische Akademie dies vorführte).
 Mit der neuzeitlichen Ausgliederung von immer mehr Wissensgebieten zu eigentümlichen Forschungszweigen unter dem Dach eines eigenen Fakultätsnamens, verblaßte die akademische Philosophie im 19. Jahrhundert jedoch ernsthaft; das heißt: Autoren – wie Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche –, die dem philosophisch-akademischen Betrieb mit tiefem Mißtrauen gegenüberstanden, profilierten sich anerkanntermaßen als herausragende Denker ihres Zeitalters, während andererseits die akademische Philosophie begann, ihren bis heute dominierenden Weg in die historische Selbstbetrachtung des eigenen Faches und seiner überlieferten Textbestände zu gehen. Ein Verfahren, das den bedenklichen Umstand hervorbrachte, daß vielfach nun reine Ideenhistoriker als „Philosophen“ an deutschen Universitäten lehren, die eben genau keine Philosophen sind.
Mit der neuzeitlichen Ausgliederung von immer mehr Wissensgebieten zu eigentümlichen Forschungszweigen unter dem Dach eines eigenen Fakultätsnamens, verblaßte die akademische Philosophie im 19. Jahrhundert jedoch ernsthaft; das heißt: Autoren – wie Kierkegaard, Schopenhauer und Nietzsche –, die dem philosophisch-akademischen Betrieb mit tiefem Mißtrauen gegenüberstanden, profilierten sich anerkanntermaßen als herausragende Denker ihres Zeitalters, während andererseits die akademische Philosophie begann, ihren bis heute dominierenden Weg in die historische Selbstbetrachtung des eigenen Faches und seiner überlieferten Textbestände zu gehen. Ein Verfahren, das den bedenklichen Umstand hervorbrachte, daß vielfach nun reine Ideenhistoriker als „Philosophen“ an deutschen Universitäten lehren, die eben genau keine Philosophen sind.
Die Philosophie wird je nach dem besonderen Gegenstand unterschieden:
1.) Die Denkphilosophie (ens rationale), die sich mit den Gesetzen (Logik) und der objektiven Gültigkeit des menschlichen Erkennens (Erkenntnistheorie) befaßt.
2.) Die spekulative Philosphie (ens reale) oder Seinsphilosophie. Diese wird eingeteilt in Metaphysik und Naturphilosophie. Die Metaphysik wird in Ontologie und Theodizee unterschieden. Die Naturphilosophie befaßt sich mit der Lehre über den Menschen: der Anthropologie (der philosophischen, der psychologischen und der kulturellen) und schließlich der Kosmologie.
3.) Der praktischen Philosophie oder der „Tun-Philosophie“, der Ethik oder Moralphilosophie und der Philosophie der Kunst (Ästhetik).
Die Anfänge des philosophischen Denkens des Westens gehen bis zum 6. vorchristlichen Jahrhundert zurück. In Abgrenzung zum mythischen Weltbild entfaltete sich in der antiken Philosophie und Mathematik das systematische und wissenschaftlich orientierte menschliche Denken. Im Lauf der Jahrhunderte differenzierten sich die unterschiedlichen Methoden und Disziplinen der Welt-Erschließung und der Wissenschaften direkt oder mittelbar aus der Philosophie.
Der Ausdruck „philosophisch“ verleitet zu vielerlei Unklarheiten und verkehrten Zuordnungen. Dies liegt teils begründet in der Geschichte der europäischen Philosophie, die in verschiedenen Jahrtausenden verschiedene Funktionen erfüllte; teils rührt dieses Problem aber auch von der Laxheit eines modernen Sprachgebrauchs her, der es zuläßt, daß die Marketing-Strategie eines Unternehmens unwidersprochen dessen „Philosophie“ genannt werden darf.
Unklarheiten und verkehrte Zuordnungen berühren hier aber – wie angedeutet – auch zunächst schon die Sache selbst: Ein sehr früher, wegweisender Denker wie Pythagoras etwa, arbeitete zu seiner Zeit magisch-spirituell, initiatorisch und arkan. Das heißt übersetzt, er verkündete eine religiöse Lehre, deren Verbreitung er unter geheime Kautelen setzte, mit Einweihungs- und Geheimhaltungsriten verbunden. Diese auch Arkan-Disziplin genannte Verfahrensweise hat mit den späteren aufklärerisch-öffentlichen Diskursformen wohl nur noch die gezielte Begriffsschulung gemeinsam, sonst eher nichts.
Was für die frühe europäische Zeit gilt, das gilt spiegelverkehrt auch für die späte Neuzeit. Nun jedoch in der Form, daß nicht länger außerwissenschaftliche und vorwissenschaftliche Denkformen Teil der Philosophie wären, sondern – im Gegenteil – sich klassische Wissenschaftsdisziplinen von der akademischen Philosophie abspalten. Zuletzt (im 20. Jahrhundert) kaprizierte sich die akademische Philosophie auf erkenntnistheoretische Fragen. Dadurch überließ sie das weite Feld der lebenspraktischen Fragen einem Existenzialismus des Gefühls und der Tat, der seinerseits oft gar nicht länger „philosophisch“ sein wollte, sondern sich statt dessen immer mehr explizit geistfeindlichen, diskursfeindlichen, militant-revolutionären und autokratischen Denkformen annäherte.
Daraus folgt, daß die Zukunft der Philosophie wohl mutmaßlich weit außerhalb akademischer Zitatkartelle und universitärer Textschöpfungs-Institute liegen wird. Das Leben selbst als fragwürdig und tatsächlich rätselhaft ganz neu zu entdecken, die eigene Lebenswelt selbst ganz neu zu kolonisieren – nachdem spezialistische Denktraditionen (innerhalb wie außerhalb der Schul-Philosophie) uns allzusehr dressiert, sterilisiert, betäubt, verengt und gebändigt haben – könnte heute „philosophisch“ genannt werden. Vielleicht findet sich aber auch ein frischerer Name.
Idealismus (Philosophie)
Idealismus (abgeleitet von altgr. ἰδέα, „Idee“, „Urbild“, „Beschaffenheit“, „Aussehen“) steht in der Philosophie für die Erkenntnis, daß die wahrnehmbare Wirklichkeit nur ein Abbild ihres (tieferliegenden) eigentlichen Wesens ist, und daß alle in der Vorstellung existierenden Objekte letztlich erst durch das vorstellende Subjekt ihre Realität erhalten.
 Der Idealismus leugnet somit nicht die empirische Realität der Außenwelt, sondern lässt diese unangetastet, „hält aber fest, daß alles Objekt, also das empirisch Reale überhaupt, durch das Subjekt zwiefach bedingt ist: erstlich materiell, oder als Objekt überhaupt, weil ein objektives Dasein nur einem Subjekt gegenüber und als dessen Vorstellung denkbar ist; zweitens formell, indem die Art und Weise der Existenz des Objekts , d. h. des Vorgestelltwerdens (Raum, Zeit, Kausalität), vom Subjekt ausgeht, im Subjekt prädisponiert ist“ (Schopenhauer). Demnach muß die wahre Philosophie jedenfalls idealistisch sein: ja, sie muß es, um nur redlich zu seyn. Denn nichts ist gewisser, als daß Keiner jemals aus sich herauskann, um sich mit den von ihm verschiedenen Dingen unmittelbar zu identifizieren: sondern Alles, wovon er sichere, mithin unmittelbare Kunde hat, liegt innerhalb seines Bewußtseyns.“ – Arthur Schopenhauer
Der Idealismus leugnet somit nicht die empirische Realität der Außenwelt, sondern lässt diese unangetastet, „hält aber fest, daß alles Objekt, also das empirisch Reale überhaupt, durch das Subjekt zwiefach bedingt ist: erstlich materiell, oder als Objekt überhaupt, weil ein objektives Dasein nur einem Subjekt gegenüber und als dessen Vorstellung denkbar ist; zweitens formell, indem die Art und Weise der Existenz des Objekts , d. h. des Vorgestelltwerdens (Raum, Zeit, Kausalität), vom Subjekt ausgeht, im Subjekt prädisponiert ist“ (Schopenhauer). Demnach muß die wahre Philosophie jedenfalls idealistisch sein: ja, sie muß es, um nur redlich zu seyn. Denn nichts ist gewisser, als daß Keiner jemals aus sich herauskann, um sich mit den von ihm verschiedenen Dingen unmittelbar zu identifizieren: sondern Alles, wovon er sichere, mithin unmittelbare Kunde hat, liegt innerhalb seines Bewußtseyns.“ – Arthur Schopenhauer
„(…) und ich behandle den Idealismus als eine Instinkt gewordne Unwahrhaftigkeit, als ein Nicht-sehn-wollen der Realität um jeden Preis: jeder Satz meiner Schriften enthält die Verachtung des Idealismus. Es giebt über der bisherigen Menschheit gar kein schlimmeres Verhängniß als diese intellektuelle Unsauberkeit; man hat den Werth aller Realitäten entwerthet, damit, daß man eine ‚ideale Welt‘ erlog.“ – Friedrich Nietzsche
Der Deutsche Idealismus ist die bedeutendste Strömung der Deutschen Philosophie.
Den Beginn und Ausgangspunkt des Deutschen Idealismus stellte die Philosophie Immanuel Kants dar. In der Auseinandersetzung mit den von ihm aufgeworfenen Problemen entstand vor allem in den Jahren von 1781 (Erscheinen der „Kritik der reinen Vernunft“) bis hinein ins 19. Jahrhundert eine Fülle verschiedener Systementwürfe in intensiver philosophischer Gedankenführung.
Als zentral gelten dabei die philosophischen Ansätze von Fichte, Hegel und Schelling. Der Deutsche Idealismus stand mit der Dichtung und Wissenschaft seiner Zeit in intensiver Wechselwirkung und wirkte stark auf das allgemeine Geistesleben (Klassik und Romantik) ein.
Ergänzend
 Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik I. Der kosmologische Anfang der Philosophie und seine Erklärungen Unsere Lehrbücher pflegen die erste Hauptperiode griechischen Denkens als vorsokratische Naturphilosophie abzugrenzen; sie tun recht daran so die Tatsachen didaktisch zu vereinfachen; folgen sie doch dabei auch der bekannten Tradition der … Weiterlesen
Der Ursprung der Naturphilosophie aus dem Geiste der Mystik I. Der kosmologische Anfang der Philosophie und seine Erklärungen Unsere Lehrbücher pflegen die erste Hauptperiode griechischen Denkens als vorsokratische Naturphilosophie abzugrenzen; sie tun recht daran so die Tatsachen didaktisch zu vereinfachen; folgen sie doch dabei auch der bekannten Tradition der … Weiterlesen
 Johannes Rehmke: „Grundriss der Geschichte der Philosophie zum Selbststudium und für Vorlesungen“, 1896
Johannes Rehmke: „Grundriss der Geschichte der Philosophie zum Selbststudium und für Vorlesungen“, 1896
Dieses Werk wurde von Gelehrten als kulturell wichtig ausgewählt und ist Teil der Wissensbasis der Zivilisation, wie wir sie kennen. Diese Arbeit wurde aus dem Originalartefakt reproduziert und bleibt so originalgetreu wie möglich. Daher werden Sie die ursprünglichen Urheberrechtsverweise, Bibliotheksstempel (da die meisten dieser Werke in unseren wichtigsten Bibliotheken auf der ganzen Welt aufbewahrt wurden) und andere Vermerke im Werk sehen. Dieses Werk ist in den Vereinigten Staaten von Amerika gemeinfrei Amerika und möglicherweise andere Nationen. Innerhalb der Vereinigten Staaten dürfen Sie dieses Werk frei kopieren und verteilen, da keine juristische Person (Einzelperson oder Unternehmen) ein Urheberrecht am Werk hat. Als Reproduktion eines historischen Artefakts kann dieses Werk fehlende oder verschwommene Seiten enthalten Bilder, fehlerhafte Markierungen usw. Gelehrte glauben, und wir stimmen zu, dass dieses Werk wichtig genug ist, um aufbewahrt, reproduziert und der Öffentlichkeit allgemein zugänglich gemacht zu werden. Wir wissen Ihre Unterstützung des Erhaltungsprozesses zu schätzen und danken Ihnen, dass Sie einen wichtigen Teil dazu beitragen, dieses Wissen lebendig und relevant zu halten. (PDF-Datei)
Im folgenden Abschnitt des Beitrages, ein paar philosophische Koryphäen der neuzeitlichen Philosophie, die meine philosophische Weltanschauung geprägt haben.
 Immanuel Kant Immanuel Kant (1724-1804) Kant, Immanuel, geb. 22. April 1724 in Königsberg als Sohn eines Sattlermeisters, dessen Familie (früher wohl Cant) wahrscheinlich aus Schottland stammt. Er wurde streng religiös, im Geiste des Pietismus erzogen. Er besuchte 1732-1740 das Collegium Fridericianum … Weiterlesen
Immanuel Kant Immanuel Kant (1724-1804) Kant, Immanuel, geb. 22. April 1724 in Königsberg als Sohn eines Sattlermeisters, dessen Familie (früher wohl Cant) wahrscheinlich aus Schottland stammt. Er wurde streng religiös, im Geiste des Pietismus erzogen. Er besuchte 1732-1740 das Collegium Fridericianum … Weiterlesen
 Immanuel Kant Zum ewigen Frieden Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism freier Staaten gegründet sein. Völker als Staaten können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustande (d. i. in der Unabhängigkeit von äußeren Gesetzen) schon durch ihr … Weiterlesen
Immanuel Kant Zum ewigen Frieden Zweiter Definitivartikel zum ewigen Frieden Das Völkerrecht soll auf einen Föderalism freier Staaten gegründet sein. Völker als Staaten können wie einzelne Menschen beurteilt werden, die sich in ihrem Naturzustande (d. i. in der Unabhängigkeit von äußeren Gesetzen) schon durch ihr … Weiterlesen
 Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft Vorrede Warum diese Kritik nicht eine Kritik der reinen praktischen, sondern schlechthin der praktischen Vernunft überhaupt betitelt wird, obgleich der Parallelism derselben mit der speculativen das erstere zu erfordern scheint, darüber giebt diese Abhandlung hinreichenden Aufschluß. Sie soll blos darthun, … Weiterlesen
Immanuel Kant: Kritik der praktischen Vernunft Vorrede Warum diese Kritik nicht eine Kritik der reinen praktischen, sondern schlechthin der praktischen Vernunft überhaupt betitelt wird, obgleich der Parallelism derselben mit der speculativen das erstere zu erfordern scheint, darüber giebt diese Abhandlung hinreichenden Aufschluß. Sie soll blos darthun, … Weiterlesen
 Immanuel Kant Was ist Aufklärung? BEANTWORTUNG DER FRAGE: WAS IST AUFKLÄRUNG ? Berlinische Monatsschrift. Dezember-Heft 1784. S. 481-494 AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, … Weiterlesen
Immanuel Kant Was ist Aufklärung? BEANTWORTUNG DER FRAGE: WAS IST AUFKLÄRUNG ? Berlinische Monatsschrift. Dezember-Heft 1784. S. 481-494 AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, … Weiterlesen
 Immanuel Kant Der kategorische Imperativ Der kategorische Imperativ Der kategorische Imperativ ist die oberste und allgemeinste Handlungsanweisung in der Philosophie Immanuel Kants, das höchste Prinzip der Moral. In der Grundform lautet er: „Handle so, dass die Maxime (= subjektive Verhaltensregel) deines Willens jederzeit zugleich als … Weiterlesen
Immanuel Kant Der kategorische Imperativ Der kategorische Imperativ Der kategorische Imperativ ist die oberste und allgemeinste Handlungsanweisung in der Philosophie Immanuel Kants, das höchste Prinzip der Moral. In der Grundform lautet er: „Handle so, dass die Maxime (= subjektive Verhaltensregel) deines Willens jederzeit zugleich als … Weiterlesen
 Immanuel Kant Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft [Vorrede]. Riga 1786. VORREDE Wenn das Wort Natur bloß in formaler Bedeutung genommen wird, da es das erste innere Prinzip alles dessen bedeutet, was zum Dasein eines Dinges gehört, (1) so kann es so vielerlei Naturwissenschaften geben, als es spezifisch … Weiterlesen
Immanuel Kant Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft [Vorrede]. Riga 1786. VORREDE Wenn das Wort Natur bloß in formaler Bedeutung genommen wird, da es das erste innere Prinzip alles dessen bedeutet, was zum Dasein eines Dinges gehört, (1) so kann es so vielerlei Naturwissenschaften geben, als es spezifisch … Weiterlesen
 Immanuel Kant Beantwortung der Frage: Ist es eine Erfahrung, daß wir denken? Eine empirische Vorstellung, deren ich mir bewußt bin, ist Wahrnehmung; das, was ich zu der Vorstellung der Einbildungskraft vermittelst der Auffassung und Zusammenfassung ( comprehensio aesthetica)des Mannigfaltigen der Wahrnehmung denke, ist die empirische Erkenntnis des Objekts, und das Urteil, welches … Weiterlesen
Immanuel Kant Beantwortung der Frage: Ist es eine Erfahrung, daß wir denken? Eine empirische Vorstellung, deren ich mir bewußt bin, ist Wahrnehmung; das, was ich zu der Vorstellung der Einbildungskraft vermittelst der Auffassung und Zusammenfassung ( comprehensio aesthetica)des Mannigfaltigen der Wahrnehmung denke, ist die empirische Erkenntnis des Objekts, und das Urteil, welches … Weiterlesen
 Zum heutigen 297th Geburtstag von Immanuel Kant Heute am 22. April vor 297 Jahren ist in Königsberg am Pregel einer der auch international bedeutendsten Philosophen Deutschlands geboren worden : Immanuel Kant Was kann ich wissen ? (Erkenntnistheorie) Was soll ich tun ? (Ethik) Was darf ich hoffen … Weiterlesen
Zum heutigen 297th Geburtstag von Immanuel Kant Heute am 22. April vor 297 Jahren ist in Königsberg am Pregel einer der auch international bedeutendsten Philosophen Deutschlands geboren worden : Immanuel Kant Was kann ich wissen ? (Erkenntnistheorie) Was soll ich tun ? (Ethik) Was darf ich hoffen … Weiterlesen
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
pdf – 871 k kant-kritikderreinenvernunft1 – Kritik der reinen Vernunft (1781)
pdf – 915 k kant-kritikderreinenvernunft2 – Kritik der reinen Vernunft (1787)
pdf – 407 k Kant-allgemeineNaturgeschichte – Allgemeine Naturgeschichte und Theorie Des Himmels
 Friedrich Nietzsche sämtliche Werke hier im Blog als pdf . Nietzsche, Friedrich Wilhelm, geb. 15. Oktober 1844 in Röcken bei Lützen als Sohn eines protestantischen Pfarrers (gest. 1849 an den Folgen einer Gehirnerschütterung durch einen Sturz). 1850 übersiedelte die Familie nach Naumburg … Weiterlesen
Friedrich Nietzsche sämtliche Werke hier im Blog als pdf . Nietzsche, Friedrich Wilhelm, geb. 15. Oktober 1844 in Röcken bei Lützen als Sohn eines protestantischen Pfarrers (gest. 1849 an den Folgen einer Gehirnerschütterung durch einen Sturz). 1850 übersiedelte die Familie nach Naumburg … Weiterlesen
 Nietzsche: Versuch einer Mythologie – DAS DEUTSCHE WERDEN ALS den ältesten Ahnherrn seiner Philosophie ehrt Nietzsches Dankbedürfnis, durch alle wechselnden Epochen seines Denkens hindurch, den Namen Heraklits. Der große Entdecker und Rechtfertiger des Werdens war für den Dichter des Zarathustra vielleicht das fruchtbarste Ur- und Vorbild seiner selbst; … Weiterlesen
Nietzsche: Versuch einer Mythologie – DAS DEUTSCHE WERDEN ALS den ältesten Ahnherrn seiner Philosophie ehrt Nietzsches Dankbedürfnis, durch alle wechselnden Epochen seines Denkens hindurch, den Namen Heraklits. Der große Entdecker und Rechtfertiger des Werdens war für den Dichter des Zarathustra vielleicht das fruchtbarste Ur- und Vorbild seiner selbst; … Weiterlesen
 Nietzsche: Versuch einer Mythologie – ANEKDOTE »Geschichte ist eine große Anekdote. Eine Anekdote ist ein historisches Element, ein historisches Molekül . . Ein Anekdotenmeister muß alles in Anekdoten zu verwandeln wissen.« NUR das Persönliche ist das ewig Unwiderlegbare. Aus drei Anekdoten ist es möglich, das Bild … Weiterlesen
Nietzsche: Versuch einer Mythologie – ANEKDOTE »Geschichte ist eine große Anekdote. Eine Anekdote ist ein historisches Element, ein historisches Molekül . . Ein Anekdotenmeister muß alles in Anekdoten zu verwandeln wissen.« NUR das Persönliche ist das ewig Unwiderlegbare. Aus drei Anekdoten ist es möglich, das Bild … Weiterlesen
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
Nietzsche: Der Wille zur Macht Band 1 / Band 2 / anderes
Nietzsche: Jenseits von Gut und Bose / Zur Genealogie der Moral / anderes / anderes
Nietzsche: Der Antichrist / anderes
Nietzsche: Also Sprach Zarathustra / anderes
Nietzsche: Der Fall Wagner
Nietzsche: Die Fröhliche Wissenschaft
Nietzsche: Ecce Homo
Nietzsche: Götzen-Dämmerung
Nietzsche: Menschliches Allzumenschliches
Nietzsche: Fragmente 1869-1885
Nietzsche: Gesammelte Werke Band 1 / Band 2 /Band 3 / Band 4 / Band 5 / Band 6 / Band 7
Nietzsche: Werke Band 1 / Band 2 / Band 3 / Band 4 / Band 5 / Band 6 / Band 7 / Band 8 / Band 9
Frau Förster-Nietzsche: Das Leben Friedrich Nietzsche’s Band 1 / Band 2
Frau Förster-Nietzsche: Der Junge Nietzsche / Der Einsame Nietzsche
Lichtenberger: Die Philosophie Friedrich Nietzsches / seines Lebens und seiner Lehre
Heidegger: Nietzsche 1 / Band 2
 Arthur Schopenhauer sämtliche Werke hier im Blog als pdf Schopenhauer, Arthur, ist geb. am 22. Februar 1788 in Danzig als Sohn des Bankiers Heinrich Floris Schopenhauer und der Schriftstellerin Johanna Seil. 1793 übersiedelte die Familie nach Hamburg. Der Knabe, den der Vater … Weiterlesen
Arthur Schopenhauer sämtliche Werke hier im Blog als pdf Schopenhauer, Arthur, ist geb. am 22. Februar 1788 in Danzig als Sohn des Bankiers Heinrich Floris Schopenhauer und der Schriftstellerin Johanna Seil. 1793 übersiedelte die Familie nach Hamburg. Der Knabe, den der Vater … Weiterlesen
 Schopenhauer und die abendländische Mystik Zur Entwicklungsgeschichte Schopenhauers. Es scheint sich tatsächlich zu bestätigen, was Theobald Ziegler vor einigen Jahren bedeutsam ausgesprochen hat, daß nämlich ein religiöser, mystischer Zug langsam zwar, aber unverkennbar durch Literatur und Kunst, durch Gesellschaft und Volk gehe, und daß die … Weiterlesen
Schopenhauer und die abendländische Mystik Zur Entwicklungsgeschichte Schopenhauers. Es scheint sich tatsächlich zu bestätigen, was Theobald Ziegler vor einigen Jahren bedeutsam ausgesprochen hat, daß nämlich ein religiöser, mystischer Zug langsam zwar, aber unverkennbar durch Literatur und Kunst, durch Gesellschaft und Volk gehe, und daß die … Weiterlesen
 Schopenhauers Bekanntschaft mit der übrigen abendländischen Mystik. Den bedeutendsten Einfluß auf Schopenhauers früheste philosophische Entwicklung haben unstreitig Kant und Platon ausgeübt; darüber sind die Philosophie-Historiker so ziemlich einig. Die Schriften Kants und Platons sind auch die ersten gewesen, mit denen sich Schopenhauer eingehend beschäftigt hat. Die Anregung … Weiterlesen
Schopenhauers Bekanntschaft mit der übrigen abendländischen Mystik. Den bedeutendsten Einfluß auf Schopenhauers früheste philosophische Entwicklung haben unstreitig Kant und Platon ausgeübt; darüber sind die Philosophie-Historiker so ziemlich einig. Die Schriften Kants und Platons sind auch die ersten gewesen, mit denen sich Schopenhauer eingehend beschäftigt hat. Die Anregung … Weiterlesen
 Die Erlösungslehre Schopenhauers I N H A L T I. Einleitung II. Das Weltbild Schopenhauers a) Die Willenswerdung der Welt b) Die Intelligenzwerdung des Willens c) Die Losreißung des Intellekts vom Willen d) Die Verneinung des Willens III. Der Pessimismus a) Die erkenntnistheoretische … Weiterlesen
Die Erlösungslehre Schopenhauers I N H A L T I. Einleitung II. Das Weltbild Schopenhauers a) Die Willenswerdung der Welt b) Die Intelligenzwerdung des Willens c) Die Losreißung des Intellekts vom Willen d) Die Verneinung des Willens III. Der Pessimismus a) Die erkenntnistheoretische … Weiterlesen
 Schopenhauers Bekanntschaft mit den deutschen Mystikern. Eine erste eingehende Übersicht über die Beihe der abendländischen Mystiker hat Schopenhauer erhalten in Schleiermachers Kolleg über die Geschichte der Philosophie während der Zeit des Christentums, Berlin im Sommer 1812. Das betreffende Kollegheft befindet sich im 5. Bd. der nachgelassenen … Weiterlesen
Schopenhauers Bekanntschaft mit den deutschen Mystikern. Eine erste eingehende Übersicht über die Beihe der abendländischen Mystiker hat Schopenhauer erhalten in Schleiermachers Kolleg über die Geschichte der Philosophie während der Zeit des Christentums, Berlin im Sommer 1812. Das betreffende Kollegheft befindet sich im 5. Bd. der nachgelassenen … Weiterlesen
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
Schopenhauer: Ueber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde
Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung 1 / Band 2 / Band 3 / Band 4 / Band 5; Ueber den Willen in der Natur
Schopenhauer: Die beiden Grundprobleme der Ethik: Ueber die Freiheit des menschlichen Willens, Ueber das Fundament der Moral
Schopenhauer: Parerga und Paralipomena 1 / Band 2 / Band 3 / Band 4
Schopenhauer: Farbenlehre. Aus dem Nachlaß
Schopenhauer, Arthur – Über das Geistersehn und was damit Zusammenhäng
 Johann Gottlieb Fichte Fichte, Johann Gottlieb, geb. 19. Mai 1762 in Rammenau bei Bischofswerda – 29. Januar 1814 in Berlin) war ein deutscher Erzieher und Philosoph. Er gilt neben Friedrich Schleiermacher, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Georg W. F. Hegel als wichtigster Vertreter … Weiterlesen
Johann Gottlieb Fichte Fichte, Johann Gottlieb, geb. 19. Mai 1762 in Rammenau bei Bischofswerda – 29. Januar 1814 in Berlin) war ein deutscher Erzieher und Philosoph. Er gilt neben Friedrich Schleiermacher, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Georg W. F. Hegel als wichtigster Vertreter … Weiterlesen
 Johann Gottlieb Fichtes 250. Geburtstag Fichte – einer unsrer größten Philosophen – wurde am 19. Mai 1762 in Rammenau in der Oberlausitz als Sohn eines Bandwirkers geboren. Durch die Förderung des Gutsbesitzers Haubold von Miltitz konnte er das Elitegymnasium Schulpforta besuchen und in Jena und … Weiterlesen
Johann Gottlieb Fichtes 250. Geburtstag Fichte – einer unsrer größten Philosophen – wurde am 19. Mai 1762 in Rammenau in der Oberlausitz als Sohn eines Bandwirkers geboren. Durch die Förderung des Gutsbesitzers Haubold von Miltitz konnte er das Elitegymnasium Schulpforta besuchen und in Jena und … Weiterlesen
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
Die Wissenschaftslehre, Fichtes Hauptwerk, wurde von ihm mehrfach überarbeitet
Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794/1795)
Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre (1797/98)
Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten (1794) PDF-Datei
Grundlage des Naturrechts (1796) (PDF-Dateien: Band 1, Band 2)
System der Sittenlehre (1798)
Appellation an das Publikum über die durch Churf. Sächs. Confiscationsrescript ihm beigemessenen atheistischen Aeußerungen. Eine Schrift, die man zu lesen bittet, ehe man sie confsicirt (1799)
Der geschlossne Handelsstaat. Ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre und Probe einer künftig zu liefernden Politik (1800) PDF-Datei
Die Bestimmung des Menschen (1800)
Friedrich Nicolais Leben und sonderbare Meinungen (1801)
Philosophie der Maurerei. Briefe an Konstant. (1802/03)
Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (1806) PDF-Datei
Die Anweisung zum seligen Leben oder auch die Religionslehre (1806)
Reden an die deutsche Nation (1807/1808) PDF-Datei
Das System der Rechtslehre (1812) HTML-Version
Über die einzig mögliche Störung der akademischen Freiheit (1905) PDF-Datei
Versuch einer Kritik aller Offenbarung HTML-Version
Die Staatslehre PDF-Datei
Die Thatsachen des Bewusstseyns, Vorlesungen PDF-Datei
Ein Evangelium der Freiheit PDF-Datei
Grundriss des eigenthümlichen der Wissenschaftslehre PDF-Datei
Literatur
Ludwig Noack: Gottlieb Fichte nach seinem Leben, Lehren und Wirken (1862); PDF-Datei
Hermann Bloch: Fichte und der deutsche Geist von 1914 (PDF-Datei)
Ernst Bergmann: Fichte, der Erzieher zum Deutschtum; eine Darstellung der Fichteschen Erziehungslehre (1915); PDF-Datei
 Johann Christoph Friedrich von Schiller Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen und verbreiten wird, dann verkommt alles Bestehende auf der Erde, denn nur in der Wahrheit sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!..Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Johann Christoph … Weiterlesen
Johann Christoph Friedrich von Schiller Wenn kein Mensch mehr die Wahrheit suchen und verbreiten wird, dann verkommt alles Bestehende auf der Erde, denn nur in der Wahrheit sind Gerechtigkeit, Frieden und Leben!..Die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Johann Christoph … Weiterlesen
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
Die Räuber (darin das Hektorlied) (1781) (PDF-Datei)
Kabale und Liebe (1783) (PDF-Datei)
Die Verschwörung des Fiesco zu Genua (1784) (PDF-Datei)
Don Karlos (1787/88, heute meist Don Carlos) (PDF-Datei)
Wallenstein-Trilogie (1799) (PDF-Datei)
Maria Stuart (1800) (PDF-Datei)
Die Jungfrau von Orleans (1801) (PDF-Datei)
Turandot (nach Carlo Gozzi) (1801) (PDF-Datei)
Die Braut von Messina (1803) (PDF-Datei)
Wilhelm Tell (1803/04) (PDF-Datei)
Demetrius (unvollendet, 1805), (PDF-Datei)
Die Sendung Moses, Jenaer Antrittsvorlesung, herunterladen als PDF-Datei
Die Horen (1795) (PDF-Datei Jahrgang 1797)
Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795) (PDF-Datei)
Kleinere prosaische Schriften (1801) (PDF-Dateien: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4)
Geschichte des dreißigjährigen Krieges (1790), herunterladen als PDF-Datei
Caroline von Wolzogen: Schillers Leben, verfasst aus Erinnerungen der Familie seinen eigenen Briefen und den Nachrichten seines Freundes Körner, 1830 (PDF-Dateien: Band 1, Band 2)
Gustav Könnecke: Schiller, eine Biographie in Bildern; Festschrift zur Erinnerungen an die 100. Wiederkehr seines Todestages am 9. Mai 1905 (PDF-Datei))
Karl Haller: : Schiller muß also auferstehen, Bausteine zu einer reinen deutschen Kunst- und Weltanschauung, 1922 (PDF-Datei)
W. v. d. Cammer: Schiller und das Christentum, 1934 (PDF-Datei)
Schillers sämmtliche Werke in einem Bande, 1840 (PDF-Datei)
 Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe, (28. August 1749 in Frankfurt am Main; 22. März 1832 in Weimar) war eines der größten Dichtergenies aller Zeiten. Am Hof von Weimar bekleidete der „Kronzeuge der nationalen Identität der Deutschen“ als Freund und Minister des … Weiterlesen
Johann Wolfgang von Goethe Johann Wolfgang von Goethe, (28. August 1749 in Frankfurt am Main; 22. März 1832 in Weimar) war eines der größten Dichtergenies aller Zeiten. Am Hof von Weimar bekleidete der „Kronzeuge der nationalen Identität der Deutschen“ als Freund und Minister des … Weiterlesen
 Zum 270ten Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe Im Header Bereich meiner Webseite könnt ich vernehmen – Was mein Herz bewegt, bewegt vielleicht auch andere. Und nun, schauen wir auf folgende Goethe Zitate und ihr wisst, welch ein Bestreben mit meiner Webseite Germanenherz ich verfolge. Es muss von … Weiterlesen
Zum 270ten Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe Im Header Bereich meiner Webseite könnt ich vernehmen – Was mein Herz bewegt, bewegt vielleicht auch andere. Und nun, schauen wir auf folgende Goethe Zitate und ihr wisst, welch ein Bestreben mit meiner Webseite Germanenherz ich verfolge. Es muss von … Weiterlesen
Das Göttliche
Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen.
Heil den unbekannten
Höhern Wesen,
Die wir ahnen!
Ihnen gleiche der Mensch!
Sein Beispiel lehr’ uns
Jene glauben.
Denn unfühlend
Ist die Natur:
Es leuchtet die Sonne
Über Bös’ und Gute,
Und dem Verbrecher
Glänzen, wie dem Besten
Der Mond und die Sterne.
Wind und Ströme,
Donner und Hagel
Rauschen ihren Weg
Und ergreifen
Vorüber eilend
Einen um den andern.
Auch so das Glück
Tappt unter die Menge,
Faßt bald des Knaben
Lockige Unschuld,
Bald auch den kahlen
Schuldigen Scheitel.
Nach ewigen, ehrnen,
Großen Gesetzen
Müssen wir alle
Unseres Daseins
Kreise vollenden.
Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche:
Er unterscheidet,
Wählet und richtet;
Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen.
Er allein darf
Den Guten lohnen,
Den Bösen strafen,
Heilen und retten,
Alles Irrende, Schweifende
Nützlich verbinden.
Und wir verehren
Die Unsterblichen,
Als wären sie Menschen,
Täten im Großen,
Was der Beste im Kleinen
Tut oder möchte.
Der edle Mensch
Sei hilfreich und gut!
Unermüdet schaff’ er
Das Nützliche, Rechte,
Sei uns ein Vorbild
Jener geahneten Wesen!
Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe in 40 Bänden, hrsg. von Eduard von der Hellen (1902):
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (* 27. Januar 1775 in Leonberg; † 20. August 1854 in Bad Ragaz) war ein deutscher Philosoph. Zu seinem Wirken heißt es: Der „Naturphilosoph“, Begründer des Identitätssystems; Professor zu Jena, Würzburg, Erlangen, München, seit 1841 … Weiterlesen
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (* 27. Januar 1775 in Leonberg; † 20. August 1854 in Bad Ragaz) war ein deutscher Philosoph. Zu seinem Wirken heißt es: Der „Naturphilosoph“, Begründer des Identitätssystems; Professor zu Jena, Würzburg, Erlangen, München, seit 1841 … Weiterlesen
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie (PDF-Datei)
Ideen zu einer Philosophie der Natur. 2e, verbesserte und vermehrte Auflage (PDF-Datei)
Von der Weltseele (PDF-Datei)
Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der Dinge (PDF-Datei)
Ueber die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt (PDF-Datei)
Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten fichte’schen Lehre (PDF-Datei)
Philosophie und Religion (PDF-Datei)
Ueber die Gottheiten von Samothrace (PDF-Datei)
Vom Ich als Princip der Philosophie oder über das Unbedingte im menschlichen Wissen (PDF-Datei, Netzbuch)
Vorlesungen über die Methode des academischen Studium (PDF-Datei)
Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämmtliche Werke (In Auswahl auf Archive.org)
Gustav Leopold Plitt: „Aus Schellings Leben“ (1870) (PDF-Datei)
Otto Pfleiderer: „Friedrich Wilhelm Joseph Schelling – Gedächtnissrede zur Feier seines Secular-Jubiläums am 27. Januar 1875“ (PDF-Datei)
Heinrich Eberhard Gottlob Paulus: „Die endlich offenbar gewordene positive Philosophie der Offenbarung; oder, Entstehungsgeschichte, wörtlicher Text, Beurtheilung und Berichtigung der v. Schellingischen Entdeckungen über Philosophie überhaupt, Mythologie und Offenbarung des dogmatischen Christenthums im Berliner Wintercursus von 1841-42“ (PDF-Datei)
Otto Braun: „Hinauf zum Idealismus. Schelling-Studien“ (1908) (PDF-Datei)
Theodor Hoppe: „Die Philosophie Schelling’s und ihr Verhältniss zum Christenthum“ (1875) (PDF-Datei)
Ludwig Noack: „Schelling und die Philosophie der Romantik – ein Beitrag zur Culturgeschichte des deutschen Geistes“ (1859) (PDF-Dateien: Band 1, Band 2)
„Schelling und die Offenbarung; Kritik des neuesten Reaktionsversuchs gegen die freie Philosophie“ (1842) (PDF-Datei)
Hubert Karl Philipp Beckers: „Historisch-kritische Erläuterungen zu Schelling’s Abhandlungen über die Quelle der ewigen Wahrheiten und Kant’s Ideal der reinen Vernunft“ (1858) (PDF-Datei)
Julius Frauenstädt: „Schelling’s Vorlesungen in Berlin; Darstellung und Kritik derselben mit besonderer Beziehung auf das Verhältnis zwischen Christenthum und Philosophie“ (1842) (PDF-Datei)
Constantin Frantz: „Schelling’s positive Philosophie, nach ihrem Inhalt, wie nach ihrer Bedeutung für den allgemeinen Umschwung der bis jetzt noch herrschenden Denkweise für gebildete Leser dargestellt“ (1879) (PDF-Datei)
Manfred Schröter: „Der Ausgangspunkt der Metaphysik Schellings. Entwickelt aus seiner ersten philosophischen Abhandlung ‚Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie Überhaupt‘“ (1908) (PDF-Datei)
Franz Munk: „Einheit und Duplizität im Aufbau von Schellings System des transzendentalen Idealismus“ (1910) (PDF-Datei)
Paul Tillich: „Mystik und Schuldbewusstsein in Schellings philosophischer Entwicklung“ (1912) (PDF-Datei)
Friedrich Köppen: „Schellings Lehre oder das Ganze der Philosophie des absoluten Nichts“ (1803) (PDF-Datei)
Heinrich Lisco: „Die Geschichtsphilosophie Schellings 1792-1809“ (1884) (PDF-Datei)
Christian Kapp: „Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Ein Beitrag zur Geschichte des Tages von einem vieljährigen Beobachter“, 1843 (PDF-Datei)
Hubert Beckers: „Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – Denkrede am 28. März 1855“ (PDF-Datei)
Alexander Jung: „Fr. Wilhelm Joseph von Schelling und eine Unterredung mit demselben im Jahre 1838 zu München“, 1864 (PDF-Datei)
Dreihundert Bildnisse und Lebensabrisse berühmter deutscher Männer“ von Ludwig Bechstein, Karl Theodor Gaedertz, Hugo Bürkner, Leipzig am Sedantage 1890, 5. Auflage (PDF-Datei)
Johannes Rehmke: „Grundriss der Geschichte der Philosophie zum Selbststudium und für Vorlesungen“, 1896, S. 276ff. (PDF-Datei)
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. August 1770 in Stuttgart, Württemberg; † 14. November 1831 in Berlin, Preußen) war ein deutscher Philosoph, der als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus gilt. Hegel wuchs in einem pietistischen Elternhaus auf. Vom Vater ermuntert, … Weiterlesen
Georg Wilhelm Friedrich Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. August 1770 in Stuttgart, Württemberg; † 14. November 1831 in Berlin, Preußen) war ein deutscher Philosoph, der als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus gilt. Hegel wuchs in einem pietistischen Elternhaus auf. Vom Vater ermuntert, … Weiterlesen
 Hegelsche Dialektik: Problem-Reaktion-Lösung gleich, These – Antithese – Synthese. Hegel entwickelte unter Beibehaltung aufklärerischer und kritischer Positionen, wie Rousseau und Kant und Einbeziehung der historischen Betrachtungsweise ein philosophisches System, in dem er das Absolute als absolute Idee, als Natur und Geist in den Mittelpunkt stellt; als Verbindung von Begriff und Realität, subjektivem und objektivem Geist, mit dem Ergebnis des absoluten Geistes inform von Religion, Kunst oder Philosophie. Es geht um das Zurückfinden zu sich selbst und das immer stärker werdenden Selbstbewußtsein des menschlichen Geistes, sein „An-und-für-sich-sein“.
Hegelsche Dialektik: Problem-Reaktion-Lösung gleich, These – Antithese – Synthese. Hegel entwickelte unter Beibehaltung aufklärerischer und kritischer Positionen, wie Rousseau und Kant und Einbeziehung der historischen Betrachtungsweise ein philosophisches System, in dem er das Absolute als absolute Idee, als Natur und Geist in den Mittelpunkt stellt; als Verbindung von Begriff und Realität, subjektivem und objektivem Geist, mit dem Ergebnis des absoluten Geistes inform von Religion, Kunst oder Philosophie. Es geht um das Zurückfinden zu sich selbst und das immer stärker werdenden Selbstbewußtsein des menschlichen Geistes, sein „An-und-für-sich-sein“.
-
- Die Gegenüberstellung zweier Aussagen zu einem Sachverhalt, schafft eine These und eine Antithese, eine Negation der Position, die in der These behauptet wird. In der fortlaufenden Argumentation gewinnt diese Antithese als Negation eine positive Funktion. Sie treibt den Erkenntnisprozeß auf eine neue Ebene, diese neue Ebene bzw. die neue Formulierung auf dieser Ebene ergibt die Synthese. Sie dient wieder neu als Negation der Antithese und fordert gleichzeitig eine neue Gegenargumentation, ist also gleichzeitig neue These.
- Das zweite Moment zeigt sich in der Bewegung in die das Denken bzw. dieser Erkenntnisprozeß eingebettet ist. Sie steht im Unterschied zu linearen oder deduktiven Verfahren, die auf vorgegebenen Postulaten basieren. Die Bewegung der Hegelschen Dialektik bezieht gezielt Positionen außerhalb des Argumentationsablaufes, um dann neue Positionen zu schaffen, die aus der linearen Sicht eine Negation darstellen und damit die Dialektik nicht nur in ihrem Prozeß dynamisiert wird, sondern auch das Gegenstandsfeld und die subjektive Erkenntnis dieses Prozesses. These, Antithese und Synthese als sog. „Bewegungsstufen“. Vergleichbar ist dieses System mit dem hermeneutischen Zirkel, „Der Gegensatz und Widerspruch entläßt sich in den neuen und höheren Begriff, die Zwischensituation bestimmt die neue und höhere Einheit“.
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
Hegels philosophische Abhandlungen (1832) PDF
(1834) PDF
(1840) PDF
(1836) PDF
(1845) PDF
(1833) PDF
(1833)PDF
(1833)PDF
(1834)PDF
(1832)PDF
(1832)PDF with text
(1833)PDF with text
(1834)PDF
(1832)PDF
(1844)PDF
Friedrich Dannenberg: Der Geist der Hegelschen Geschichts-Philosophie (1923); PDF-Datei
Karl Rosenkranz: Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s Leben. Supplement zu Hegel’s Werken. Mit Hegel’s Bildniss, gestochen von K. Barth (1844); PDF-Datei
Robert Falckenberg: Die Realität des objektiven Geistes bei Hegel (1916); PDF-Datei
Carl Ludwig Michelet: Hegel: Der unwiderlegte Weltphilosoph: Eine Jubelschrift (1870); PDF-Datei
Heinrich Reese: Hegel über das Auftreten der christlichen Religion in der Weltgeschichte (1909); PDF-Datei
Karl Ludwig Michelet: Einleitung in Hegel’s philosophische Abhandlungen (1832); PDF-Datei
Frantz, Hillert: Hegel’s Philosophie in wörtlichen Auszügen: Für Gebildete aus dessen Werken (1843); PDF-Datei
M. Ehrenhauss: Hegel’s Gottesbegriff: in seinen Grundlinien und nächsten Folgen aus den Quellen dargelegt (1880); PDF-Datei
Frank Wallace Dunlop: Hauptmomente in Hegels Begriff der Persönlichkeit (1903); PDF-Datei
Johannes Rehmke: Grundriss der Geschichte der Philosophie zum Selbststudium und für Vorlesungen. 1896, S. 276ff. (PDF-Datei)
 Rudolf Steiner Rudolf Steiner wurde am 27. Februar 1861 als Sohn eines österreichischen Bahnbeamten in Kraliewitz geboren. Er entstammte einer bäuerlichen Familie aus dem niederösterreichischen Waldviertel und wuchs im Umkreis von Wien auf. Rudolf Steiner studierte in Wien Naturwissenschaften und Mathematik an … Weiterlesen
Rudolf Steiner Rudolf Steiner wurde am 27. Februar 1861 als Sohn eines österreichischen Bahnbeamten in Kraliewitz geboren. Er entstammte einer bäuerlichen Familie aus dem niederösterreichischen Waldviertel und wuchs im Umkreis von Wien auf. Rudolf Steiner studierte in Wien Naturwissenschaften und Mathematik an … Weiterlesen
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
 Steiner, Rudolf – Wahrheit und Wissenschaft Dieses Werk im deutschen Original Wahrheit und Wissenschaft erschien erstmals 1892 in Form der Dissertation Rudolf Steiners an der Universität Rostock. Seitdem sind deutsche und englische Ausgaben erschienen. Wahrheit und Wissen oder Wahrheit und Wissenschaft ist eine geeignete Einführung in Dr. Steiners philosophische Abhandlung mit dem Titel Philosophie der spirituellen Aktivität . Es wurde ursprünglich in deutscher Sprache als Wahrheit und Wissenschaft Vorspiel einer „Philosophie der Freiheit“ veröffentlicht. Diese Arbeit, im Wesentlichen Steiners Doktorarbeit, trägt den Untertitel „Einführung in die Philosophie der Freiheit“. ist genau das: ein wesentliches Grundlagenwerk der Anthroposophie, in dem die erkenntnistheoretischen Grundlagen geistiger Erkenntnis klar und logisch dargelegt werden.
Steiner, Rudolf – Wahrheit und Wissenschaft Dieses Werk im deutschen Original Wahrheit und Wissenschaft erschien erstmals 1892 in Form der Dissertation Rudolf Steiners an der Universität Rostock. Seitdem sind deutsche und englische Ausgaben erschienen. Wahrheit und Wissen oder Wahrheit und Wissenschaft ist eine geeignete Einführung in Dr. Steiners philosophische Abhandlung mit dem Titel Philosophie der spirituellen Aktivität . Es wurde ursprünglich in deutscher Sprache als Wahrheit und Wissenschaft Vorspiel einer „Philosophie der Freiheit“ veröffentlicht. Diese Arbeit, im Wesentlichen Steiners Doktorarbeit, trägt den Untertitel „Einführung in die Philosophie der Freiheit“. ist genau das: ein wesentliches Grundlagenwerk der Anthroposophie, in dem die erkenntnistheoretischen Grundlagen geistiger Erkenntnis klar und logisch dargelegt werden.
 Steiner, Rudolf – Wie erlangt man Erkenntnisse der hoeheren Welten Rudolf Steiners grundlegendes Werk auf dem Weg zu höheren Erkenntnissen erläutert ausführlich die Übungen und Disziplinen, denen ein Schüler nachgehen muss, um zu einer wachen Erfahrung übersinnlicher Realitäten zu gelangen. Der hier beschriebene Weg ist ein sicherer Weg, der die Fähigkeit des Schülers, ein normales äußeres Leben zu führen, nicht beeinträchtigt.
Steiner, Rudolf – Wie erlangt man Erkenntnisse der hoeheren Welten Rudolf Steiners grundlegendes Werk auf dem Weg zu höheren Erkenntnissen erläutert ausführlich die Übungen und Disziplinen, denen ein Schüler nachgehen muss, um zu einer wachen Erfahrung übersinnlicher Realitäten zu gelangen. Der hier beschriebene Weg ist ein sicherer Weg, der die Fähigkeit des Schülers, ein normales äußeres Leben zu führen, nicht beeinträchtigt.
Steiner, Rudolf – Die Geheimwissenschaft im Umriß  Dieses Werk von fast 400 Seiten beginnt mit einer gründlichen Diskussion und Definition des Begriffs „okkulte“ Wissenschaft. Es folgt eine Beschreibung der übersinnlichen Natur des Menschen, zusammen mit einer Erörterung von Träumen, Schlaf, Tod, Leben zwischen Tod und Wiedergeburt und Reinkarnation. Im vierten Kapitel wird die Evolution aus der Perspektive der Initiationswissenschaft beschrieben. Das fünfte Kapitel charakterisiert die Ausbildung, die ein Student durchlaufen muss, um ein Eingeweihter zu werden. Das sechste und siebte Kapitel betrachten die zukünftige Entwicklung der Welt und detailliertere Beobachtungen in Bezug auf übersinnliche Realitäten.
Dieses Werk von fast 400 Seiten beginnt mit einer gründlichen Diskussion und Definition des Begriffs „okkulte“ Wissenschaft. Es folgt eine Beschreibung der übersinnlichen Natur des Menschen, zusammen mit einer Erörterung von Träumen, Schlaf, Tod, Leben zwischen Tod und Wiedergeburt und Reinkarnation. Im vierten Kapitel wird die Evolution aus der Perspektive der Initiationswissenschaft beschrieben. Das fünfte Kapitel charakterisiert die Ausbildung, die ein Student durchlaufen muss, um ein Eingeweihter zu werden. Das sechste und siebte Kapitel betrachten die zukünftige Entwicklung der Welt und detailliertere Beobachtungen in Bezug auf übersinnliche Realitäten.
 Steiner, Rudolf – Die Philosophie der Freiheit Steiners bedeutendstes philosophisches Werk befasst sich sowohl mit Erkenntnistheorie, der Erforschung dessen, wie der Mensch sich selbst und die Welt kennt, als auch mit der Frage der menschlichen Freiheit. In der ersten Hälfte des Buches konzentriert sich Steiner auf die Aktivität des Denkens, um die wahre Natur des Wissens zu demonstrieren. Dort zeigt er den Irrtum des zeitgenössischen Denkens auf, indem er darauf hinweist, dass der vorherrschende Glaube an die Grenzen des Wissens eine selbst auferlegte Grenze ist, die dem eigenen Wahrheitsanspruch widerspricht. Die Möglichkeit der Freiheit wird in der zweiten Hälfte des Buches aufgegriffen. Das Problem ist nicht politische Freiheit, sondern etwas Subtileres; Freiheit des Willens. Es gibt diejenigen, die behaupten, dass die Gedanken und Handlungen des Menschen genauso determiniert sind wie eine chemische Reaktion oder das Verhalten einer Honigbiene. Steiner weist erneut auf die Tätigkeit des Denkens hin,
Steiner, Rudolf – Die Philosophie der Freiheit Steiners bedeutendstes philosophisches Werk befasst sich sowohl mit Erkenntnistheorie, der Erforschung dessen, wie der Mensch sich selbst und die Welt kennt, als auch mit der Frage der menschlichen Freiheit. In der ersten Hälfte des Buches konzentriert sich Steiner auf die Aktivität des Denkens, um die wahre Natur des Wissens zu demonstrieren. Dort zeigt er den Irrtum des zeitgenössischen Denkens auf, indem er darauf hinweist, dass der vorherrschende Glaube an die Grenzen des Wissens eine selbst auferlegte Grenze ist, die dem eigenen Wahrheitsanspruch widerspricht. Die Möglichkeit der Freiheit wird in der zweiten Hälfte des Buches aufgegriffen. Das Problem ist nicht politische Freiheit, sondern etwas Subtileres; Freiheit des Willens. Es gibt diejenigen, die behaupten, dass die Gedanken und Handlungen des Menschen genauso determiniert sind wie eine chemische Reaktion oder das Verhalten einer Honigbiene. Steiner weist erneut auf die Tätigkeit des Denkens hin,
Steiner, Rudolf – Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen  Dieses Buch ist eine „Erweiterung“ des Buches mit dem Titel „ Wissen von den höheren Welten und ihre Erlangung“. Es besteht aus acht „Meditationen“. Die acht behandelten Themen sind: Der physische Leib, der Ätherleib, die hellseherische Erkenntnis der Elementarwelt, der Hüter der Schwelle, der Astralleib, der Ich- oder Gedankenleib, der Erlebnischarakter in den übersinnlichen Welten und der Weg in dem der Mensch seine wiederholten Erdenleben erblickt. Acht „Meditationen“: Der physische Leib, der Ätherleib, die hellseherische Erkenntnis der Elementarwelt, der Hüter der Schwelle, der Astralleib, der Ich- oder Gedankenleib, der Erlebnischarakter in den übersinnlichen Welten und der Weg hinein Welcher Mann sieht seine wiederholten Erdenleben?
Dieses Buch ist eine „Erweiterung“ des Buches mit dem Titel „ Wissen von den höheren Welten und ihre Erlangung“. Es besteht aus acht „Meditationen“. Die acht behandelten Themen sind: Der physische Leib, der Ätherleib, die hellseherische Erkenntnis der Elementarwelt, der Hüter der Schwelle, der Astralleib, der Ich- oder Gedankenleib, der Erlebnischarakter in den übersinnlichen Welten und der Weg in dem der Mensch seine wiederholten Erdenleben erblickt. Acht „Meditationen“: Der physische Leib, der Ätherleib, die hellseherische Erkenntnis der Elementarwelt, der Hüter der Schwelle, der Astralleib, der Ich- oder Gedankenleib, der Erlebnischarakter in den übersinnlichen Welten und der Weg hinein Welcher Mann sieht seine wiederholten Erdenleben?
Steiner, Rudolf – Lexikon Anthroposophie  Anthroposophie. Vor seinem Tod unternahm Rudolf Steiner einen letzten Ansatz, das Wesen der Anthroposophie nochmals von Grund auf als Anthroposophische Leitsätze in Worte zu fassen. Die kurzen, durch seinen Tod fragmentarisch gebliebenen 185 Abschnitte bilden in ihrer knappen, präzisen Sprache Inhalte für ein meditatives Erarbeiten der Anthroposophie. Durch die konzentrierte Darstellung, ohne die später erläuternd und vertiefend hinzukommenden Ausführungen in den Briefen an die Mitglieder, tritt der Keimcharakter dieser Sätze für ein Spiritualisieren des Denkens in seiner ganzen bewegenden Kraft hervor.
Anthroposophie. Vor seinem Tod unternahm Rudolf Steiner einen letzten Ansatz, das Wesen der Anthroposophie nochmals von Grund auf als Anthroposophische Leitsätze in Worte zu fassen. Die kurzen, durch seinen Tod fragmentarisch gebliebenen 185 Abschnitte bilden in ihrer knappen, präzisen Sprache Inhalte für ein meditatives Erarbeiten der Anthroposophie. Durch die konzentrierte Darstellung, ohne die später erläuternd und vertiefend hinzukommenden Ausführungen in den Briefen an die Mitglieder, tritt der Keimcharakter dieser Sätze für ein Spiritualisieren des Denkens in seiner ganzen bewegenden Kraft hervor.
 Steiner, Rudolf – Theosophie Das Buch beginnt mit einer schönen Beschreibung der ursprünglichen Trichotomie; Körper, Seele und Geist. Es folgt eine Diskussion über Reinkarnation und Karma. Das dritte und längste Kapitel der Arbeit (74 Seiten) präsentiert. In einem weiten Panorama die sieben Regionen der Seelenwelt, die sieben Regionen des Geisterlandes und die Reise der Seele nach dem Tod durch diese Welten. Eine kurze Erörterung des Weges zu höherem Wissen findet sich im fünften Kapitel.
Steiner, Rudolf – Theosophie Das Buch beginnt mit einer schönen Beschreibung der ursprünglichen Trichotomie; Körper, Seele und Geist. Es folgt eine Diskussion über Reinkarnation und Karma. Das dritte und längste Kapitel der Arbeit (74 Seiten) präsentiert. In einem weiten Panorama die sieben Regionen der Seelenwelt, die sieben Regionen des Geisterlandes und die Reise der Seele nach dem Tod durch diese Welten. Eine kurze Erörterung des Weges zu höherem Wissen findet sich im fünften Kapitel.
Beiträge hier im Blog
 Rudolf Steiner Vom Seelenleben Durch die Erforschung von Träumen, Fantasie, Erinnerung und Wahrnehmung entwickelt Steiner hier einen bemerkenswerten, erfahrungsorientierten Weg zu höherem Wissen. Es ist eine sehr konzentrierte Arbeit, die immer wieder studiert werden kann. Die hier vorgestellten vier Aufsätze sind im Oktober und … Weiterlesen
Rudolf Steiner Vom Seelenleben Durch die Erforschung von Träumen, Fantasie, Erinnerung und Wahrnehmung entwickelt Steiner hier einen bemerkenswerten, erfahrungsorientierten Weg zu höherem Wissen. Es ist eine sehr konzentrierte Arbeit, die immer wieder studiert werden kann. Die hier vorgestellten vier Aufsätze sind im Oktober und … Weiterlesen
 Rudolf Steiner sagte 1917 voraus: „Impfstoffe werden die Seelen der Menschen zerstören“ Der österreichische Philosoph Rudolf Steiner sagte voraus, dass Impfstoffe von der globalen Elite verwendet würden, um die Seelen der Menschen zu zerstören, um sie in einen Zustand der Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung und Angst zu versetzen . Steiner war ein österreichischer … Weiterlesen
Rudolf Steiner sagte 1917 voraus: „Impfstoffe werden die Seelen der Menschen zerstören“ Der österreichische Philosoph Rudolf Steiner sagte voraus, dass Impfstoffe von der globalen Elite verwendet würden, um die Seelen der Menschen zu zerstören, um sie in einen Zustand der Angst, Hilflosigkeit, Verzweiflung und Angst zu versetzen . Steiner war ein österreichischer … Weiterlesen
 Rudolf Steiner Goethe als Begründer einer neuen ästhetischen Wissenschaft Vorwort Dieser Vortrag, der nun in zweiter Auflage erscheint, habe ich vor mehr als zwanzig Jahren bei der Goethe-Gesellschaft in Wien gehalten. Anlässlich dieser Neuauflage eines meiner früheren Werke sei vielleicht folgendes gesagt. Es ist vorgekommen, dass im Laufe meiner … Weiterlesen
Rudolf Steiner Goethe als Begründer einer neuen ästhetischen Wissenschaft Vorwort Dieser Vortrag, der nun in zweiter Auflage erscheint, habe ich vor mehr als zwanzig Jahren bei der Goethe-Gesellschaft in Wien gehalten. Anlässlich dieser Neuauflage eines meiner früheren Werke sei vielleicht folgendes gesagt. Es ist vorgekommen, dass im Laufe meiner … Weiterlesen
 Rudolf Steiner Individualismus in der Philosophie Steiner zeigt in diesem Aufsatz, dass aktive Selbsterkenntnis den Menschen für das Wesen der Welt öffnet, mit dem er dann innerlich so vereint ist, dass er mit gleicher Wahrheit sagen kann: „Ich bin“ und „Ich bin die Welt“. Dieser Aufsatz … Weiterlesen
Rudolf Steiner Individualismus in der Philosophie Steiner zeigt in diesem Aufsatz, dass aktive Selbsterkenntnis den Menschen für das Wesen der Welt öffnet, mit dem er dann innerlich so vereint ist, dass er mit gleicher Wahrheit sagen kann: „Ich bin“ und „Ich bin die Welt“. Dieser Aufsatz … Weiterlesen
 Rudolf Steiner Das Luziferische und Ahrimanische im Verhältnis zum Menschen Aus der Zeitschrift Das Reich , Band 3, Nummer 3, 1927 Wenn wir versuchen, auf dem Weg der übersinnlichen Erkenntnis zu einer Erkenntnis des eigentlichen Menschenwesens vorzudringen, so tritt die Gegensätzlichkeit von Denken und Wollen immer deutlicher hervor. Dieser Gegensatz … Weiterlesen
Rudolf Steiner Das Luziferische und Ahrimanische im Verhältnis zum Menschen Aus der Zeitschrift Das Reich , Band 3, Nummer 3, 1927 Wenn wir versuchen, auf dem Weg der übersinnlichen Erkenntnis zu einer Erkenntnis des eigentlichen Menschenwesens vorzudringen, so tritt die Gegensätzlichkeit von Denken und Wollen immer deutlicher hervor. Dieser Gegensatz … Weiterlesen
 Rudolf Steiner Das menschliche Leben im Lichte der Geisteswissenschaft Vorwort Die folgenden Bemerkungen bildeten den Inhalt eines Vortrages, den ich am 16. Oktober 1916 in Liestal hielt. Es war gewissermaßen eine Fortsetzung eines anderen Vortrags, gehalten ebenfalls am 11. Januar in Liestal, mit dem Titel „Die Aufgabe der Geisteswissenschaft … Weiterlesen
Rudolf Steiner Das menschliche Leben im Lichte der Geisteswissenschaft Vorwort Die folgenden Bemerkungen bildeten den Inhalt eines Vortrages, den ich am 16. Oktober 1916 in Liestal hielt. Es war gewissermaßen eine Fortsetzung eines anderen Vortrags, gehalten ebenfalls am 11. Januar in Liestal, mit dem Titel „Die Aufgabe der Geisteswissenschaft … Weiterlesen
 Albert Schweitzer Ludwig Philipp Albert Schweitzer ( 14. Januar 1875 in Kaysersberg bei Colmar; 4. September 1965 in Lambarene in Gabun) war ein deutscher Arzt, Philosoph und Humanitarist. Leben Nach dem Abitur 1893 in Mülhausen studierte er an der Universität Straßburg Theologie … Weiterlesen
Albert Schweitzer Ludwig Philipp Albert Schweitzer ( 14. Januar 1875 in Kaysersberg bei Colmar; 4. September 1965 in Lambarene in Gabun) war ein deutscher Arzt, Philosoph und Humanitarist. Leben Nach dem Abitur 1893 in Mülhausen studierte er an der Universität Straßburg Theologie … Weiterlesen
 Albert Schweitzer über die Weltanschauungskritik Albert Schweitzer über die Kulturweltanschauung In dem nachfolgenden Auszug aus Dr. Albert Schweitzers (1875-1965) Werk „Kulturphilosophie – Verfall und Wiederaufbau der Kultur“ wird sehr deutlich beschrieben, wie eine künftige Weltanschauung aussehen muß, damit sie heilsspendend auf alle Völker ausstrahlen kann. … Weiterlesen
Albert Schweitzer über die Weltanschauungskritik Albert Schweitzer über die Kulturweltanschauung In dem nachfolgenden Auszug aus Dr. Albert Schweitzers (1875-1965) Werk „Kulturphilosophie – Verfall und Wiederaufbau der Kultur“ wird sehr deutlich beschrieben, wie eine künftige Weltanschauung aussehen muß, damit sie heilsspendend auf alle Völker ausstrahlen kann. … Weiterlesen
Werke (Auswahl)
- Geschichte der Paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart (PDF-Datei)
- Das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums (PDF-Datei)
- Die Religionsphilosophie Kants von der Kritik der reinen Vernunft bis zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (PDF-Datei)
- Von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (PDF-Datei) Für Nicht-VSA-Bewohner nur mit US-Proxy abrufbar!
- Kritische Darstellung unterschiedlicher neuerer historischer Abendmahlsauffassungen (PDF-Datei) Für Nicht-VSA-Bewohner nur mit US-Proxy abrufbar!
- J.S. Bach (PDF-Datei)
- Selbstdarstellung (1929) (PDF-Datei)
- http://www.friedenspreis-des-deutschen-buchhandels.de/sixcms/media.php/1290/1951_schweitzer.pdf
 Mathilde Friederike Karoline Ludendorff Mathilde Friederike Karoline Ludendorff 4. Oktober 1877 in Wiesbaden- 24. Juni 1966 in Tutzing; gebürtig Mathilde Spieß, verh. u. verw. v. Kemnitz, verh. u. gesch. Kleine) war eine deutsche Lehrerin und Ärztin. Sie wurde vor allem bekannt als zweite Ehefrau … Weiterlesen
Mathilde Friederike Karoline Ludendorff Mathilde Friederike Karoline Ludendorff 4. Oktober 1877 in Wiesbaden- 24. Juni 1966 in Tutzing; gebürtig Mathilde Spieß, verh. u. verw. v. Kemnitz, verh. u. gesch. Kleine) war eine deutsche Lehrerin und Ärztin. Sie wurde vor allem bekannt als zweite Ehefrau … Weiterlesen
Werke
- Das Weib und seine Bestimmung. Ein Beitrag zur Psychologie der Frau und zur Neuorientierung ihrer Pflichten. (Erstauflage 1917; 191 Seiten)
- Erotische Wiedergeburt (Erstauflage 1919; 212 Seiten). Dieses Buch erschien 1959 in überarbeiteter Fassung unter dem Titel Der Minne Genesung.
- Triumph des Unsterblichkeitwillens (PDF-Datei) (Erstauflage 1921; 46. – 57. Tausend 1959, 425 Seiten)
- Der Seele Ursprung und Wesen
- 1. Teil Schöpfungsgeschichte (Erstauflage 1923; 19. – 20. Tausend 1954, 160 Seiten)
- 2. Teil Des Menschen Seele (Erstauflage 1925; 22. – 24. Tausend 1941, 292 Seiten)
- 3. Teil Selbstschöpfung (Erstauflage 1927; 19. – 20. Tausend 1954, 285 Seiten)
- Der Seele Wirken und Gestalten
- 1. Teil Des Kindes Seele und der Eltern Amt – Eine Philosophie der Erziehung (Erstauflage 1930; 19. – 20. Tausend 1953, 475 Seiten)
- 2. Teil Die Volksseele und ihre Machtgestalter – Eine Philosophie der Geschichte (Erstauflage 1933; 13. – 15. Tausend 1955, 516 Seiten)
- 3. Teil Das Gottlied der Völker – Eine Philosophie der Kulturen (Erstauflage 1935; 7. – 8. Tausend 1955, 462 Seiten)
- Der Siegeszug der Physik — Ein Triumph der Gotterkenntnis meiner Werke (Erstauflage 1941; 295 Seiten)
- Wunder der Biologie im Lichte der Gotterkenntnis meiner Werke
- Band 1 (Erstauflage 1950; 362 Seiten)
- Band 2 (Erstauflage 1954; 260 Seiten)
- Das Hohe Lied der göttlichen Wahlkraft (Erstauflage 1957; 264 Seiten)
- In den Gefilden der Gottoffenbarung (Erstauflage 1959; 370 Seiten)
- Das Jenseitsgut der Menschenseele
- 1. Teil Der Mensch, das große Wagnis der Schöpfung (Erstauflage 1960; 281 Seiten)
- 2. Teil Unnahbarkeit des Vollendeten (Erstauflage 1961; 300 Seiten)
- 3. Teil Von der Herrlichkeit des Schöpfungszieles (Erstauflage 1962; 380 Seiten)
- mit Erich Ludendorff:
- Die machtvolle Religiosität des deutschen Volkes vor 1945. Dokumente zur Religions- und Geistesgeschichte 1933 – 1945 Kompil. Erich Meinecke. Verlag Freiland, Viöl 2004 (einschlägiger Verlag)
- Am heiligen Quell Deutscher Kraft (1934 – Folge 11 (PDF-Datei)
- Das Geheimnis der Jesuitenmacht und ihr Ende (1929, 194 S., Scan-Text, Fraktur) (PDF-Datei)
- Das große Entsetzen – Die Bibel nicht Gottes Wort (1937, 36 S., Scan-Text, Fraktur) (PDF-Datei)
- Europa den Asiatenpriestern (1938, 47 S., Scan-Text, Fraktur) (PDF-Datei)
- Weihnachten im Licht der Rassenerkenntnis (1937, 35 S., Scan-Text, Fraktur.pdf) (PDF-Datei)
- Christentum und deutsche Gotterkenntnis (PDF-Datei)
- Die Judenmacht ihr Wesen und Ende (1939) (PDF-Datei)
- Der ungesühnte Frevel an Luther, Lessing und Schiller im Dienste des allmächtigen Baumeisters (1936) (PDF-Datei)
- Induziertes Irresein durch Okkultlehren (Bestellmöglichkeit)
- Bände der Blauen Reihe (unvollständig):
- Band 1: Deutscher Gottglaube (1934) (PDF-Datei)
- Band 3: Sippenfeiern-Sippenleben (1939) (PDF-Datei)
- Band 4: Für Feierstunden (1937) (PDF-Datei)
- Band 5: Wahn und seine Wirkung (1938) (PDF-Datei)
- Band 6: Von Wahrheit und Irrtum (1938) (PDF-Datei)
- Band 7: Und Du, liebe Jugend? (1938) (PDF-Datei)
- Band 8: Auf Wegen zur Erkenntnis (1940) (PDF-Datei)
- Band 9: Für dein Nachsinnen (PDF-Datei)
- LernstoffzumLehrplanderdeutschenLebenskunde (unvollständig):
- Heft 1 (1. und 2. Schuljahr) (PDF-Datei)
- Erlösung von Jesu Christo (1931) (PDF-Datei)
- Bekenntnis der protestantischen Kirche zum römischen Katholizismus (1937) (PDF-Datei)
- Mozarts Leben und gewaltsamer Tod (1936) (PDF-Datei)
- Was Romherschaft bedeutet (PDF-Datei)
- Der Trug der Astrologie (1932-2006, Nachdruck) (PDF-Datei)
- Unsere Kinder in Gefahr (1937) (PDF-Datei)
- Ist das Leben sinnlose Schinderei? (1934) (PDF-Datei)
- Warum Lebenskundeunterricht? (1941) (PDF-Datei)
- Erledigte Gotterkenntnis? – Hoffnungslose Wissenschaft! (1939) u.a. Autoren (PDF-Datei)
- Verschüttete Volksseele Nach Berichten aus Südafrika (PDF-Datei)
- Ein Blick in die Morallehre der römischen Kirche (1934) (PDF-Datei)
- Künstlerisches Schaffen und Wahnlehren (1941) (PDF-Datei)
- Von neuem Trug zur Rettung des Christentums (1931) (PDF-Datei)
- Ein Blick in die Dunkelkammer der Geisterseher (PDF-Datei))
- Wahn über die Ursachen des Schicksals (1934) (PDF-Datei)
- Hinter den Kulissen des Bismarckreiches (1931-1999, Nachdruck) (PDF-Datei)
- Der Segen der Gotterkenntnis (PDF-Datei)
- Christliche Grausamkeit an deutschen Frauen (1936) mit Walther Löhde (PDF-Datei)
- Erich Ludendorff Sein Wesen und Schaffen (1938) (Netzbuch)
- Lessings Geisteskampf und Lebensschicksal (1937-2004) (PDF-Datei)
- Totenklage – ein Heldengesang: Erich Ludendorff (1939) (PDF-Datei)
- Hans Kurth: Die Weltdeutung Dr. Mathilde Ludendorffs – Eine Einführung in die Werke der Philosophin (1932 , 67 S., Scan-Text, Fraktur) (PDF-Datei)
- Der Wahrheitsbeweis Spruchkammerverfahren gegen Mathilde Ludendorff (PDF-Datei)
- Dietger Weber: Das Spruchkammerverfahren gegen Mathilde Ludendorff
- H. Dittmer: Was weißt du von Mathilde Ludendorff? (1934, 71 S., Scan-Text, Fraktur) (PDF-Datei)
- Tutzinger Schriften 2: Mathilde Ludendorff – Über das Werden ihrer Gotterkenntnis. Zusammengestellt von Edmund Reinhard. (1971) (Netzbuch
- Verweise Weltnetzseite des Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff) e.V.
 Johann Gottfried Herder Johann Gottfried Herder, seit 1802 von Herder 25. August 1744 in Mohrungen, Ostpreußen Tod 18. Dezember 1803 in Weimar), war ein deutscher Kulturphilosoph, Dichter, Theologe und Übersetzer. Er gilt als Anreger des „Sturm und Drang“ sowie Wegbereiter der Deutschen Klassik … Weiterlesen
Johann Gottfried Herder Johann Gottfried Herder, seit 1802 von Herder 25. August 1744 in Mohrungen, Ostpreußen Tod 18. Dezember 1803 in Weimar), war ein deutscher Kulturphilosoph, Dichter, Theologe und Übersetzer. Er gilt als Anreger des „Sturm und Drang“ sowie Wegbereiter der Deutschen Klassik … Weiterlesen
Friedrich Georg Hamann Johann Georg Hamann 27. August 1730 in Königsberg; Tod 21. Juni 1788 in Münster war ein deutscher Philosoph und Schriftsteller. Sein Hang zum Irrationalen und die mystisch-prophetische Sprache führten zu dem Beinamen „Magnus des Nordens“. Wirken Zu seinem Wirken heißt … Weiterlesen
 Theodor Fritsch Emil Theodor Fritsch 28. Oktober 1852 in Wiesenena (Landkreis Delitzsch)- 8. September 1933 in Gautzsch, heute: Markkleeberg) war ein deutscher Publizist und Verleger, der, beseelt von echtem Ethos – um aufzuklären und zu veredeln, nicht um zu hetzen, wie seine … Weiterlesen
Theodor Fritsch Emil Theodor Fritsch 28. Oktober 1852 in Wiesenena (Landkreis Delitzsch)- 8. September 1933 in Gautzsch, heute: Markkleeberg) war ein deutscher Publizist und Verleger, der, beseelt von echtem Ethos – um aufzuklären und zu veredeln, nicht um zu hetzen, wie seine … Weiterlesen
Werke
- Leuchtkugeln, Alldeutsch-antisemitische Kernsprüche. Josef Müller Verlag, Sebastian Bach Straße 13, Leipzig 1882
- Mißstände in Handel und Gewerbe. Herrmann Beyer Verlag
- Über die noch von Otto von Bismarck 1887 geschmiedete Reichstagsmehrheit genannt Das Kartell:
- Wem kommt das Kartell zu gute? Herrmann Beyer Verlag 1890
- Der Sieg der Sozialdemokratie als Frucht des Kartells. Herrmann Beyer Verlag 1890
- Verteidigungsschrift gegen die Anklage wegen groben Unfugs, verübt durch Verbreitung antisemitischer Flugblätter. Herrmann Beyer Verlag 1891
- Zur Abwehr und Aufklärung. Herrmann Beyer Verlag 1891
- Unter dem Pseudonym Thomas Frey:
- Thatsachen zur Judenfrage, das ABC der Antisemiten (mehrere Auflagen u. a. 1891), Herrmann Beyer Verlag
- Zur Bekämpfung 2000jähriger Irrtümer. Herrmann Beyer Verlag 1886
- Das Abc der sozialen Frage. Leipzig: Fritsch 1892 (Kleine Aufklärungs-Schriften Nr. 1)
- Die Juden in Rußland, Polen, Ungarn usw. Leipzig: Fritsch 1892 (Kleine Aufklärungs-Schriften Nr. 7)
- Statistik des Judenthums. Leipzig: Fritsch 1892 (Kleine Aufklärungs-Schriften Nr. 10 und Nr. 11) (PDF-Datei)
- Halb-Antisemiten. Ein Wort zur Klärung. Leipzig: Beyer 1893
- Zwei Grundübel: Boden-Wucher und Börse. Eine gemeinverständliche Darstellung des brennendsten Zeitfragen. Leipzig: Beyer 1894
- Die Stadt der Zukunft. Leipzig: Fritsch 1896 (PDF-Datei)
- Mein Beweis-Material gegen Jahwe. Leipzig: Hammer 1911
- Der falsche Gott – Beweismaterial gegen Jahwe, 1921 (PDF-Datei)
- Unter dem Pseudonym F. Roderich-Stoltheim:
- Die Juden im Handel und das Geheimnis ihres Erfolges. Zugleich eine Antwort und Ergänzung zu Sombarts Buch: „Die Juden und das Wirtschaftsleben“. Steglitz:Hobbing 1913
- Anti-Rathenau. Leipzig: Hammer 1918 (Hammer-Schriften Nr. 15)
- Einstein’s Truglehre. Allgemein-verständlich dargestellt und widerlegt. Leipzig: Hammer 1921 (Hammer-Schriften Nr. 29)
- Die wahre Natur des Judentums. Leipzig: Hammer 1926
- Die zionistischen Protokolle 11. Auflage 1932 (PDF-Datei, 57MB)
- Handbuch der Judenfrage Ausgabe von
- Urteile berühmter Männer über das Judentum (PDF-Datei)
- Hammer-Schriften (unvollständig):
 Ernst Moritz Arndt Ernst Moritz Arndt 26. Dezember 1769 in Groß Schoritz, Insel Rügen – 29. Januar 1860 in Bonn war ein deutscher Patriot, Burschenschafter, Dichter, Sprachschützer und Revolutionär und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Arndt wandte sich hauptsächlich gegen die französische Besatzung Deutschlands … Weiterlesen
Ernst Moritz Arndt Ernst Moritz Arndt 26. Dezember 1769 in Groß Schoritz, Insel Rügen – 29. Januar 1860 in Bonn war ein deutscher Patriot, Burschenschafter, Dichter, Sprachschützer und Revolutionär und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung. Arndt wandte sich hauptsächlich gegen die französische Besatzung Deutschlands … Weiterlesen
Werke
- Versuch einer Geschichte der Leibeigenschaft in Pommern und Rügen, 1803
- Reisen durch einen Theil Teutschlands, Ungarns, Italiens und Frankreichs in den Jahren 1798 und 1799, 1804, (als PDF-Datei)
- Fragmente über Menschenbildung I, 1804
- Fragmente über Menschenbildung II, 1805
- Ernst Moritz Arndt’s Reise durch Schweden im Jahre 1804, Berlin 1806, (als PDF-Datei)
- Fragmente über Menschenbildung III, 1809
- Briefe an Freunde, Altona 1810, (als PDF-Datei)
- Einleitung zu historischen Karakterschilderungen (1810), (als PDF-Datei)
- Kurzer Katechismus für teutsche Soldaten nebst einem Anhang von Liedern, 1812
- Der Rhein, Teutschlands Strom, nicht aber Teutschlands Grenze, 1813 (PDF-Datei)
- Über Volkshass und über den Gebrauch einer fremden Sprache (1813), (als PDF-Datei)
- Die Glocke der Stunde in drei Zügen, 1813
- Ansichten und Aussichten der Teutschen Geschichte, Leipzig 1814
- Der Wächter, (1817), (als PDF-Datei)
- Gedichte, 1818, (als PDF-Datei)
- Mährchen und Jugenderinnerungen. Erster Theil, 1818
- Erinnerungen aus Schweden. Eine Weihnachtsgabe, Berlin 1818
- Vom Wort und vom Kirchenliede, nebst geistlichen Liedern, 1819, (als PDF Datei)
- Über Sitte, Mode und Kleidertracht: Ein Wort aus der Zeit (1824), (als PDF-Datei)
- Schwedische Geschichten unter Gustav dem dritten: Vorzüglich aber unter Gustav dem vierten Adolf, Leipzig 1839, (als PDF-Datei)
- Erinnerungen aus dem äußeren Leben, 1840, (als PDF-Datei)
- Gedichte, Ausgabe 1840, (als PDF Datei)
- Versuch in vergleichenden Völkergeschichten, 1842
- Mährchen und Jugenderinnerungen. Erster Theil. Zweite Ausgabe, 1842, (als PDF-Datei)
- Mährchen und Jugenderinnerungen. Zweiter Theil, 1843
- Versuch in vergleichender Voelkergeschichte, Leipzig 1844
- Notgedrungener Bericht aus meinem Leben, Leipzig 1847, (als PDF-Datei)
- Blätter der Erinnerungen meistens um und aus der Paulskirche in Frankfurt, (als PDF-Datei)
- Germania: Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der deutschen Nation (1852), (als PDF-Datei)
- Pro Populo germanico, Berlin 1854
- Geistliche Lieder, 1855
- Meine Wanderungen und Wandlungen mit dem Reichsfreiherrn Heinrich Carl Friedrich vom Stein, Berlin 1858, (als PDF-Datei)
- Gedichte, Berlin 1860, (als PDF-Datei)
- Gedichte: Vollständige Sammlung, mit der Handschrift des Dichters aus seinem neunzigsten Jahr (1860) (PDF-Datei)
- Ein Wort über die Feier der Leipziger Schlacht, 1814 (PDF-Datei)
Weiteres
- Kater Martinchen: 21 Vorpommersche Sagen
- Märchen und Sagen
- Gedichte (auf Zeno.org)
- Kommt her, ihr seid geladen (Evangelisches Gesangbuch, 213)
- Ich weiß, woran ich glaube (Evangelisches Gesangbuch, 357)
- Die Leipziger Schlacht (Deutsches Lesebuch für Volksschulen)
Literatur über Arndt
- Ernst Moritz Arndts ausgewählte Werke. In 16 Bänden, Hrsg. und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen vonHeinrichMeisner undRobertGeerds, 1908
- Walther Schacht: „Die Sprache der bedeutenderen Flugschriften E. M. Arndts, Dissertation, herausgegeben Bromberg 1911, (als PDF-Datei)
- Georg Lange: „Der Dichter Arndt“ (1910) (PDF-Datei)
- Richard Wolfram: Ernst Moritz Arndt und Schweden. Zur Geschichte der deutschen Nordsehnsucht, Duncker Weimar (1933)
Biographien
- Eduard Langenberg: „Ernst Moritz Arndt: Sein Leben und seine Schriften, Eine Biographie“, Veröffentlicht von Weber, 1865 (als PDF-Datei)
- Paul Meinhold: „Arndt, eine Biographie, aus der Reihe Geisteshelden“, Verlag Ernst Hofmann 1910 (als PDF-Datei)
- Ernst Müsebeck: „Ernst Moritz Arndt. Ein Lebensbild“, Gotha 1914 (als PDF-Datei)
- Heinrich Meisner, Robert Geerds: „Ernst Moritz Arndt: Ein Lebensbild in Briefen“, 1898 (als PDF-Datei)
- Paul Requadt: Ernst Moritz Arndt – Volk und Staat, seine Schriften in Auswahl, 1934 (Mit zip gepackte PDF-Datei)
 August Heinrich Hoffmann von Fallersleben August Heinrich Hoffmann, bekannt als Hoffmann von Fallersleben 2. April 1798 in Fallersleben (heute Stadtteil von Wolfsburg) – 19. Januar 1874 in Corvey) war ein deutscher Burschenschafter, Dichter, Lyriker, Hochschullehrer für Germanistik und Patriot. 1841 schrieb er die spätere deutsche … Weiterlesen
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben August Heinrich Hoffmann, bekannt als Hoffmann von Fallersleben 2. April 1798 in Fallersleben (heute Stadtteil von Wolfsburg) – 19. Januar 1874 in Corvey) war ein deutscher Burschenschafter, Dichter, Lyriker, Hochschullehrer für Germanistik und Patriot. 1841 schrieb er die spätere deutsche … Weiterlesen
 Ein Zitat von dem deutschen Burschenschafter, Dichter, Lyriker, Hochschullehrer für Germanistik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben er schrieb unteranderen die “Die deutsche Nationalhymne “, das „Lied der Deutschen
Ein Zitat von dem deutschen Burschenschafter, Dichter, Lyriker, Hochschullehrer für Germanistik August Heinrich Hoffmann von Fallersleben er schrieb unteranderen die “Die deutsche Nationalhymne “, das „Lied der Deutschen
Nicht Mord, nicht Bann, noch Kerker
nicht Standrecht obendrein
es muß noch stärker kommen
soll es von Wirkung sein.
Ihr müßt zu Bettlern werden
müßt hungern allesamt
Zu Mühen und Beschwerden
verflucht sein und Verdammt
Euch muß das bißchen Leben
so gründlich sein verhaßt
daß Ihr es fort wollt geben
wie eine Qual und Last
Erst dann vielleicht erwacht noch
in Euch ein besserer Geist
Der Geist, der über Nacht noch,
Euch hin zur Freiheit heißt
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
1815 Deutsche Lieder aus der Schweiz (PDF-Datei)
1822 Die Schöneberger Nachtigall (Netzbuch und einzelne Seiten als PDF-Dateien speicherbar)
1826 Allemannische Lieder (PDF-Datei)
1836 Buch der Liebe (PDF-Datei)
Unpolitische Lieder (1840) (PDF-Datei)
1843 Deutsche Gassenlieder (PDF-Datei)
1843 Vier und vierzig Kinderlieder (PDF-Datei)
1844 Maitrank (PDF-Datei)
1844 Hoffmann’sche Tropfen (PDF-Datei)
1848 Diavolini (PDF-Datei)
1848 37 Lieder für das junge Deutschland (PDF-Datei)
1853 Die Kinderwelt in Liedern (PDF-Datei)
Geschichte des deutschen Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit (1854) (PDF-Datei)
Findlinge 1860 (PDF-Datei)
1863 Lieder für Schleswig-Holstein (PDF-Datei)
1868 Lieder der Landsknechte (PDF-Datei)
1887 Gedichte (PDF-Datei)
 Novalis Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg Er wurde nur 28 Jahre alt, hat aber eine ganze Epoche geprägt: Novalis. Nur wenige kennen ihn unter seinem Adelsnamen Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg 2. Mai 1772 auf Schloß Oberwiederstedt in Mansfeld; Tod 25. März 1801 in Weißenfels) … Weiterlesen
Novalis Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg Er wurde nur 28 Jahre alt, hat aber eine ganze Epoche geprägt: Novalis. Nur wenige kennen ihn unter seinem Adelsnamen Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg 2. Mai 1772 auf Schloß Oberwiederstedt in Mansfeld; Tod 25. März 1801 in Weißenfels) … Weiterlesen
Werke
- Gedichte (PDF-Datei)
- Hymnen an die Nacht. Die Christenheit oder Europa. (PDF-Datei)
- Heinrich von Ofterdingen (PDF-Datei)
- Die Lehrlinge zu Saïs. Heinrich von Ofterdingen (Netzbuch) Für Nicht-USA-Bewohner nur mit US-Proxy abrufbar!
- Märchen (PDF-Datei) Für Nicht-USA-Bewohner nur mit US-Proxy abrufbar!
- Fragmente (PDF-Datei) Für Nicht-USA-Bewohner nur mit US-Proxy abrufbar!
- Schriften (PDF-Dateien: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4)
Literatur
- Wilhelm von Scholz: Novalis, in: Willy Andreas / Wilhelm von Scholz (Hg.): Die Großen Deutschen. Neue Deutsche Biographie. Propyläen Verlag, Berlin, 4 Bde. 1935–1937, 1 Ergänzungsbd. 1943; Fünfter Band, S. 118–127
- Just Bing: „Novalis (Friedrich v.Hardenberg), eine biographische Charakteristik“, 1893 (PDF-Datei)
- „Friedrich von Hardenberg genannt Novalis. Eine Nachlese aus den Quellen des Familienarchivs, herausgegeben von einem Mitglied der Familie“, 1883 (PDF-Datei)
- Carl Busse: „Novalis‘ Lyrik“ (1898) (PDF-Datei)
- Egon Friedell: „Novalis als Philosoph“ (1904) (PDF-Datei)
- Ernst Heilborn: „Novalis, der Romantiker“ (1901) (PDF-Datei)
- A. Schubart: „Novalis‘ Leben, Dichten und Denken“, 1887 (PDF-Datei)
- Johannes Schlaf: „Novalis und Sophie von Kühn, eine psychophysiologische Studie“ (1906) (PDF-Datei)
- Heinrich Simon: „Der magische Idealismus; Studien zur Philosophie des Novalis“ (1906) (PDF-Datei)
- Gustav Baur: „Novalis als religiöser Dichter. Vortrag, gehalten am 10. Januar 1877“ (PDF-Datei)
- Waldemar Olshausen: „Friedrich v. Hardenberg’s (Novalis) Beziehungen zur Naturwissenschaft seiner Zeit“, 1905 (PDF-Datei)
- Roman Woerner: „Novalis‘ Hymnen an die Nacht und Geistliche Lieder“, 1885 (PDF-Datei)
 Karl Joseph Simrock Karl Joseph Simrock (geb. 28. August 1802 in Bonn; gest. 18. Juli 1876 ebenda) war ein deutscher Dichter, Philologe und Übersetzer. Er wurde in Bonn als 11. und letztes Kind des Musikers und Musikverlegers Nikolaus Simrock geboren, besuchte in Bonn … Weiterlesen
Karl Joseph Simrock Karl Joseph Simrock (geb. 28. August 1802 in Bonn; gest. 18. Juli 1876 ebenda) war ein deutscher Dichter, Philologe und Übersetzer. Er wurde in Bonn als 11. und letztes Kind des Musikers und Musikverlegers Nikolaus Simrock geboren, besuchte in Bonn … Weiterlesen
Werke (Auswahl) hier als pdf Dateien
-
- 1827 Das Nibelungenlied (Übersetzung); (PDF-Datei, HTML-Version)
- 1830 Der arme Heinrich von Hartmann von Aue (Übersetzung)
- 1833 Gedichte von Walter von der Vogelweide (Übersetzung)
- 1835 Wieland der Schmied (Versepos) (PDF-Datei)
- 1836 Rheinsagen (PDF-Datei)
- 1839-43 Die deutschen Volksbücher
- 1842 Parzival und Titurel von Wolfram von Eschenbach (Übersetzung)
- 1843-49 Das Heldenbuch (Übersetzung)
- 1844 Gedichte (PDF-Datei)
- 1845 Reineke Fuchs (PDF-Datei)
- 1846 Die deutschen Sprichwörter (als Reclam-Band im Nachdruck, ISBN 978-3-15-008453-3 Bestellmöglichkeit)
- 1848 Kerlingisches Heldenbuch (PDF-Datei)
- 1851 Die deutschen Volkslieder (PDF-Datei)
- 1851 Die Edda (Übersetzung) (PDF-Datei Für Nicht-VSA-Bewohner nur mit US-Proxy abrufbar!, (als E-Buch), Netzbuch und PDF-Datei zum herunterladen)
- 1851 Gudrun, deutsches Heldenlied (PDF-Datei)
- 1853 Bertha die Spinnerin (PDF-Datei)
- 1855 Die Edda, die ältere und jüngere nebst den mythischen Erzählungen der Skalda, (PDF-Datei)
- 1855 Handbuch der deutschen Mythologie mit Einschluß der nordischen (PDF-Datei)
- 1855 Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg (Übersetzung) (PDF-Datei)
- 1855 Legenden (PDF-Datei)
- 1856 Heliand (altsächsische Evangelienharmonie) (Übersetzung) (PDF-Datei)
- 1857 Lieder der Minnesinger (Übersetzung) (PDF-Datei)
- 1858 Der Wartburgkrieg (PDF-Datei)
- 1859 Beowulf (Übersetzung) (PDF-Datei)
- 1859 Deutsche Weihnachtslieder, eine Festausgabe (PDF-Datei)
- 1863 Gedichte
- 1869 Bäckerjungensage
- 1870 Deutsche Kriegslieder (PDF-Datei)
- 1872 Dichtungen (PDF-Datei)
- 1900 Faust: Das Volksbuch und das Puppenspiel (PDF-Datei)
- Folgende Geschichten wurden von Simrock behutsam nachbearbeitet und im Jahre 1845 erstmals aufgelegt:
- Heinrich der Löwe; Die Schöne Magelone; Reineke Fuchs; Genovefa (PDF-Datei)
- Die Heimonskinder; Friedrich Barbarossa; Kaiser Octavianus (PDF-Datei)
- Peter Dimringer v.Staufenberg; Fortunatus; König Appllonius v.Tyrus; Herzog Ernst; Der gehörnte Siegfried; Wigoleis vom Rado (PDF-Datei, PDF-Datei auch zusammen mit Band 4 nur schwarz/weiß)
- Dr. Johannes Faust; Doctor Johannes Faust. Puppenspiel; Tristan und Isalde; Die heiligen drei Könige (PDF-Datei nur zusammen mit Band 3 nur schwarz/weiß)
- Die deutschen Sprichwörter (PDF-Datei)
- Melusina; Margraf Walther; Sismunda; Der arme Heinrich; Der Schwanenritter; Flos und Blankflos; Zauberer Virgilius; Bruder Rausch; Ahasverus (PDF-Datei)
- Fierabras; König Eginhard; Das deutsche Räthselbuch; Büttner Handwerksgewohnheiten; Der Huff- und Waffenschmiede- Gesellen Handwerksgewohnheit; Der Finkenritter (PDF-Datei)
- Die deutschen Volkslieder (PDF-Datei)
- Der märkische Eulenspiegel; Das deutsche Kinderbuch; Das deutsche Räthselbuch II; Thedel Unversährt von Walmoden; Hugschapler (PDF-Datei)
- Die sieben Schwaben; Das deutsche Räthselbuch 3. Sammlung; Oberon oder Hug v.Bordeaux; Till Eulenspiegel; Historie von der geduldigen Helena (PDF-Datei)
- Pontus und Sidonia; Herzog Herpin; Ritter Galmy (PDF-Datei)
- Thal Josophat; Hirlanda; Gregorius auf dem Stein; Die sieben weisen Meister; Ritter Malegis (PDF-Datei)
- Hans von Montevilla; Aesops Leben und Fabeln; Meister Lucidarius; Zwölf Sibyllen Weiszagungen; Lebensbeschreibung des Grafen von Schafgotsch (PDF-Datei)
Kluge Worte und Lebensweisheiten Lebe ein gutes, ehrbares Leben – wenn du älter wirst und zurückdenkst, wirst du es ein zweites Mal geniessen können. — Dalai Lama Genau genommen leben nur wenige Menschen wirklich in der Gegenwart, die meisten haben nur vor, einmal richtig zu … Weiterlesen
Philosophische Zitate
Denn wegen des Verwunderns haben die Menschen sowohl jetzt wie ehedem zu philosophieren begonnen.“ — Aristoteles
„Fast alle Menschen bedenken unablässig, daß sie der und der Mensch sind, nebst den Korollarien [Schlußfolgerungen], die sich daraus ergeben: hingegen, daß sie überhaupt ein Mensch sind und welche Korollarien hieraus folgen, das fällt ihnen kaum ein und ist doch die Hauptsache. Die Wenigen, welche mehr dem letzteren, als dem ersteren Satze nachhängen, sind Philosophen.“ — Arthur Schopenhauer
„Die Welt, die Welt, ihr Esel! ist das Problem der Philosophie, die Welt und sonst nichts!“ — Arthur Schopenhauer
Reich ist, wer weiß, daß er genug hat. (Laotse) Der Leichtsinn ist ein Schwimmgürtel für den Strom des Lebens. (Ludwig Börne) Ihr, die ihr noch jung seid, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten, als er noch jung … Weiterlesen
Später mehr zum Thema

 Vorab: Ich bin kein Christ (in dem heutigen Sinne), kein Zionist, kein Moslem, oder sonst was. Ich bin auch kein Weißer, Grüner, Brauner, oder Schwarzer. Kein Linker, kein Rechter und kein Befürworter einer erfundenen Richtung. Jeder soll als Mensch respektiert und keiner vergöttert Sein. Ich bin nicht auf dieser Erde, um zu sein, wie andere mich gerne hätten. Man wird erkennen, wer den echten Frieden im Herzen trägt und ein Interesse an einem resperktvollen Weltfrieden aller Völker in gleichberechtigtem Zusammenleben hat. Erst wenn alle Kirchen und Synagogen bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind, wird es sich, zum guten wenden.
Vorab: Ich bin kein Christ (in dem heutigen Sinne), kein Zionist, kein Moslem, oder sonst was. Ich bin auch kein Weißer, Grüner, Brauner, oder Schwarzer. Kein Linker, kein Rechter und kein Befürworter einer erfundenen Richtung. Jeder soll als Mensch respektiert und keiner vergöttert Sein. Ich bin nicht auf dieser Erde, um zu sein, wie andere mich gerne hätten. Man wird erkennen, wer den echten Frieden im Herzen trägt und ein Interesse an einem resperktvollen Weltfrieden aller Völker in gleichberechtigtem Zusammenleben hat. Erst wenn alle Kirchen und Synagogen bis auf die Grundmauern niedergebrannt sind, wird es sich, zum guten wenden.

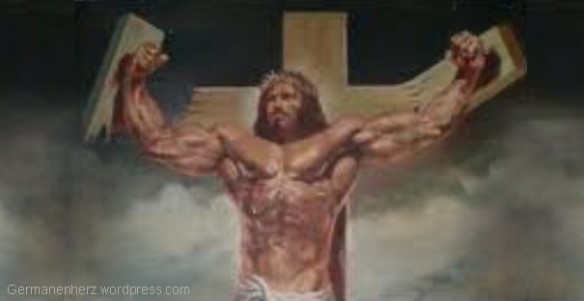

 Diese Stellen wollen sehr sorgsam gelesen sein. Dazu braucht man viele Jahre eigener Forschung oder man muß die Forschungen anderer wenigstens kennen, um ein Urteil zu haben.Das wäre ein kläglicher „Gott“, der erst seit 1900 Jahren der Welt sich offenbart hätte. Gott hat sich in allen großen Männern offenbart, schon seit die Erde steht.Du kannst Gott nur durch dich selber erfassen und begreifen und nicht durch ein Buch, auch nicht das wertvollste. Was die Bibel sagt, haben die Veden der Inder und die Edda schon viel früher und zum Teil viel besser gesagt oder viel besser erhalten. Das kann nicht jeder nachprüfen, aber wer die Wahrheit hört, der wird sie begreifen, wenn sein Herz und sein Verstand noch nicht durch Gebot und Verbot getrübt und betrübt worden sind. Wer „Christi“ Art ist, wer Gottes ist, der braucht alle diese Krücken nicht. Ich glaube mich näher Gott und näher dem Geiste „Christi“, weil ich nicht kleingläubig genug bin, alle diese Sinnbilder wörtlich und wirklich zu nehmen. Wer noch nicht dazu vorgedrungen ist, daß Gott Geist ist und der Inhalt dieser ganzen Welt im Guten und im Bösen, der steht noch weit ab in der Erkenntnis, der steht noch im täuschenden Wortglauben, der alles für bare Münze nimmt.
Diese Stellen wollen sehr sorgsam gelesen sein. Dazu braucht man viele Jahre eigener Forschung oder man muß die Forschungen anderer wenigstens kennen, um ein Urteil zu haben.Das wäre ein kläglicher „Gott“, der erst seit 1900 Jahren der Welt sich offenbart hätte. Gott hat sich in allen großen Männern offenbart, schon seit die Erde steht.Du kannst Gott nur durch dich selber erfassen und begreifen und nicht durch ein Buch, auch nicht das wertvollste. Was die Bibel sagt, haben die Veden der Inder und die Edda schon viel früher und zum Teil viel besser gesagt oder viel besser erhalten. Das kann nicht jeder nachprüfen, aber wer die Wahrheit hört, der wird sie begreifen, wenn sein Herz und sein Verstand noch nicht durch Gebot und Verbot getrübt und betrübt worden sind. Wer „Christi“ Art ist, wer Gottes ist, der braucht alle diese Krücken nicht. Ich glaube mich näher Gott und näher dem Geiste „Christi“, weil ich nicht kleingläubig genug bin, alle diese Sinnbilder wörtlich und wirklich zu nehmen. Wer noch nicht dazu vorgedrungen ist, daß Gott Geist ist und der Inhalt dieser ganzen Welt im Guten und im Bösen, der steht noch weit ab in der Erkenntnis, der steht noch im täuschenden Wortglauben, der alles für bare Münze nimmt.


 Die meisten der heutigen Kirchenvertreter sind Handlanger der „Synagoge des Satans“ (Offenbarung). Sie stellen die universellen Werte der Schöpfung auf den Kopf. Mit menschenfeindlichen, „universellen Werten“ trachten sie, die göttliche Schöpfungsordnung zu ersetzen. Beispielsweise sollen sich die Völker, die in ihrer ethnischen Unversehrtheit dem Willen Gottes entsprechen bzw. „Gedanken Gottes sind“ (Herder), selbst auflösen, also Schöpfungs-Suizid begehen. Wer sein eigenes Volk durch andere Völkermassen austauschen will hat vor, Gott und sein großartiges Werk anzugreifen, die Schöpfung zu vernichten, ein wahrlich satanisches Begehren!
Die meisten der heutigen Kirchenvertreter sind Handlanger der „Synagoge des Satans“ (Offenbarung). Sie stellen die universellen Werte der Schöpfung auf den Kopf. Mit menschenfeindlichen, „universellen Werten“ trachten sie, die göttliche Schöpfungsordnung zu ersetzen. Beispielsweise sollen sich die Völker, die in ihrer ethnischen Unversehrtheit dem Willen Gottes entsprechen bzw. „Gedanken Gottes sind“ (Herder), selbst auflösen, also Schöpfungs-Suizid begehen. Wer sein eigenes Volk durch andere Völkermassen austauschen will hat vor, Gott und sein großartiges Werk anzugreifen, die Schöpfung zu vernichten, ein wahrlich satanisches Begehren!



 Eine Lubavitcher Mischung mit den oberen Rängen der einzelnen Gastländer. Ihr Einfluss in den einzelnen Ländern ist unterschiedlich.Die kanadische Regierung hat der Sekte vor kurzem $800.000 für den Bau eines Chabad-Zentrums in Montreal gegeben. Die Beziehungen zu Russland sind weniger warm; die Russen haben sich vor kurzem geweigert, zwei große Text-Sammlungen der Chabad zu übergeben, die frühere sowjetische Regierungen beschlagnahmt hatten.
Eine Lubavitcher Mischung mit den oberen Rängen der einzelnen Gastländer. Ihr Einfluss in den einzelnen Ländern ist unterschiedlich.Die kanadische Regierung hat der Sekte vor kurzem $800.000 für den Bau eines Chabad-Zentrums in Montreal gegeben. Die Beziehungen zu Russland sind weniger warm; die Russen haben sich vor kurzem geweigert, zwei große Text-Sammlungen der Chabad zu übergeben, die frühere sowjetische Regierungen beschlagnahmt hatten.
 Der von der NATO unterstützte Atlantic Council hat die Apartheid-Israel als Blaupause für eine hypermilitarisierte Ukraine vorgeschlagen, die aus Westlichen-Steuergeldern finanziert wird. Nur vierzig Tage nach Beginn des russischen Feldzugs in der Ukraine sagte der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj gegenüber …
Der von der NATO unterstützte Atlantic Council hat die Apartheid-Israel als Blaupause für eine hypermilitarisierte Ukraine vorgeschlagen, die aus Westlichen-Steuergeldern finanziert wird. Nur vierzig Tage nach Beginn des russischen Feldzugs in der Ukraine sagte der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj gegenüber … 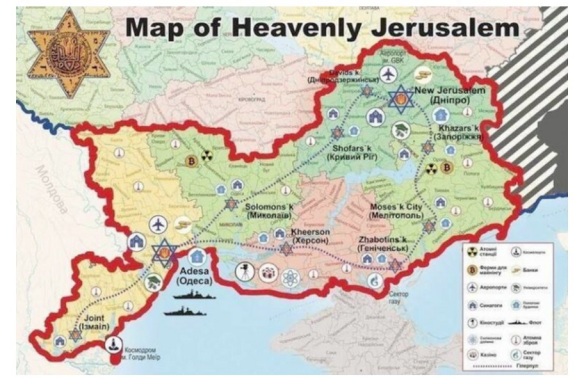 Veröffentlicht am
Veröffentlicht am  Erstellt am 18. August 2010 von totoweise Einleitung Anlass zu dieser Abhandlung gab der englische (ungarisch-deutscher Herkunft) Historiker und Schriftsteller, Arthur Koestler. Stützend auf umfangreicher Fachliteratur, beschreibt er, in seinem Buch: „Der dreizehnte Stamm – Das Reich der Khasaren und sein Erbe“ (Deutsche …
Erstellt am 18. August 2010 von totoweise Einleitung Anlass zu dieser Abhandlung gab der englische (ungarisch-deutscher Herkunft) Historiker und Schriftsteller, Arthur Koestler. Stützend auf umfangreicher Fachliteratur, beschreibt er, in seinem Buch: „Der dreizehnte Stamm – Das Reich der Khasaren und sein Erbe“ (Deutsche …  Die Religion hat so viele Menschen böse gemacht, tut es noch und wird es immer tun. Religion in ihrer jetzigen Art ist ein Gefängnis für Körper, Seele und Geist. Religionskritik ist aber kein neues Phänomen, wie man oft vermutet. Schon …
Die Religion hat so viele Menschen böse gemacht, tut es noch und wird es immer tun. Religion in ihrer jetzigen Art ist ein Gefängnis für Körper, Seele und Geist. Religionskritik ist aber kein neues Phänomen, wie man oft vermutet. Schon … 
 Der Zionismus ist der Feind des jüdischen Volkes und das Anti, zu einer gemeinsamen Kulturweltanschauung der Völker dieser Erde Vorab mal kurz zur Info. Da ich selbst judenstämmig bin, aber nichts mit deren zionistischen Ideologien gleichendes verspüre, möchte ich mich …
Der Zionismus ist der Feind des jüdischen Volkes und das Anti, zu einer gemeinsamen Kulturweltanschauung der Völker dieser Erde Vorab mal kurz zur Info. Da ich selbst judenstämmig bin, aber nichts mit deren zionistischen Ideologien gleichendes verspüre, möchte ich mich … 








 In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi, steht eine »große Stadt«, ja eine »Hure«, deren entlarvtes Angesicht erschaudern läßt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, daß »Babylon, die große Mutter aller Greuel der Erde« sei, eine Stadt auf …
In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi, steht eine »große Stadt«, ja eine »Hure«, deren entlarvtes Angesicht erschaudern läßt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, daß »Babylon, die große Mutter aller Greuel der Erde« sei, eine Stadt auf … 


 Die Augen des Horus Geschichte fußt auf drei Säulen der Artefakt, oder Sachbeweis. das Dokument, Urkunde oder Schriftstück, also der Dokumentenbeweis. Da wäre noch wenn lebend,der Zeuge, also ein Beobachte vor Ort, oder der Zeugenbeweis. Unter diesen drei Säulen ist …
Die Augen des Horus Geschichte fußt auf drei Säulen der Artefakt, oder Sachbeweis. das Dokument, Urkunde oder Schriftstück, also der Dokumentenbeweis. Da wäre noch wenn lebend,der Zeuge, also ein Beobachte vor Ort, oder der Zeugenbeweis. Unter diesen drei Säulen ist …  Ich wünsche jedem Menschen dass er/sie die Wahrheit erkennt und seine Seele rettet! Ich bete für jeden von euch da draußen möge Gott euch und eure Familien beschützen, Amen ergänzend Feuer- und Molochdienst der alten Hebräer Das römische Kolosseum ist …
Ich wünsche jedem Menschen dass er/sie die Wahrheit erkennt und seine Seele rettet! Ich bete für jeden von euch da draußen möge Gott euch und eure Familien beschützen, Amen ergänzend Feuer- und Molochdienst der alten Hebräer Das römische Kolosseum ist …  Nun hat sich das Judentum mit dem Alten Testament selbst zum allein berechtigten Herrscher über die Völker der Erde erhoben auf Grund der Verheißung: … so wird dich der HErr, dein GOtt, das höchste machen über alle Völker auf Erden. …
Nun hat sich das Judentum mit dem Alten Testament selbst zum allein berechtigten Herrscher über die Völker der Erde erhoben auf Grund der Verheißung: … so wird dich der HErr, dein GOtt, das höchste machen über alle Völker auf Erden. … 
 Die Wahrheit kommt ans Licht Die Lüge weiß, dass ich sie enttarnt habe, denn ich sehe alles und höre ALLES. Wer kann vorm Vater bestehen? Fast alle Institutionen der modernen westlichen Zivilisation halten die Menschheit von Fortschritt, Wahrheit, Freiheit und Glück ab. Fast ausnahmslos jede westliche Institution – Regierung, Medien, Unterhaltung, Sport, Bildung, Finanzen, Technik, Wissenschaft, Medizin und mehr – wurde von antimenschlichen, luziferischen Kräften indoktriniert, die eine Politik vorantreiben, die im reinen Bösen verwurzelt ist:
Die Wahrheit kommt ans Licht Die Lüge weiß, dass ich sie enttarnt habe, denn ich sehe alles und höre ALLES. Wer kann vorm Vater bestehen? Fast alle Institutionen der modernen westlichen Zivilisation halten die Menschheit von Fortschritt, Wahrheit, Freiheit und Glück ab. Fast ausnahmslos jede westliche Institution – Regierung, Medien, Unterhaltung, Sport, Bildung, Finanzen, Technik, Wissenschaft, Medizin und mehr – wurde von antimenschlichen, luziferischen Kräften indoktriniert, die eine Politik vorantreiben, die im reinen Bösen verwurzelt ist:







 Johann Wolfgang von Goethe, (28. August 1749 in Frankfurt am Main; 22. März 1832 in Weimar) war eines der größten Dichtergenies aller Zeiten. Am Hof von Weimar bekleidete der „Kronzeuge der nationalen Identität der Deutschen“ als Freund und Minister des …
Johann Wolfgang von Goethe, (28. August 1749 in Frankfurt am Main; 22. März 1832 in Weimar) war eines der größten Dichtergenies aller Zeiten. Am Hof von Weimar bekleidete der „Kronzeuge der nationalen Identität der Deutschen“ als Freund und Minister des … 
























 Ursprung und Antike „Magier“ ist ursprünglich der Name eines Stammes der Meder, dem die Ausübung der heiligen Gebräuche und die Erhaltung der gelehrten Kenntnisse anvertraut war (ähnlich wie der Stamm Levi bei den Israeliten). Herodot beschrieb sie im 5. Jahrhundert …
Ursprung und Antike „Magier“ ist ursprünglich der Name eines Stammes der Meder, dem die Ausübung der heiligen Gebräuche und die Erhaltung der gelehrten Kenntnisse anvertraut war (ähnlich wie der Stamm Levi bei den Israeliten). Herodot beschrieb sie im 5. Jahrhundert … 

 Leonardo da Vinci, Lionardo di ser Piero da Vinci, (* 15. April 1452 in Anchiano bei Vinci; † 2. Mai 1519 auf der Burg von Cloux in der Nähe von Amboise in Frankreich) war ein italienischer Universalgelehrter. Als uneheliches Kind …
Leonardo da Vinci, Lionardo di ser Piero da Vinci, (* 15. April 1452 in Anchiano bei Vinci; † 2. Mai 1519 auf der Burg von Cloux in der Nähe von Amboise in Frankreich) war ein italienischer Universalgelehrter. Als uneheliches Kind … 
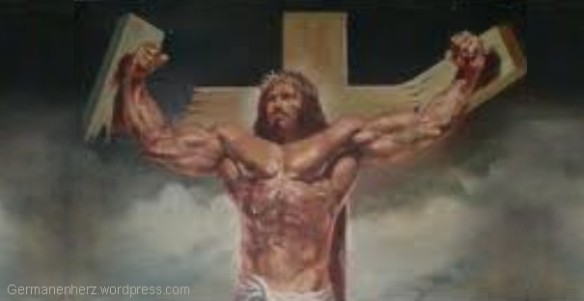 Der Jesus von Nazaret (aramäisch ישוע ܝܫܘܥ Jēšūʿ [/jəʃuʕ/] Jeschua oder Jeschu, gekreuzigt für die Sünden der gottlosen Menschen dieser Welt. „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt …
Der Jesus von Nazaret (aramäisch ישוע ܝܫܘܥ Jēšūʿ [/jəʃuʕ/] Jeschua oder Jeschu, gekreuzigt für die Sünden der gottlosen Menschen dieser Welt. „Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt …  Satans Herrschaft über diese Welt, diese „gegenwärtige, böse Welt“ (Galater 1,4; 1. Johannes 5,19), wird für die nächsten eintausend Jahre beendet sein. Der Kampf um die Kontrolle über die Erde ist vorbei. Nach Gottes Zeitplan wird es Zeit für den …
Satans Herrschaft über diese Welt, diese „gegenwärtige, böse Welt“ (Galater 1,4; 1. Johannes 5,19), wird für die nächsten eintausend Jahre beendet sein. Der Kampf um die Kontrolle über die Erde ist vorbei. Nach Gottes Zeitplan wird es Zeit für den … 















