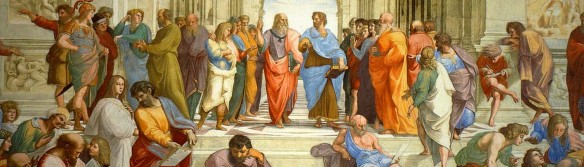Der vorliegende Artikel Raubstaat England beinhaltet ergänzendes Text und Bildmaterial aus dem gleichnamigen Zigarettenbilderalbum. Das Album wurde herausgegeben vom Cigaretten-Bilderdienst Hamburg Bahrenfeld.
Es war nicht lange nach der letzten Jahrhundertwende, als man anfing, uns Quartaner mit den Geheimnissen der englischen Sprache vertraut zu machen. Unser Lehrbuch begann mit einem Gedicht, genauer gesagt: mit einem Matrosensong. Der Lehrer sprach ihn uns Silbe für Silbe vor, und wir wurden mit Staunen gewahr, welcher Verrenkungen die menschlichen Sprechwerkzeuge, welcher Unreinlichkeiten die Muskulaturen des Kehlkopfes fähig sein mußten, um echt englisch klingende Laute hervorzubringen. Unsere ersten Nachahmungsversuche, bei denen uns der treffliche Pädagoge die Kiefer hin und her schob und die Zunge hinter die obere Zahnreihe drückte, fielen dann auch einigermaßen unzulänglich aus. Bald aber beflügelte uns die ach! so knabenhafte Freude an der Erzeugung mißtönender Geräusche, und es kam der Tag, wo wir für reif befunden wurden, das ganze Matrosenlied im Sprechchor aufzusagen. Da schallten dann unsere noch nicht brüchigen Stimmen an die Klassenwände und durch die offenen Fenster auf die Straße hinunter, zaghaft zuerst, dann immer schmetternder und bei der Schlußstrophe fast in ein Triumphgeschrei ausartend. Diese Schlußstrophe aber lautete:
. 
„And it is our endeavour,
In battle and breeze,
That England shall ever
Be Lord of the seas.“
Es klingt unwahrscheinlich, aber es ist wahrhaftig wahr: der Glaube an die meerbeherrschende Sendung Englands wurde damals, am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts, vor einer Quartaner-Generation nach der anderen, vor lauter deutschen Buben verkündet! (Manche unserer Leser werden sich erinnern, daß dieser Matrosensong noch während des Weltkrieges in den Schulen exerziert wurde – nur mit dem Unterschied, daß die Jungen sehr bald aus dem „ever“ ein „never“, aus dem „immer“ ein „niemals“ machten). Ist es nicht erstaunlich, daß niemand sich etwas dabei dachte? Die Verse prägten sich uns unvergeßlich ein, und mit ihnen zugleich mußte ganz unvermerkt eine Art von Ehrfurcht vor Englands Seemacht in uns aufkommen.
Die Stücke, die im Lehrbuch auf den Matrosensong folgten, waren geeignet, unseren Respekt vor englischem Heldentum noch zu steigern. Da war etwa die so rührende wie erbauliche Geschichte vom Heldentode des Generals Wolfe bei Quebec und seinen letzten Wünschen für Englands Größe. Dann kam eine herzhafte Erzählung von dem Sieg Marlboroughs, des großen englischen Feldherrn, in der Schlacht bei Blenheim. (Davon, daß auch ein gewisser Prinz Eugen an diesem Siege beteiligt war, stand nichts in der Erzählung.) Es folgten Berichte über die ruhmreichen Taten englischer Heere gegen die Schotten, die Iren, englischer Seehelden gegen Spanier, Holländer und Franzosen; auch Wellingtons tapferes Ausharren bei Waterloo fehlte nicht – kurzum, es mußte in uns der Eindruck entstehen, als seien die Engländer nicht nur großherzig und unbezwinglich als Krieger, sondern als hätten sie auch immerdar das Recht auf ihrer Seite gehabt. Das Recht – und infolgedessen auch die deutschen Sympathien. Ja, waren denn nicht wirklich die Engländer – von Marlborough über Pitt bis zu Wellington – stets unsere Verbündeten gewesen, hatten sie uns nicht stets gegen die Franzosen beigestanden, waren sie nicht gewissermaßen aus unserer Familie, diese guten „Vettern jenseits des Kanals“?
Mögen solche Jugenderlebnisse auch im einzelnen recht verschieden gewesen sein, im ganzen wird man sagen dürfen, daß die deutsche Jugend vor dem Weltkriege in einer seltsamen, fast resignierenden Englandfrömmigkeit auferzogen wurde – aus der dann ein böses Erwachen folgte, als England sich gleich zu Beginn des Weltkrieges auf die Seite unserer Feinde stellte. Und diese Stimmung kritikloser Hochachtung herrschte, darüber tun wir gut, uns heute klar zu sein, nur gegenüber England. Unvorstellbar etwa, daß in Lehrbücher der französischen Grammatik Stücke aufgenommen worden wären, die den französischen Imperialismus verherrlichten! Hier wirkte der Krieg von 1870 noch nach; hier war man empfindlich. Gegen England aber war man weitherzig; vor England, so schien es, brauchte man nicht auf der Hut zu sein. Wohl hatten die Ereignisse des Burenkrieges und die Rückwirkungen, die die deutschen Sympathien für die Buren in England hervorgerufen hatten, schon einen bedrohlichen Schatten auf die deutsch-englischen Beziehungen geworfen; aber man sah darin keinen Grund, die Jugend in einem anderen Geiste als bisher zu erziehen.
Heute will uns diese Stimmung ganz unfaßlich erscheinen, und wir fragen uns, wie jene Verblendung überhaupt möglich geworden ist. Die Dinge liegen verhältnismäßig einfach. Das liberale Bürgertum des Zweiten Reiches, die breite Schicht der „Gebildeten“ war von Haus aus zur Englandfreundlichkeit geneigt. Man bewunderte und beneidete die „freiheitlichen Einrichtungen“ Englands und fühlte sich den „Vettern“ im Streite gegen Knechtschaft und Unfreiheit ein wenig unbestimmt, aber jedenfalls verwandtschaftlich verbunden. Und so erschien jeder Krieg, den England geführt hatte, als ein Kampf gegen die Unfreiheit. Ohne sich dessen recht bewußt zu sein, sah man die Engländer so, wie diese selbst gesehen zu werden wünschten, übernahm man die englische Ansicht von der Weltgeschichte.
Das fing schon an mit Englands Kampf gegen Spanien, dem ersten Kampfe, mit dem es in die Weltpolitik eintrat. Da war die durch Schiller vertraute Königin Elisabeth, eine wahre Nationalheldin, ebenso groß und bewundernswert, wie ihre katholische Schwester und Vorgängerin, die „blutige Maria“, verabscheuenswert und verächtlich gewesen war. Verächtlich schon deshalb, weil sie den König Philipp von Spanien – man denke, einen fremden Monarchen und überdies einen Freund der Inquisition, einen Despoten! – zum Manne gehabt hatte. Wie anders Elisabeth, die mit ihren Seehelden zum Kampfe gegen diesen Despoten antrat und der es, mit Hilfe der Winde, gelang, seine großmächtige Flotte, die Armada, zu vernichten! War das nicht ein wahres Gottesgericht gewesen, ein Sieg der guten Sache, der nationalen Selbständigkeit gegen die Weltherrschaftspläne Spaniens?
Auch als einen Sieg des „protestantischen“ England gegen das katholische Spanien feierten wohl unsere Liberalen von damals den Sieg über die Armada. Diesen von England zu jeder Zeit listig und geschickt ausgenutzten Wahn von der Solidarität der protestantischen Völker konnte man nun allerdings nicht ins Feld führen bei Englands Kampf gegen den nächsten Rivalen zur See und in Übersee: Holland. Denn Holland war nun gewiß ein protestantisches Land, ja recht viel eindeutiger protestantisch als England mit seinen Bischöfen und seinen Meßgewändern. Da mußten also andere Unterscheidungen herhalten.
Die Holländer, so hieß es, seien nicht würdig gewesen, ein großes Kolonialreich ihr eigen zu nennen; denn sie waren kurzsichtige, nur auf den nächsten Vorteil und auf behäbigen Lebensgenuß bedachte Krämer, rechte „Pfeffersäcke“. Kein Wunder, wenn ein so weitschauendes, in Jahrhunderten und in Kontinenten denkendes, nur auf das Wohl der ganzen Menschheit bedachtes Volk wie die Engländer ihnen den Rang abgelaufen hatte. . .
Und dann das gewaltige, von den Zeiten Ludwigs XIV. bis an das Ende Napoleons währende Duell zwischen England und Frankreich: Hier wurde dem Deutschen seine einseitige Parteinahme für England noch dadurch erleichtert, dass Deutschland aus jener Zeit seine eigenen, sehr gewichtigen Beschwerden gegen Frankreich hatte. Deutsches Gebiet am Rhein war geraubt, deutsche Städte und Schlösser waren niedergebrannt worden. Unvergessen waren die Drangsale, die Napoleons Marschälle deutschem Land und Volk auferlegt hatten. Dagegen die Engländer: hatten sie nicht auf unserer Seite wider den Sonnenkönig, wider Napoleon gefochten? Hatten sie nicht dem Großen Friedrich geholfen? War nicht unsere Sache und die ihre eine gemeinsame Sache gewesen, die Abwehr der französischen Weltherrschaftsgelüste, die Sicherung deutscher Selbständigkeit?
Welch einfaches, leicht eingängliches Bild: Frankreich unser Erbfeind, England der Vorkämpfer der Freiheit, unser Mitstreiter und Helfer! Das deutsche liberale Bürgertum der Vorweltkriegszeit, von Haus aus anglophil, ließ sich von diesem Bilde blenden. Es übersah dabei ganz und gar, welche Beweggründe England bei seinem Kampfe gegen Frankreich geleitet hatten. Es fragte nicht, wieweit deutsche Staaten in jenen Kriegen mit Frankreich Werkzeug englischer Interessen gewesen waren. Es wusste wohl, dass Frankreichs Politik jederzeit dahin gegangen war, Einigkeit und starke Staatsmacht in Deutschland zu verhindern, aber es begriff nicht, dass auch England nie etwas anderes getan hatte als aus der Zerspaltenheit und Schwäche der politischen Macht Deutschlands den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Darum wollte es die Tatsache nicht wahr haben, dass England dem geeinten Reich, dem Reich Bismarcks, im Laufe der Jahre mit immer größerer Feindseligkeit begegnete – bis dann am 4. August 1914 die Maske fiel.
Das Vierteljahrhundert, das seitdem vergangen ist, hat uns über vieles, was England betrifft, die Augen geöffnet. Wir sehen nicht mehr, nach der Weise der meisten unserer Großväter, England als ein Glied der europäischen „Völkerfamilie“, das gelegentlich, wenn es not tut, selbstlos nach dem Rechten sieht. Englands Verhalten seit 1914 hat auch dem Begriffsstutzigsten die Augen darüber geöffnet, dass es nur eine Richtschnur seiner Politik kennt: Es will und muss seine Stellung als Ausbeuter der Welt erhalten. Es kann nicht dulden, dass irgendwo in der Welt, ob in Europa oder im Fernen Osten, ein Volk sich aus dem Gesetz seines völkischen Lebens einen starken Staat baut. Denn dieses Volk könnte einmal – in naher oder in ferner Zukunft – England unbequem werden, es im Genuß seines Reichtums und seiner Macht einengen.
Wir sind nicht mehr in Versuchung, in den verhängnisvollen Irrtum der deutschen Liberalen des neunzehnten Jahrhunderts zu verfallen und in England einen europäischen Nationalstaat zu sehen. Das nationalsozialistische Deutschland hat – nicht durch Drohung, nicht durch Angriff, sondern einfach durch die Tatsache seiner starken Existenz – England gezwungen, sich als das zu entlarven, was es ist: als den Räuber, den es um seine Beute bangt. Wir wollten ihm diese Beute gar nicht streitig machen, wir verlangten nur das eine Stück, das uns rechtens gehört und das für England, wie es selbst erklärte, keinen Wert hat: unsere Kolonien. Wir dachten nicht daran, ihm seinen gewaltigen Besitz zu schmälern oder etwa gar, in seine Fußstapfen tretend, nun unsererseits zu Nutznießern fremder Arbeit, zu Unterdrückern aufstrebender Völker zu werden. Aber wir fragten England nicht um Erlaubnis, als wir uns von dem Joch eines schmählichen Vertrages befreiten. Der Führer machte uns frei von aller Abhängigkeit gegenüber den Mächten von Versailles, er gewann die deutsche Souveränität zurück, er schuf aus Klassen das Volk, aus einem Kastenstaat den deutschen Sozialismus – und eben darum wurde England unser Feind. Es hat sich durch den Mund seiner führenden Politiker verraten. Seine Klagen über angebliche deutsche „Weltherrschaftspläne“ kommen aus der Angst um die eigene Weltherrschaft.
Als 1914 England in die Reihen unserer Feinde trat, war die Wirkung dieses Ereignisses auf die liberale Schicht unserer Gebildeten so erschreckend, dass die Englandfrömmigkeit über Nacht in besinnungslosen Hass umschlug. Heute stehen die Dinge anders. Da wir nicht aus seligem Schlummer aufgestört wurden, sondern die Positionen schon vor dem Ausbruch des Krieges klar erkannt haben, sind wir nicht mehr in Gefahr, uns durch Leidenschaften verblenden zu lassen. Wir steigern uns nicht in stürmische und haltlose Erregungen hinein, wenn wir von England sprechen. Wir nennen nur das Kind beim rechten Namen. Wir nennen England einen Raubstaat, und meinen das ganz schlicht und sachlich. Es läuft uns da kein Schimpfwort unter. Wir wissen sehr wohl zu unterscheiden zwischen Eroberung und Raub. Viele große Reiche sind durch Eroberung entstanden – das Alexanders des Großen, das der Römer, das der Deutschen des Mittelalters, das der Spanier, der Schweden, der Russen; immer trat dabei ein stärkeres Volk, eine überlegene Führung auf und setzte mit dem Siege zugleich ein neues weltgeschichtliches Prinzip durch, mit anderen Worten: es schuf eine neue Weltkultur. Davon ist bei dem englischen Weltreich keine Rede. Es wurde nicht erobert, es wurde geraubt, Stück um Stück anderen weggenommen, brutal und mit unmenschlicher Grausamkeit, aber ohne überlegene Führung, ohne dass eine neue Kultur geschaffen oder daß auch nur der Versuch dazu gemacht wurde – nach dem einfachen Gesetz, nach dem auch der Halsabschneider verfährt.
Wie das im einzelnen geschah, wie es zu dem riesigen Besitz Englands gekommen ist – das soll auf den folgenden Blättern erzählt werden.
„Dem Mutigen gehört die Welt!“ Der Spruch gilt gewiss nicht nur für das Leben der einzelnen, sondern auch für Werden und Wachsen der Völker. Ohne Mut, ohne Vertrauen auf seine Stärke, ohne Glauben an seine Sendung hat noch kein Volk etwas Großes in der Welt zustande gebracht. Auch nicht ohne Härte und Gewalt. Die Weltgeschichte urteilt nicht wie ein wehleidiger Pazifist, der, dürfte er nur im Weltgericht sitzen, am liebsten Alexander und Hannibal, Caesar und Carolus Magnus, den Großen Friedrich und Napoleon in den tiefsten Grund der Hölle verbannen würde. Sie wägt nicht das, was dem oder jenem lieb ist, auf der Goldwaage. Sie fragt nur, welche schöpferische und gestaltende Kraft in dem Aufschwung und Ansturm eines Volkes lebte, was durch dieses Volk an Unverwechselbarem in die Welt kam. Fern müsste es uns daher sein, die Engländer anzuklagen, wäre ihr Aufstieg in der Welt die Frucht unbändig pulsierender Lebenskraft gewesen. Aber davon finden wir wenig, wenn wir Englands Anfänge betrachten. Die führende Schicht sitzt wie die Spinne in ihrem Netz; sie wartet, sie hat Zeit, sie ist jedem kühnen Wagnis abhold. Sie weicht dem offenen Kampfe mit dem gleich Starken aus. Aber sie ist listig, berechnend, grausam und versteht es, den Augenblick zu erfassen, wo sie das gelähmte Opfer überfallen und aussaugen kann.
Zu der Zeit, da diese Spinne ihre ersten Netze zieht – es ist am Beginn jener Zeit, die wir die „Neuzeit“ zu nennen pflegen, also etwa um 1500 -, neigt sich das Gestirn einer geschichtlichen Großmacht dem Niedergang zu, die mehr als andere, mehr wohl auch als Kaisertum und Papsttum, das Gesicht Europas als des in die Welt schauenden Erdteils bestimmt: das Gestirn der deutschen Hanse. Wagende Kaufleute, Seefahrer zugleich, aus den Rheinlanden hatten einst unter dem Schutz Heinrichs des Löwen Lübeck gegründet, die Küsten der Ostsee mit einem Städtekranz umzogen, den Warenverkehr mit den Ländern des Nordens und Ostens möglich gemacht, russische Pelze in Brügge, flandrische Tuche in Nowgorod zum Kaufe gestellt. Geschlecht um Geschlecht hatte die Fäden immer dichter gezogen, immer neue Gebiete dem Austausch und damit auch der Kultur des Abendlandes erschlossen. Wahre Pioniere waren sie gewesen, diese hansischen Kaufherren, und später umsichtige Wahrer und Mehrer des Ererbten. Ihre Rührigkeit, ihr strenger, zuchtvoller Sinn, ihre überlegene Kenntnis der Länder, der Meere und der Güter gaben ihnen höchste Autorität auch an vielen Orten außerhalb des Römischen Reiches Deutscher Nation, als dessen Diener sie sich fühlten – in Norwegen und Schweden, in Flandern und in England.
Gerade auch in England. Die Nation, die heute Seefahrt und Welthandel als ein Privileg auszugeben pflegt, das ihr die Vorsehung in grauer Urzeit auf Grund ihrer unvergleichlichen Tüchtigkeit verliehen habe und das daher kein anderes Volk anzutasten sich unterfangen darf – diese Nation trieb damals, als die deutsche Hanse den Güterverkehr des Abendlandes in ein segensreiches, fruchtbares Gefüge brachte, weder Seefahrt noch auch nennenswerten Handel! Im festungsgleich ummauerten, gegen den plünderungslustigen Londoner Stadtpöbel streng bewachten „Stalhof“ an der Themse saßen die hanseatischen Kaufleute und hüteten das Gedeihen des englischen Volkes. Ohne sie hätte es in England kein Wachs für die Kerzen und keinen Honig, kein Kupfer und keine Pelze, keine Heringe und kein Bier gegeben, und auch kein Eibenholz für die Bögen der englischen Bogenschützen, die in Frankreich Krieg führten. Denn Frankreich zu erobern – darauf war mehr als hundert Jahre lang der Sinn der englischen Könige gegangen. Da war es ihnen nur willkommen gewesen, wenn die Deutschen sich um die Versorgung des englischen Volkes kümmerten. Auch dazu waren die Kaufherren des Stalhofes gut, dass sie den Königen, wenn es Not tat – und es tat sehr häufig not -, die Gelder zur Kriegführung vorstreckten, ja bisweilen sogar die Krone selbst mitsamt ihren Juwelen zum Pfände nahmen.
Nun kann aber ein Land die Güter, die es einführt, schließlich nur mit denen bezahlen, die es selbst im Überfluss erzeugt. Was hatte England der Hanse als Gegenleistung zu bieten? Sein Reichtum waren seine Schafherden. Was die hansischen Schiffe zurück ans Festland brachten, waren Ballen englischer Wolle. An die Wolle knüpft sich also Englands Schicksal in dieser Zeit – knüpfen sich auch Englands erste Schritte in die Welt.
Die Bereitung der Wolle ist seit unvordenklicher Zeit auf der britischen Insel heimisch, deren feuchtes Klima der Festigung des Gesponnenen so förderlich ist. Auch die einfachen Formen der Weberei hatten schon die Römer in Britannien vorgefunden. Doch das England des Mittelalters hatte diesen natürlichen Vorsprung nicht zu halten vermocht. In den die Volkskraft verzehrenden Kämpfen um den Boden Frankreichs waren die feinen Künste in Vergessenheit geraten. Als die Hanse nach England kam, verstand man dort nicht mehr zu weben. Was auf den Markt kam, war die ungefärbte, rohe Wolle, aus der dann die flandrischen Tuchmacher erst die in der ganzen Welt begehrten Gewandstoffe herstellten.
Im Gefüge der blühenden mittelalterlichen Weltwirtschaft war also England nichts weiter als ein Rohstoffland, aus dem sich Europa versorgte – wie später etwa Brasilien zu der Zeit, da man nur den Wildwachsenden Kautschuk kannte. England tat selbst kaum etwas zur Ausnutzung dieses Reichtums, es führte fast das Dasein einer Kolonie. Es war weit, weit hinter der Zeit zurück.
Der Binnenhandel mit den groben Geweben einheimischer Erzeugung allerdings war in den Händen englischer Kaufleute geblieben, und in ihren Kreisen regte sich denn auch der erste Widerstand gegen die Hanse. Sie waren es, auf deren Rat die Könige seit Eduard III. (1327-1377) ausländische, vor allem flandrische Weber, Färber und Walker auf die Insel riefen. Mit fremder Kraft also wurde eine exportfähige Tuchindustrie aufgebaut; Zugewanderte halfen den Vorsprung aufholen, den das regere und tüchtigere Festland gewonnen hatte. Ein Erbe, das das mittelalterliche England dem modernen hinterließ: die Geschicklichkeit, mit fremdem Kalbe zu pflügen …
Durch diesen Rückhalt gestärkt, unternahmen es dann die Londoner Wollhändler, sich selbst, zum Schaden der lästigen Hanse, im Exportieren zu versuchen. Auch hier zeigten die englischen Händler nichts, was sie zu Pionieren oder Bahnbrechern erhöbe. Man hält sich durchaus in dem Schema, das man bei der Hanse abgelesen hat; man ahmt fremdes Vorbild nach und wähnt, dadurch etwas Besonderes zu leisten. Man gründet eine Gesellschaft, die sich Schiffe mietet und auf ihnen englische Tuche in die Häfen der Nord- und Ostsee befördert, und nennt sie mit typisch englischer Überheblichkeit die Gesellschaft der „wagenden Kaufleute“ (merchant adventurers), obwohl hier von einem Wagnis, einem Abenteuer im großen Sinne des Wortes überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Denn durch hansischen Wagemut waren längst alle Bahnen geebnet, hansische Seefahrtskunst hatte die Schiff-Fahrtslinien bis ins kleinste ausprobiert, hansische Handelswege leiteten die Güter weiter ins Hinterland. Die „wagenden Kaufleute“ haben Europa und seiner Kultur nichts Neues gebracht. Sie waren verspätete Ankömmlinge, die mit dem Ellenbogen versuchten, die wahren Pioniere zu verdrängen.
Kein Wunder, dass es zu Streitigkeiten kam, zu Kapereien und Plünderungen, zu Totschlag und Ächtung. Aber war auf seiten der Hanseaten das überlegene Können, so kam den Engländern ein schwerwiegender Vorteil zugute: sie wurden durch einen Landesherrn gedeckt, während die Hanse angesichts der Schwäche des Reiches auf sich selbst angewiesen war. Das musste der hansischen Stellung in England, und damit in Westeuropa überhaupt, zum Verhängnis werden in dem Augenblick, wo die Macht des englischen Königtums sich voll auswirken konnte. Solange der hundertjährige Krieg mit Frankreich währte, war das noch nicht der Fall, und erst recht nicht, als die blutigen „Rosenkriege“ (1459-1485) das Land aufwühlten. Dann aber kommt mit dem Siege über den blutgierigen dritten Richard ein Mann zur Macht, der so recht nach dem Herzen der „wagenden Kaufleute“ war, ein Mann also, der nichts wagt, sondern seine Augen starr auf die Erweiterung des Wollexports und die Verdrängung der Hanse gerichtet hält: der erste König aus dem Hause Tudor, Heinrich VII.
„Dem Mutigen gehört die Welt.“ Dem geschichtlichen Betrachter drängt sich dieser Spruch abermals auf die Lippen, wenn er sieht, wie dieser nur in Wollballen und Zolleinnahmen denkende Fürst – kein königlicher Kaufmann, sondern ein Krämerkönig – aus Mangel an Wagemut die große weltgeschichtliche Stunde verpaßt.
Die ersten Jahre seiner Regierung sind die Jahre, da Christoph Kolumbus die Fürsten Europas davon zu überzeugen sucht, daß man auf dem Wege nach Westen über den Ozean einen unmittelbaren Zugang zu den Reichtümern Indiens gewinnen könne. Sein Bruder Bartolomeo fährt nach London, um Heinrich VII. für das Projekt zu begeistern, das ihn zum Herrn über die Schätze der Welt machen würde. Aber der englische König zeigt sich taub. Monat um Monat vergeht, und als Bartolomeo dann endlich der fruchtlosen Verhandlungen überdrüssig wird und nach Sevilla zurückfährt, ist Christoph soeben mit der „Santa Maria“ und einem Schutzbrief des spanischen Königspaares in See gestochen, ist auf dem Wege zu den Reichtümern Indiens …
Wie sehr ist man versucht, sich vorzustellen, wie alles geworden wäre, wenn Heinrich VII. sich den Ideen des Kolumbus aufgeschlossen gezeigt hätte! Dann hätte die Neue Welt, die dieser fand, England gehört mit demselben Rechte, mit dem sie nun Spanien gehörte – mit dem Rechte dessen, der den Augenblick kühn zu nutzen weiß! Dann hätten die Gold- und Silberflotten in späteren Jahrzehnten ihren Weg nicht nach Sevilla genommen, sondern nach London, und niemand hätte England das Übergewicht im europäischen Handel streitig machen können. Aber den „wagenden Kaufleuten“ und ihrem König stand der Sinn nicht nach der Eroberung ungekannter Welten.
In Indien, soviel wussten sie, ist es sehr heiß – was sollen die Leute da mit englischer Wolle anfangen? Viel wichtiger war es doch, die flandrische Tuchindustrie zugunsten der englischen zu schwächen! Dass die Herzogin von Burgund einen Prätendenten auf den englischen Thron unterstützte, war ein guter Vorwand, die Ausfuhr englischer Wolle nach den Niederlanden zu verbieten, und als daraufhin die hansischen Kaufleute des Stalhofes ihrerseits die Flamen mit dem lebenswichtigen Rohstoff Wolle zu versorgen suchten, da war die Gelegenheit da, die Londoner Volksseele zum Kochen zu bringen und der lästigen Hanse endlich einmal die starke Hand zu zeigen. Helle Haufen Londoner Stadtpöbels, von den „wagenden Kaufleuten“ aufgeputscht, brachen in den Stalhof ein und verwüsteten seine Schreibstuben und seine Lagerräume, und wenn es auch den allzeit wehrhaften Deutschen gelang, die Eindringlinge wieder auf die Straße zu werfen, so fanden sie doch beim Könige kein Gehör, als sie um Sicherheit für die Zukunft baten. Im Gegenteil, der gekrönte Krämer nahm ihnen 20 000 Pfund Sterling ab, die verfallen sein sollten, wenn sie sich fürderhin noch unterfangen würden, von London aus Handel mit den Niederlanden zu treiben.
Das waren also die Sorgen des englischen Königs und seiner Kaufleute in den da Kolumbus dem spanischen Königspaar ein neues Weltreich gewann. Als dann allerdings die Nachricht nach England kam, dass die „Santa Maria“ wirklich über den Ozean bis nach Indien gelangt sei (es währte ja noch geraume Zeit, bis man erkannte, dass es nicht Indien war, sondern ein neuer Erdteil), da wurde auch in England der Appetit rege. Es waren die Kaufmannsgilden von Bristol, die sich bereit zeigten, die Gelder, die sie vor allem mit der Islandfischerei (und mit Plünderungen aus Island) verdient hatten, in einem etwas weiter ausschauenden Unternehmen anzulegen.
Zwei Umstände sind bei dieser ersten englischen Entdeckungsfahrt festzuhalten. Während nämlich Kolumbus durch sorgfältige geographische Berechnungen zu seiner Fahrt angeregt wurde und seine Kenntnisse auf der Höhe der Wissenschaft seiner Zeit standen, so dass also seine Entdeckungen wirklich die Frucht europäischer Gedankenarbeit waren, konnte davon bei den Leuten aus Bristol keine Rede sein. Was sie anlockte, waren die imaginären Wunderinseln „Brasilien“‚ und „Antillen“, die auf mittelalterlichen Weltkarten herumgeisterten, obwohl keines Menschen Auge sie je gesehen. Auch über ihre Lage gab es die widersprechendsten Angaben. Die englischen Schiffe fuhren also ins Blaue hinein. Und das zweite ist: England verfügte auch damals über keinen Seefahrer, dem man eine solche Aufgabe hätte anvertrauen können. Man war also genötigt, die Expedition einem Ausländer zu unterstellen, einem italienischen Kaufherrn und Seemann, in dem noch ein dem hansischen verwandter Geist lebendig war: Giovanni Caboto, dessen Name durch englische Zungen in „John Cabot“ umgemodelt wurde.
Dem solchermaßen von England annektierten Venezianer nun stellte Heinrich VII. einen Schutzbrief aus, der ihn ermächtigte, „nach Ost, West oder Nord zu segeln“, und „alle heidnischen Inseln, Länder, Gebete oder Provinzen in jedem Teile der Welt zu entdecken“. Planloser konnte wohl eine solche Fahrt nicht ins Werk gesetzt werden, und es ist nur der nautischen Sicherheit des vielbefahrenen Venezianers zu verdanken, wenn die fünf Schiffe aus Bristol nach einem Vierteljahr wohlbehalten in ihren Heimathafen zurückkehrten.
Die Wunderinseln hatten sie nicht gefunden, und fanden sie auch auf einer zweiten Fahrt zwei Jahre später (1498) nicht. Das Land aber, das sie beide Male sichteten und untersuchten – es war die nördliche Küste von Nordamerika, von Labrador bis Massachusetts -, blieb von den Engländern ungenutzt. Es gab da offenbar keine Leute, die englische Wolle tragen wollten, und auch die einheimischen Güter lohnten keinen Handelsverkehr.
Immerhin, der unfreiwillig anglisierte „John Cabot“ wurde zum Großadmiral ernannt und heimste auch sonst beträchtliche Ehren ein, Entdeckungen brachten ja nicht nur unter Umständen sehr wichtige Ansprüche mit sich, sondern galten in jener Zeit überhaupt als ein hoher Ruhmestitel. Nicht lange, und die Welt wurde mit Erzählungen und Abhandlungen überschüttet, aus denen unzweideutig hervorging, dass „der Engländer John Cabot“ Nordamerika „entdeckt“ habe. Dabei wurde aber – nicht aus Unkenntnis, sondern geflissentlich – die Tatsache unterschlagen, dass die gleichen Gebiete, die Cabot gesehen hatte, schon zwanzig Jahre zuvor von einer Gruppe portugiesischer Adliger, die sich norwegischer Seeleute bedient hatten, angesteuert worden waren: eine Tatsache, die in Bristol nachweislich bekannt war.
Hätte Heinrich VII. – wozu ihm der Weitblick fehlte – das von Cabot gefundene Land besiedeln lassen, so hätte sich England damit einen rechtmäßigen Platz unter den ersten großen Kolonialmächten gesichert. Aber England hat es damals nicht in Besitz genommen. Es begnügte sich mit dem billigen Ruhm der „Entdeckung“ – und dieser Ruhm war, wie wir sahen, erschlichen.
Wie es bei dem Aufkommen der Wollindustrie mit fremdem Kalbe pflügte, so schmückte es sich nun im Zeitalter der Entdeckungen mit fremden Federn.
Zum zweiten Male also, wo es sich um Welthandel, „Weltwirtschaft und Weltpolitik handelt, verpasste England den Anschluss. Damals, weil es auf Festlandseroberungen aus war, statt sich seiner Wirtschaft zu widmen; jetzt, weil es, statt mutig in die Welt zu ziehen, dem Goldenen Vlies nachjagte, den Reichtümern, die es durch seine Wolle einheimsen wollte.
Nicht kühnes Ausgreifen, sondern Finten und Schliche – das waren die Methoden, mit denen die City und ihr geistesverwandter König vorgingen. Heinrich VII. förderte den Schiffbau – aber nicht, um neue Wege zu suchen, sondern um eine Waffe gegen die Hanse zu haben; sein Ziel war, den Deutschen den englischen Tuchexport aus den Händen zu winden. Und was die Ausfuhr von Rohwolle nach Flandern betraf, so waren hier gewisse Einfuhrzölle lästig, die die Niederlande erhoben. Um diese Zölle zum Verschwinden zu bringen, verschmähte der engstirnig rechnende König kein Mittel, selbst nicht das des Menschenraubes.
Es begab sich nämlich, daß die Königin Isabella von Kastilien, die Herrin der Neuen Welt, zum Sterben kam und dass ihr der Mann ihrer Tochter, Herzog Philipp von Burgund, der „Schöne“ zubenannt, Kaiser Maximilians Sohn, auf den Thron folgen sollte. Der junge, allen ritterlichen Abenteuern zugeneigte Fürst befand sich in Flandern, als ihn die Botschaft vom Tode Isabellas traf. Entgegen manchen Warnungen beschloss er, der noch nie ein Schiff betreten hatte, die Reise nach Spanien zur See zu unternehmen – und es geschah, was die Warner vorhergesagt hatten: das Schiff geriet in einen Sturm und musste an der englischen Kanalküste, in der Bucht von Weymouth, vor Anker gehen. Wiederum ließen sich die Warner vernehmen: der englische König sei ränkesüchtig, man tue besser, den Boden seines Landes zu meiden. Der junge Fürst aber, des Wartens vor Anker überdrüssig, ging mit seinem Gefolge an Land und lud sich auf dem Schloss eines englischen Edelmannes, das nahe der Ankerstelle lag, zu Gast. Der Edelmann tat sehr geehrt und bewirtete den Fürsten aufs festlichste; als dieser aber am folgenden Tage, da der Wind sich gelegt halte, wieder aufbrechen wollte, hielt ihn der Wirt zurück: er könne unmöglich von dannen ziehen, ohne dem König seine Aufwartung zu machen; die Boten seien bereits unterwegs …
Wirklich dauerte es nicht lange, da kam ein Schwärm von Edelleuten angeritten und forderte den Herzog auf, sie nach Windsor zu begleiten, wo der König schon mit Freuden auf den hohen Gast warte. Und als man dann in Windsor angekommen war, zeigte sich die Freude des Königs so unbändig, dass er seinen Besuch gar nicht wieder entlassen mochte – jedenfalls nicht eher, als bis Philipp, Herzog von Burgund, König von Kastilien und Herr der Neuen Welt, einen Handelsvertrag unterzeichnet hatte, der die zollfreie Einfuhr englischer Wolle in die Niederlande zum Gegenstand hatte. Die große Welt geschichtliche Stunde hatte der Krämerkönig verpasst. Aber den kleinen Vorteil wusste er, wie wir an diesem Vorfall sehen, zu nutzen. Als Heinrich VII. im Jahre 1509 starb, folgte ihm sein recht unähnlicher Sohn Heinrich VIII., der in den letzten Jahren auch in Deutschland als der „König mit den sechs Frauen“, als der unverdrossene Hühnchenvertilger und Schürzenjäger eine unziemliche Popularität erlangt hat, weil ihn ein Film sich mundgerecht machte. So viel ist richtig: Heinrich VIII. war so verschwenderisch wie sein Vater geizig, so träumerisch versponnen wie jener erdennah, so leidenschaftlich wie jener kalt und rechnend. Dennoch trug auch Heinrich VIII. auf seine Art zur Hebung der englischen Tuchproduktion nicht Geringes bei, und zwar durch eben die Tat, mit der er sich in der Geschichte am bekanntesten gemacht hat: durch die englische „Reformation“ nämlich, die in Wahrheit keine religiöse Bewegung, sondern eine Enteignung der Kirche, vor allem der Klöster zum Besten des königlichen Säckels war. Und doch auch wieder nicht zum Besten des königlichen Säckels: denn Heinrich VIII. hielt das geraubte Gut nicht zusammen, sondern verschenkte das meiste davon wieder, wie es ihm die Laune eingab, an adlige Grundbesitzer und auch an reiche Tuchfabrikanten. Da wurde manche ehrwürdige Abtei in eine Werkstatt umgewandelt, die Refektorien standen voll surrender Webstühle, und an ihnen saßen die Bauern, die durch die neuen Herren von Haus und Hof vertrieben worden waren. Denn es konnte nun gar nicht genug Schafe und nicht genug Weideland geben.
„Der Fuß der Schafe macht Sand zu Gold“, so ging das Gerede; überall verschwanden die Äcker, für den Bauern war kein Platz mehr auf dem Lande. Ein wahrer Wollrausch hatte die führenden Schichten Englands erfasst. Eine allgemeine Landflucht hob an; die Leute brachten ihr Erspartes in die Stadt und legten es im Tuchhandel an. Während England sich derart vorbereitete, den Kontinent mit Tuchen zu überschwemmen und schon einer Krise der Überproduktion entgegensteuerte, verwirklichte der König die Absicht, um derentwillen er die „Reformation“ vom Zaune gebrochen hatte: er konnte nun seine angebetete Anne Boleyn zur Königin erheben. Die spätere Legende hat diese Frau, für die Heinrich seine rechtmäßige Gemahlin, Katharina von Aragon, des Kaisers leibliche Tante, verstieß, als ein liebreizendes, von den Lockungen des Thrones betörtes Hoffräulein geschildert. Schamhaft verschwiegen dagegen wurde ein anderer Umstand: dass Anne Boleyn in den engsten Beziehungen zu den Feinden der deutschen Hanse stand. War doch ihr Urgroßvater, Geoffrey Boleyn, einer von denen gewesen, die die Gesellschaft der „Wagenden Kaufleute“ gegründet hatten. Indem er sie ehelichte, heiratete also Heinrich recht eigentlich in die Tuchbranche hinein, und es ist kein Wunder, wenn die Tochter, die diesem Bunde entsprang, die spätere Königin Elisabeth, sich später als eine von Grund auf händlerische Natur erwies. Wie ihre ganze Sippschaft, so hatte auch Anne Boleyn einen neidischen Hass gegen die Deutschen des Stalhof es, und sie tat ihr möglichstes, die Stellung l der Hanse zu untergraben. Im Stalhof wusste man gut, mit wem man es zu tun hatte; die hansischen Kaufleute dort standen treu zum Kaiser, und sie empfanden die Verstoßung der Königin Katharina als einen Schimpf, der dem Reiche angetan war. Als sie daher genötigt wurden, für den Hochzeitszug der Anne Boleyn eine Festdekoration aufzubauen, ließen] sie es zwar an Aufwand und Pracht nicht mangeln, ja, aus der Quelle, die auf der von ihnen kunstreich dargestellten Landschaft des Parnass entsprang, strömte richtiger Rheinwein, von dem sich jedermann bedienen durfte. Aber oben auf dem Gipfel des Berges erhob sich, wie die Neugebackene Königin zu ihrem Verdruss feststellen musste, der kaiserliche Adler, der in seinen Fängen die Wappen von Kastilien und Aragon – die Wappen der verstoßenen Königin – trug …
Natürlich verlangte Anne Boleyn eine strenge Bestrafung der Übeltäter, und nur der Umstand, dass Heinrich den Kaiser fürchtete und auf gute Beziehungen zu den lutherischen Hansestädten Lübeck und Hamburg Wert legte, verhinderte die Schließung des Stalhofes. Es konnte aber nicht lange dauern, bis die Interessen des Wollhandels die englische Staatsführung zwangen, mit List und Gewalt neue Wege für den Export zu suchen und also auf die Bahn der großen Weltpolitik hinauszutreten. Sie blieb nur in den Bahnen, die die „Wagenden Kaufleute“ und der erste Tudorkönig vorgezeichnet hatten, wenn sie diesen Schritt in Form der scheinbar privaten, in Wahrheit aber staatlich organisierten, für Krone wie City durchaus einträglichen Seeräuberei tat.
Inzwischen war längst der Erdball, durch die Anstrengungen anderer Völker, um ein gutes Stück bekannter geworden. Die Portugiesen waren auf der Fahrt um Afrika herum nach Indien und zu den begehrten Gewürzinseln gelangt, hatten vielerorten Handelsniederlassungen gegründet und damit das von allen Mittelmeervölkern erstrebte Ziel erreicht, unter Umgehung der von dem Türkenreich in den Orient gelegten Sperre den unmittelbaren Verkehr mit den Ursprungsländern der Gewürze und der Seide aufzunehmen. Dann hatte(1519/20) der große Magalhäes den Süden Amerikas umfahren und war über den Stillen Ozean von Osten her an die Gewürzinseln gelangt.

König Heinrich VII. (1473-1509), der erste Herrscher aus dem Hause Tudor, schuf die Grundlagen der britischen Plutokratie, indem er, mehr Krämer als König, den Staat den Interessen der Geschäftswelt dienstbar machte.
Das Bild von der Beschaffenheit unserer Erde präzisierte sich immer mehr – und es zeigte sich immer deutlicher, wie gründlich England den Anschluss verpasst hatte. „Die Welt ist weggegeben …“
Was tun? Sich mit dieser Lage zu bescheiden, litt weder die englische Habsucht noch die politische Eifersucht noch die wirtschaftliche Lage der führenden Schichten; denn schon begannen die europäischen Länder sich gegen den Überfluss englischer Tuche zu wehren. Das Gespenst der Absatzkrise zog herauf. Es mussten also neue Märkte gefunden werden, und da lockten natürlich die Berichte von den dicht bevölkerten Landstrichen des östlichen Asiens. „Weil unser größter Wunsch dahin zielt, reichlichen Absatz für unsern Wollstoff zu finden“, so wurde damals geschrieben, „sind die mannigfachen Inseln Japans, die nördlichen Teile Chinas sowie die Gebiete der benachbarten Tataren die für uns tauglichsten Plätze.“ Aber wie sollte man die Wollstoffe an die Abnehmer heranbringen? Die Portugiesen gestatteten keiner anderen Nation, den von ihnen gefundenen Handelsweg zu benutzen – nach dem Recht, das ihnen durch päpstliche Bulle verliehen war und das sie darum als heiliges Recht wahrnahmen, aber auch nach dem natürlichen Recht dessen, der das Wagnis als erster unternommen und seine Haut dabei zu Markte getragen hat. Nach demselben Recht wachten auch die Spanier über ihrem durch den Papst verbrieften Handelsmonopol mit der Neuen Welt. Weder um das Kap der Guten Hoffnung noch durch die Magalhäesstraße führte also ein Weg, auf dem englische Wolle nach Ostasien hätte gelangen können.
Es gab zwei Mittel, dieser Verlegenheit abzuhelfen – ein redliches und ein unredliches. Beide wurden von den Engländern angewandt, das unredliche allerdings mit viel mehr Nachdruck, besonders dann, als es sich als das weitaus erfolgreichere für Englands Wirtschaft und Politik erwies.

König Heinrich VIII. (l 509-1547)Unter dem „König mit den sechs Frauen“ begann die Vernichtung des englischen Bauernstandes. Denn Heinrich VIII. verschenkte die eingezogenen Klostergüter an reiche Kaufleute, die das Ackerland in Weideland für Schafe verwandelten. – Gemälde von Hans Holbein d. J.
Das redliche Mittel war dieses: eine Zufahrt nach China zu suchen, die weder des Landweges bedurfte, noch den Spaniern oder den Portugiesen ins Gehege kam. Solch eine Zufahrt, so meinte man, musste entweder im äußersten Norden Asiens oder im äußersten Norden Amerikas zu finden sein. Mit der Suche nach der „Nordost-“ und der „Nordwest-Passage“ setzte nun also ein kurzes Zeitalter englischer Entdeckungsfahrten ein – Fahrten, denen keineswegs der gewünschte Erfolg beschieden war, wenn sie sich auch in anderer Hinsieht zum Teil als durchaus folgenreich erweisen sollten.
Von allen drei Schiffen nämlich, die von einer Aktiengesellschaft „zur Förderung des Handels mit China“ ausgerüstet wurden und im Mai 1553 in See stachen, um an der Nordküste Asiens entlang ihr Ziel zu erreichen, wurden zwei alsbald vom Eise abgetrieben, und ihre Bemannung fand an der lappländischen Küste den Tod. Das dritte hingegen gelangte zwar auch nur bis ins Weiße Meer, hier aber traf der Kapitän auf freundliche Fischer, die ihn wissen ließen, das Land gehöre dem Zaren in Moskau – worauf er sich beeilte, den Herrscher im Kreml aufzusuchen. Als er nach London zurückkehrte, brachte er ein Schreiben des Zaren Iwan IV. mit heim, in dem den englischen Kaufleuten „freie Stapelplätze und auch sonst alle Vergünstigungen“ zugesichert wurden.
Es war ein Geschenk des Zufalls, was den Engländern hier in den Schoß fiel. An China und Japan hatten sie gedacht, aber nicht an Russland. Keinem war es in den Sinn gekommen, dass hier doch wohl Abnehmer für englische Wolle zu finden sein würden – keinem auch der Umstand, der sich in der Folgezeit als äußerst bedeutsam erweisen sollte, dass nämlich Russland im Überfluss die Materialien zur Verfügung stellen konnte, deren man für den Schiffbau dringend bedurfte: Holz für den Schiffsrumpf und die Masten, Hanf für die Taue. Wäre jener Kapitän nicht zum Überwintern gezwungen worden, die „weit blickenden“ Herren von der City hätten den Posten Russland nie in ihre Rechnung eingestellt. So allerdings bildete sich also gleich eine „Russische Kompanie“ (mit einem Aktienkapital von über 10 Millionen Mark heutigen Wertes), die den Handel mit dem freundlichen Zaren in die Hand nahm und eifersüchtig darüber wachte, dass keine „Fremden“ sich zwischen sie und ihre Privilegien drängten.

Sir Francis Drake, von den Engländern als Seeheld und Entdecker gefeiert, hatte sich bei den Raubfahnen Hawkins‘ die Sporen verdient. Später fühne er die Seeräuberei in größerem Stile fort; besonders seine Weltumseglung, ein Raubzug auf die Westküsten Amerikas, warf für ihn und seine Geldgeber große Gewinne ab.
Die Gewinne dieses Unternehmens ließen sich recht erfreulich an, und so entschlossen sich die Hauptaktionäre, eine größere Summe für die Entdeckung der anderen, der nordwestlichen Passage zu riskieren Der Führer der drei hierfür entsandten Expeditionen (1576-1578), Martin Frobisher, gelangte in die noch heute nach ihm benannte Bucht in Baffinland (zwischen Labrador und Grönland), das er für Asien hielt. Außer einem Eskimo, den er hinterlistig und brutal entführt hatte, brachte er die Kunde von unermesslichen Goldschätzen mit, die er dort festgestellt haben wollte. So wurden bei seiner Rückkehr die City von London und die „jungfräuliche Königin“ von einem Goldrausch ergriffen, der allerdings nur von kurzer Dauer war. Denn als die nächste Expedition, der die Königin sogar dreißig Bergleute mitgegeben hatte, mit einer Ladung von 1300 Tonnen Erz heimkehrte, wurde auch nicht ein Gramm Gold entdeckt. Die Aktionäre einschließlich der Königin sahen von ihrem Gelde nichts wieder, und von den Durchfahrten nach China und Japan war von nun ab nicht mehr die Rede. Der Versuch, auf redliche Weise an der Erschließung der Welt teilzunehmen, hatte sich nicht als sehr ermutigend erwiesen. Um so bessere Erträgnisse versprach die unredliche Methode.
Originell war bis jetzt nichts gewesen, was die Engländer unternommen hatten; in allem, in Handel, Industrie, Schiff-Fahrt und Politik waren sie stets fremden Vorbildern gefolgt oder hatten fremde Hilfe in Anspruch genommen. So ist es nicht zu verwundern, dass auch das gewaltsame Vorgehen, das jetzt in den Vordergrund tritt – nämlich der Seeraub in fremden Kolonialgebieten -, keineswegs eine englische Erfindung ist. Auch als Piraten folgen die Engländer nur der Bahn, die eine andere Nation ihnen vorgezeichnet hat: mit dem einen Unterschied allerdings, dass diese andere Nation – die Franzosen nämlich – ihre Raubfahrten in die westindischen Besitzungen Spaniens und an die Küsten Mexikos während eines langen, erbitterten Krieges zwischen Frankreich und Spanien (1521 bis 1559) begonnen und weitergeführt hatten, die Engländer dagegen nicht nur mitten im Frieden, sondern sogar als Verbündete über das spanische Kolonialreich herfielen.

Sir John Hawkins, ein Seemann aus Plymouth, war der Begründer der beiden Hauptpfeiler, auf denen sich das britische Weltreich erhob: des Sklavenhandels und der Seeräuberei. Seinen Raubfahrten in das spanische Kolonialreich verdankte er seine Erhebung in den Ritterstand.
Wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe. Dass französische Freibeuter – kühne Seefahrer aus der Normandie zumeist – dem mexikanischen Goldhort nachstellten, den die spanischen Flotten nach Europa schaffen sollten, und auch manches Schatzbeladene Schiff erbeuteten, das war Kriegsbrauch. Als dann 1559 der Friede geschlossen war, hörte die französische Freibeuterei zwar immer noch nicht auf, aber Schiffe und Kapitäne, die jetzt auf die spanischen Goldschiffe Jagd machten, genossen nicht den Schutz des französischen Staates. Dieser und jener trieb auf private Rechnung Piraterie. Viele aber, die den Spaniern hart zu schaffen machten, gehörten der neu aufgekommenen Bewegung der Hugenotten an. Sie waren Fanatiker ihrer Vorstellung vom Reiche Gottes auf Erden, das, wenn nötig, mit Feuer und Schwert gegründet werden müsse; sie standen im Bunde mit den Gleichgesinnten in den Niederlanden, die sich eben jetzt gegen die spanische Herrschaft erhoben. Es verstand sich von selbst, daß ihnen der spanische Rechtsanspruch auf das Monopol des Handels und der Niederlassung in Amerika nichts galt. Denn diesen Anspruch hatte ja der Papst verbrieft, der nach ihrer Überzeugung der Antichrist selbst war.
Hätte England, wie es einer „protestantischen“ Nation gar nicht so fern gelegen hätte, auch seinerseits das spanische Besitzrecht an der Neuen Welt von vornherein angefochten, so hätte das natürlich den Ausbruch eines Krieges mit Spanien bedeutet; aber es wäre dann ein Kampf mit offenen Waffen gewesen. Solche Aufrichtigkeit lag nicht im Wesen der Königin Elisabeth und ihrer Berater. Sie hatten von Frankreich viel zu fürchten, da es die Schottenkönigin Maria Stuart in ihrem Kampf um den englischen Thron unterstützte; sie waren daher ängstlich auf korrekte, ja freundliche Beziehungen zu Spanien bedacht, und sie erklärten immer wieder aus freien Stücken, dass Spanien mit vollem Recht die Herrschaft über die Neue Welt ausübte. Trotzdem sannen sie darauf, wie sie sich in den Handel mit dem spanischen Kolonialreich eindrängen könnten.
Der Mann, der der Königin auf diesem Gebiete aussichtsreiche Vorschläge machen konnte, John Hawkins aus Plymouth, hatte die Verhältnisse in Westindien genauestens studiert. Er kannte die Ursachen, die den französischen Freibeutern so viele Erfolge gebracht hatten. Er wusste, dass die Spanier ihre besten Soldaten für die gewaltigen Züge in das Innere des südamerikanischen Kontinents einsetzen mussten, dass daher die Küstenstädte auf den Schutz der meist wenig kriegstüchtigen und wenig kampflustigen Bürgerwehren angewiesen waren, die aus den Handeltreibenden Ansiedlern gebildet wurden, und dass außerdem die spanische Verwaltungsmaschinerie überaus schwerfällig und langsam war. Auf diese Umstände gründete er seinen Plan.

Eine spanische Silberflotte wird von englischen Piraten geplündert Durch gemeine Raubüberfälle versuchten die Engländer den Vorsprung aufzuholen, den sich Spanien durch die Entdeckung Amerikas und seiner Silbergruben verschafft hatte. – Nach einem alten Holzschnitt.
Hawkins war kein Draufgänger gewöhnlichen Schlages. Er hatte weitgehende Kenntnisse, war energisch und umsichtig und hätte in einem Staate, der mannhafte Politik betrieb, sich sowohl diplomatischen als ehrlichen kriegerischen Ruhm erwerben können. Aber der englische Staat zog die Schleichwege vor, und so wurde Hawkins mit seinem Wagemut – denn den hatte er – ein von der Krone gewissermaßen konzessionierter Schmuggler und Bandit. So sehr drückt die englische Atmosphäre auch größer angelegte Naturen zum Kleinlichen und Gaunerhaften hinab.

William Hogarth, der große Sittenschilderer des 18. Jahrhunderts, hat hier unübertrefflich die verlogene englische Religiosität gezeichnet, die heilige Worte auf den Lippen führt und dabei sehr unheiligen Gedanken nachhängt. Theodor Fontäne hat das treffend formuliert: „Sie sagen Christus, und sie meinen Kattun.“
Wollstoffe waren, darüber war man sich im Klaren, in den tropischen Gebieten der Karibischen See beim besten Willen nicht abzusetzen. Man musste schon nach anderen Waren Umschau halten, um die spanischen Pflanzer zu beglücken. Der lukrativste Import nach Westindien, so legte Hawkins der Königin dar, war der von Negersklaven, für die auf den wachsenden Zuckerpflanzungen immer mehr Bedarf war. Allerdings gab es Neger nur in Afrika, und hier kontrollierten die Portugiesen den Handel. So musste man also bei ihnen einbrechen, um sich die Ware zu verschaffen, und dann bei den Spaniern, um sie loszuschlagen. Die Bedenken der vorsichtigen Königin, ob dieses doppelte Wagnis nicht zu gefährlich sei, entkräftete Hawkins mit der Versicherung, er habe Beziehungen zu gewissen portugiesischen und spanischen Kolonialbeamten angeknüpft.
Wirklich fand sich ein Syndikat von Kaufleuten und Beamten zusammen (auch der Schatzmeister der Admiralität war dabei), und Hawkins konnte im Oktober 1562 mit vier Schiffen von Plymouth aus in See gehen. Die Fahrt ging zunächst nach der Guinea-Küste, wo eine Fracht von 400 Negern eingeladen wurde, die Hawkins, wie er selbst berichtete, „teils mit dem Schwert, teils auf andere Weise“ erworben hatte – teils hatte er sie nämlich mit seinen Leuten selbst sozusagen auf freier Wildbahn gejagt, teils sie portugiesischen Sklavenhändlern durch Drohung und Bestechung abgenommen. Mit dieser lebenden Ware segelte er dann stracks nach Haiti, wo die spanischen Kolonialbehörden ihn einigermaßen verdutzt ankommen sahen. Erlaubnis zum Handeln hatte er nicht; aber da er höflich und umgänglich und außerdem gut bewaffnet war, hielten sie es für richtiger, ihm seine Ware abzunehmen, wenn auch nicht gegen bar, sondern im Austausch mit Häuten, Perlen und Zucker.

Grausamkeiten König Jakobs II. in Irland Im Jahre 1169 begann mit dem Einfall anglo-normannischer Ritter unter König Heinrich II. von England der lange Leidensweg des irischen Volkes. Unter Cromwell und den letzten Stuarts wurde ganz Irland erobert.- Stich des Holländers Peter Pickaert.
Als der liebenswürdige Erpresser nach England zurückkam, war ihm der Beifall der Königin gewiss. Sie nahm ihn offiziell in die Dienste der Krone, womit er das Recht hatte, fortab die königliche Standarte am Mast wehen zu lassen. Ja, sie steuerte zu seinen nächsten Schmuggelfahrten eins ihrer Kriegsschiffe bei – allerdings, wie es ihrer vorsichtigen Art entsprach, nur einen ausgedienten Veteranen, den völlig seeuntüchtigen „Jesus von Lübeck“, der denn Hawkins auch viel Kummer machte, bis ihm schließlich die Pfahlwürmer des Karibischen Meeres den Rest gaben und er in einem Augenblick, wo alles von ihm abhing, mitten entzwei barst.
Das war auf der dritten und letzten Expedition (1567), als Hawkins gerade wieder seine Neger verkauft und sich, die Schiffe beladen mit Zucker und Häuten, auf die Heimfahrt begeben wollte. Er wollte den „Jesus von Lübeck“ nicht aufgeben, da er den Unwillen der Königin fürchtete, und so ließ er sich von einem spanischen Kapitän einen Hafen empfehlen, wo er das wracke Schiff reparieren konnte. Es war ein Hafen an der mexikanischen Küste, San Jüan de Ulua, und zwar derjenige Hafen, an dem das Silber aus den mexikanischen Silbergruben nach Spanien verschifft wurde. Als Hawkins mit seinem invaliden Flaggschiff hier einlief, waren nur noch wenige Tage bis zur Ankunft der spanischen Transportflotte, die von gut armierten und bemannten Kriegsschiffen begleitet zu werden pflegte. So konnte es geschehen, dass die Leute von San Juan de Ulua Hawkins mit Salutschüssen und lautem Jubelgeschrei begrüßten. Als er dann aber vor Anker ging und sie eine unbekannte Flagge vom Mast wehen sahen, ergriff sie eine Panik; sie ließen die Geschütze im Stich und verbargen sich in den Kellern ihrer Häuser. Hawkins hatte also leichtes Spiel, als er nun an Land ging und die Batterien besetzte. Zwei Tage war er Herr des Hafens und seiner Geschütze – nicht lange genug, um den „Jesus von Lübeck“ zu flicken -, dann erschien wirklich die spanische Flotte an Bord ihres Admiralsschiffes der Neuernannte Vizekönig von Mexiko, Don Martin Enriquez. Der machte große Augen, als ein englischer Bote vor ihm erschien und ihm mitteilte, unter welchen Bedingungen der englische Admiral bereit sei, die spanische Flotte in den spanischen Hafen einzulassen: Geiseln sollten ausgetauscht werden, kein bewaffneter Spanier dürfe an Land kommen, und Hawkins wolle über die Batterien so lange verfügen, bis seine Schiffe wieder seetüchtig und seine Leute mit allem Nötigen versorgt seien … Verständnis für die Empfindungen anderer Völker ist nie Englands starke Seite gewesen, und so hatte Hawkins denn auch jetzt einen Posten in seine Rechnung einzustellen vergessen: den angeborenen Stolz des Spaniers. Für Don Martin war dieser unverschämte Eindringling nichts als ein Korsar, trotz seiner Königsstandarte, und so verfuhr der tief gekränkte Mann denn mit Hawkins, wie man mit Seeräubern verfährt. Und hatte Hawkins nicht wirklich das Recht verwirkt, als ritterlicher und ehrlicher Mann behandelt zu werden? So ging denn der Vizekönig zum Schein auf die Bedingungen des Engländers ein. Auf ein verabredetes Zeichen aber stürmten die spanischen Matrosen und Soldaten die englischen Schiffe und überfielen die Geschützbesatzungen am Lande. Der „Jesus von Lübeck“ musste endgültig aufgegeben werden, andere Schiffe steckten die Spanier in Brand, und nur zwei konnte Hawkins mit Mühe und Not retten. Das eine davon war die 50-Tonnen-Bark „Judith“, auf der ein gewisser Francis Drake kommandierte, Hawkins‘ gelehrigster Schüler und bald darauf sein würdiger Nachfolger.
Das war also das Ende der englischen Bemühungen, die Spanier auf sozusagen gütlichem Wege zur Zulassung englischen Handels in Westindien zu bewegen. In London war man höchlich entrüstet, als das Geschehene bekannt wurde. Man hatte Philipp von Spanien helfen wollen, den Handel seiner Kolonien auszuweiten – und das war der Dank!
Hawkins schäumte vor Rachedurst und drängte die Königin, ihn zu Repressalien zu ermächtigen. Doch Elisabeth scheute vor dem offenen Kampf zurück; sie ging, als echte Enkelin der „wagenden Kaufleute“, den Weg des geringsten Risikos. Der spanische König sollte es schon zu fühlen bekommen, was es hieß, die englische Freundschaft ausgeschlagen zu haben…
Die guten Beziehungen zu Spanien zu erhalten, so erklärte Elisabeth, liege ihr mehr als alles andere am Herzen. Es war daher nur eine vorsorgliche Maßnahme, die König Philipp vor Schaden bewahren sollte, wenn sie jetzt, kurz nach den Ereignissen von San Juan de Ulua, eine ihm gehörige Ladung von Goldbarren zu treuen Händen in Verwahrsam nahm. Diese Goldbarren nämlich waren dem spanischen König von Genueser Banken bis zur Ankunft der nächsten Schatzflotte aus Amerika vorgestreckt worden, da er für seine gegen die aufständischen Niederlande kämpfenden Truppen schnell Geld brauchte. Hugenottische Freibeuter, Gleichgesinnte Verbündete der Niederländer, hatten die Goldschiffe aufgebracht und sie genötigt, an der englischen Kanalküste Schutz zu suchen.

Irisches Elend Im Jahre 1845 zählte Irland über 8 Millionen Einwohner – heute nur noch 4,3 Millionen! Die Entvölkerung war eine Folge der durch die englische Selbstsucht verursachten Hungersnöte – die furchtbarste um 1850 – sowie der dadurch verursachten Massenauswanderungen. – Aus der Pariser „Illustration“ von 1854.
Dass Elisabeth die kostbare Fracht daraufhin sogleich im Tower von London deponieren ließ, geschah nur, um sie vor den Seeräubern zu bewahren. Unverzeihlich, dass König Philipp diese so wohlgemeinte Handlung als einen Raub an seinem Eigentum ansah und daraufhin die Warenlager englischer Kaufleute in Spanien beschlagnahmen ließ!
In Wirklichkeit konnte Elisabeth nichts willkommener sein als dieser Goldschatz. Ihr verschwenderischer Vater, Heinrich VIII., hatte eine gewaltige Last von Schulden hinterlassen, und es war der Königin trotz aller Knauserigkeit bis jetzt nicht gelungen, sie abzudecken; denn knauserig waren auch die Grundbesitzer und Kaufleute, die im Parlament saßen und ohne deren Zustimmung die Königin keine Abgaben erheben durfte. Da brachte König Philipps Gold die Rettung aus der Not. Ja, sie konnte es sich sogar leisten, großzügig zu sein und den Genueser Bankiers Zinsen für diese unfreiwillige Anleihe zu zahlen. Wer konnte ihr nun noch vorwerfen, dass sie nicht korrekt verfahren sei? Es war doch niemand geschädigt; die Genueser bekamen ihre Zinsen, und König Philipp konnte sich von ihnen anderes Gold leihen…
Doch es half nichts; am spanischen Hofe durchschaute man das englische Spiel und zog die offene Gegnerschaft der verlogenen Freundschaft vor. Den englischen Kaufleuten blieb der Handel mit Spanien und den spanischen Niederlanden untersagt. Der Vorteil der Königin war diesmal auf Kosten der Kaufleute erreicht worden, und man musste sehen, wie man die Verluste wieder aufholte.

Das Gemetzel im Phönixpark zu Dublin Die Antwort auf die systematische Aushungerung des irischen Volkes durch die britische Plutokratie war Gründung des Bundes der „Fenier“, dessen Anhänger bei einer Versammlung im Juli 1871 von der englischen Polizei zersprengt wurden. 200 Verwundete waren das Opfer dieses brutalen Vorgehens. – Aus „Le Monde Illustre“ (1871)
In dieser Situation gab es, darüber waren sich Königin und City klar, nur einen Ausweg: man musste die Seeräuberei auf eine breite finanzielle Basis stellen. Wenn es mit dem ehrlichen Handel nicht ging, musste der unehrliche und gewaltsame die Säckel der Londoner Kaufleute füllen – und dass der Säckel der Königin dabei nicht zu kurz kam, dafür sorgte ihr ererbtes Krämerblut.
„Die Zeit der Überfälle auf den spanischen Handel ist von größter Bedeutung für das Wachsen der englischen Macht gewesen“, schreibt der englische Historiker William Robert Scott mit dem beinahe erfrischenden Zynismus, der englischen Historikern eigen ist, wenn sie von dem Aufstieg Englands zur Weltmacht sprechen. Es ist allerdings ein Grundgelehrtes, nur für Fachleute bestimmtes Werk, in dem dieser Satz vorkommt. In Büchern, die für die breite Öffentlichkeit und für die Stimmungsmache im Ausland geschrieben sind, klingt es anders. Da wird einer gläubigen Welt suggeriert, die elisabethanischen Piraten seien kühne Einzelgänger gewesen, die aus loderndem Hass gegen alles, was dem Papste anhing, und aus glühender Liebe von der „Solidarität der protestantischen Volker zu ihrem Vaterlande Heldentaten über Heldentaten verrichtet hätten ohne rechte Unterstützung durch die vorsichtige und korrekte Königin.
Halten wir also einige Tatsachen fest, die das Gesicht dieser „Überfälle auf den spanischen Handel“ erkennen lassen. Zunächst einmal: die Piratenfahrten der Drake und Raleigh waren nicht Raubzüge auf eigene Faust, sondern wohlorganisierte, von langer Hand vorbereitete Unternehmungen, für die die Mittel jedes Mal durch eine Gesellschaft von Aktionären zusammengebracht wurden. Zu diesen Aktionären gehörten die Königin, ihre führenden Minister und Günstlinge (also Männer wie William Cecil, der spätertere Lord Burghley, und der Graf von Leicester, und schließlich die Kreise der City. „Wenn die Schiffe zurückkehrten und die Beute verkauft war, Überschuss verteilt und das ganze Geschäft liquidiert“ (Scott). Zum zweiten: Es herrschte weder Kriegszustand mit Spanien noch auch nur ein heimlicher Konflikt zwischen beiden Mächten, so dass keinerlei Anlass für diese bestand. Die Leidenschaft, der Abscheu gegen den „Papismus“ vor allem, war künstlich genährt wie -man denn überhaupt damals die Zugkraft der Parole von der „Solidarität der protestantischen Völker“ entdeckte, um die skrupellose, nur der Gewinnsucht entspringende Piraterie der eigenen Leute mit der aus fanatischem Glaubenseifer entspringenden Freibeuterei der Hugenotten und der holländischen „Wassergeusen“ im Urteil der Mitwelt und Nachwelt auf eine Stufe stellen zu können.

Irland am Kreuz Das gemarterte Irland, um das sich die Schatten verhungerter Frauen und Kinder sammeln, spricht: „0 Gott, den ich so lange vergebens angefleht habe – solltest du ein Engländer geworden sein?“ – Aus der französischen Wochenschrift „Le Rire“ von 1899
Gewiss gab es im damaligen England auch Leute, die den Angriff auf das katholische Weltreich Spaniens für ein Gott wohlgefälliges Werk hielten. In den Massen des kleinen städtischen Bürgertums, das von den Raubzügen keinen unmittelbaren Vorteil hatte, aber die Rückschläge des Handels in Gestalt von Knappheit und Teuerung am eigenen Leibe erlebte, fanden die Hasspredigten gegen den König in Madrid, der mit allen erdenklichen biblischen Ungeheuern verglichen wurde, offene Ohren. Hier sympathisierte man wirklich mit den Hugenotten und den Geuusen, die ja der gleichen Gesellschaftsschicht angehörten. Hier fanden sich die Menschen, die bereit waren, im Kampfe gegen „Gog und Magog“ oder wie die bösen Feinde des wahren Glaubens sonst genannt wurden, ihre Haut zu Markte zu tragen und alles zu vergessen, was ihnen an christlicher Gesittung anerzogen war.
Damals nämlich bildeten sich die Grundzüge des englischen Nationalcharakters: die Selbstgerechtigkeit und der mit ihr so eng zusammenhängende „Cant“. Denn da die Überzeugung, daß im Kampfe gegen Spanien, dieses gewissermaßen Volkgewordene böse Prinzip, jedes Mittel erlaubt sei, in ihrer praktischen Auswirkung zum Aufblühen der englischen Wirtschaft führte, so war es kein großer Schritt bis zu der nächsten Überzeugung: dass die Raubüberfälle im Einklang mit dem Willen Gottes stünden und daß England von Gott das Privileg erhalten habe, sich über die das Völkerleben regelnden Gebote immer dann hinwegzusetzen, wenn das Gedeihen seines Handels es erforderte. Denn wie hätte Gott sonst den Erfolg der englischen Freibeuterei dulden können? Ergo: Was England tut, ist wohlgetan.
Während aber in Holland ein ganzes Volk sich gegen seinen spanischen Oberherrn, in Frankreich eine breite Schicht des Volkes sich gegen die alten Gewalten im Staat empörte – während also Geusen und Hugenotten in radikaler Unbedingtheit um Sein oder Nichtsein kämpften, handelten die englischen „Seehelden“ ganz im Einvernehmen mit der Führung ihres Staates. Wohl haben die einzelnen, Drake oder Raleigh und ihre Mannschaften, Erstaunliches geleistet und weder Leben noch Gesundheit geschont. Aber diesen Mut hat auch der Gangster. Was einem Kampf erst das Heroische verleiht, ist, dass er mit vollem Bewusstsein um „Alles oder Nichts“ geht, um eine höhere Form des Daseins für die Gemeinschaft, in der man kämpft. Dieses Element des Heroischen, dieses Wissen um die tiefste weltgeschichtliche Bedeutung von Sieg oder Untergang fehlte dem englischen Kampf gegen Spanien durchaus. Die Technik des Freibeutertums und den Glaubensfanatismus – beides hatte man von anderen abgeguckt. Und weil beides nicht aus ursprünglicher Leidenschaft, sondern aus listiger Berechnung kam, ist auch die Begründung der Seeräuberei aus dem „protestantischen Glauben“ etwas innerlich Unwahres. Keine elementare Not zwang England, Spanien zu überfallen, sondern eine kaufmännische Kalkulation ließ es als empfehlenswert erscheinen, und so ist von Anbeginn an die englische Weltmachtpolitik mit dem Fluch der Scheinheiligkeit und Verlogenheit behaftet: für die Verfolgung ihrer rein geschäftlichen Ziele schiebt sie die Bibel vor. Und das tut sie von Elisabeths Zeiten bis auf den heutigen Tag. Bei anderen Völkern hat es diese üble Verquickung unredlicher Politik mit Worten des Glaubens nie gegeben. Das Wort „cant“, das die politische Scheinheiligkeit des Engländers bezeichnet, ist daher auch nicht in andere Sprachen übersetzbar.
Das Wort Seeräuberei (mit seinem ein wenig romantischen Beigeschmack) erweckt noch nicht die zutreffende Vorstellung von den Aktionen, die Drake und die anderen Freibeuter auf Aktien in den siebziger und achtziger Jahren des sechzehnten Jahrhunderts unternahmen. Denn Seeraub, Kaperung spanischer Handelsschiffe also, war nur die eine ihrer Formen. Da nämlich ihr Hauptzweck, die Erbeutung amerikanischer Edelmetalle, nicht immer zur See erreicht werden konnte (die spanischen Schatzflotten fuhren in Abständen von vielen Monaten), so handelten die „Seehelden“ ganz im Sinne ihrer Königin, wenn sie den Schauplatz ihrer Taten gegebenenfalls auch auf das Land verlegten.
Straßenräuber, Wegelagerer – das klingt nicht so vornehm wie Seeheld und auch nicht so romantisch wie Seeräuber. Aber es ist keine Übertreibung, sondere nur eine nüchterne Feststellung, wenn man sagt, dass Drake und seinesgleichen solche anrüchigen Gewerbe betrieben haben. Denn das hatte die Welt noch nicht gesehen: dass ein Staat gegen einen anderen befreundeten Staat hinterrücks Raubzüge organisierte – zu keinem anderen Zweck als dem, das eigene Vermögen auf Kosten des anderen zu vermehren. Schon auf seiner zweiten Expedition (1572-157.) ging Drake zur Wegelagerei über. Das Edelmetall in den Bergwerken von Peru, das wusste er, wurde mit Maultieren von Panama über die Landenge nach dem Hafen Nombre de Dios an der Karibischen See bracht. Auf der Landenge hauste ein böser Menschenschlag: die „Cimaroonen“, entlaufene Neger, die mit Indianerfrauen in die tropischen Wälder geflüchtet hatten und hier von Raubüberfällen auf spanisch Niederlassungen und Warentransporte lebten. Mit diesen verkommenen

Der Untergang der Armada
Die große spanische Flotte, die Philipp II. ausgesandt hatte, um England für die Raubüberfälle auf das spanische Kolonialreich zu strafen, wurde 1588 bei Gravelines an der flandrischen Küste von der beweglicheren englischen Kriegsmarine zurückgeschlagen – ein Sieg, in dem England die göttliche Rechtfertigung seiner Räubermethoden sah.
Urwaldräubern machte Drake gemeinsame Sache.
Sie dienten ihm als Führer und Spione, und mit ihrer Hilfe gelang ihm denn auch nach einigen vergeblichen Versuchen die Überrumpelung eines Zuges von hundertundachtzig gold- und silberbeladenen Maultieren. Hunderttausend spanische Goldpesos (nach heutigem Werte etwa 10 Millionen Mark) waren die Beute dieses ersten Straßenraubes.
Auch die berühmteste von allen Fahrten Drakes, seine Weltumseglung (1578 – 80), war eine Raubfahrt. Das Konsortium von Aktionären, das ein beträchtliches Kapital in dieses Unternehmen investiert hatte, war nicht gesonnen, sich mit neuen

Das Flaggschiff der Holländischen Westindien-Gesellschaft
Die Rührigkeit der niederländischen Seefahrer, die ihrem Vaterlande ein stattliches Kolonialreich erworben hatten, war der neidischen britischen Plutokratie ein Dorn im Auge. – Gemälde von Wittern van der Velde.
geographischen Erkenntnissen als Ertrag zu begnügen, sondern erwartete reiche Beute. Den Unterführern und der Mannschaft gegenüber allerdings wurde die Expedition als eine Forschungsreise ausgegeben, mit dem Ziel der Entdeckung eines neuen Erdteils, den man im Süden suchte, der „Australis“. Drakes Instruktion aber lautete dahin, er solle durch die Magalhäesstraße in den Stillen Ozean vorstoßen und, an der Westküste Südamerikas nördlich hinaufsegelnd, Peru zu erreichen suchen. Also auch hier war der Griff nach den spanischen Gold- und Silberschätzen das Hauptmotiv – in zweiter Linie kam erst das andere, daß es Drake vielleicht gelingen könne, die „Nordwestpassage“ von der amerikanischen Küste her zu erreichen und damit der englischen Wolle doch noch den Weg nach China und Japan zu bahnen. Drake fand die Nordwestpassage so wenig wie den sagenhaften „australischen“ Kontinent, wenn es ihm auch, als beiläufiges Ergebnis seiner Raubfahrt, gelang herauszufinden, daß der Atlantische und der Stille Ozean an der Südspitze Amerikas ineinander fließen. Von den Plünderungszügen an den Küsten Chiles und Perus hingegen brachte er auf seiner „Goldenen Hirschkuh“ überreiche Beute heim. Die Dividende für das eingezahlte Kapital wurde, als man dann zu Hause die Schätze überblicken konnte, auf 4700 v. H. festgesetzt, und daher murrte keiner der Aktionäre darüber, dass sowohl Drakes als der Königin Anteil noch beträchtlich höher ausfielen. Die Spanier schätzten ihren Verlust auf 2 Millionen Pfund Sterling, und selbst wenn wir den englischen Angaben folgen, waren es immer noch anderthalb Millionen das sind etwa 360 Millionen Mark heutigen Wertes.
Kein Wunder also, dass diese „Entdeckungsfahrt“ es der Königin Elisabeth ermöglichte, als Finanzier großen Stiles aufzutreten. Sie beteiligte sich mit einem Kapital von 10 Millionen Mark (heutigen Wertes) an der Gründung der „Levante-Kompanie“, die den Handel mit den türkischen Gebieten im östlichen Mittelmeer auf breiter Basis in Angriff nahm. Wie die Praktiken ihres Großvaters es ermöglicht hatten, daß England die Hanse aus dem Nord- und Ostseehandel verdrängte, so stieß also nun Elisabeth in die Bezirke des Vorderen Orients vor, wo bisher die Mittelmeervölker – Spanier und Italiener, besonders Venezianer und Genuesen – den Handel in der Hand gehabt hatten. Es ist gut zu verstehen, dass die englischen Eindringlinge hier recht unwillkommen waren, und dass vor allem die Spanier es ungern mit ansahen, wie hier ein anderer mit geraubtem spanischem Gold sich als Wettbewerber einschlich. Nicht lange, und es wurden zwischen Madrid und Venedig Beratungen gepflogen, die dahin zielten, die Meerenge von Gibraltar für englische Schiffe zu sperren – Beratungen, die in London nicht geringe Besorgnis hervorrufen mussten. Denn der Levantehandel, vor allem der Korinthenhandel, ließ sich schon in den ersten Jahren recht erfolgreich an.
Nein, um der Korinthen willen musste die Straße von Gibraltar für englische Schiffe offen bleiben. Ein Jahrhundert später, und England wird, um der Korinthen willen, den Felsen von Gibraltar rauben…
Drakes Raubzüge zwangen König Philipp II., seine ganze Aufmerksamkeit den Vorgängen am Ärmelkanal zuzuwenden, und er griff zu Gegenmaßnahmen. Eine Zeitlang versuchte er, mit einer Flotte den Kanal zu blockieren und die Kontrolle über die Ausfahrt englischer Schiffe nach Amerika zu erzwingen. Er hielt auch Umschau nach Stützpunkten, von denen aus es seiner Marine möglich würde, die Raubfahrten (über deren Organisation er durch seine Botschafter nur zu gut informiert war) zu unterbinden. Und da bot sich ihm die Insel im Westen Britanniens dar – Irland, dessen Volk, der alten katholischen Religion getreu, unter der englischen Fremdherrschaft seufzte. Wie freudig hätten ihn die Iren als Befreier begrüßt – und wie wenig Grund hätte England gehabt, sich über einen Eingriff in seine Rechte zu beklagen! Denn mit welchem Recht nahm England die Herrschaft über die Grüne Insel in Anspruch? Man kann noch nicht einmal sagen: mit dem Recht des Eroberers. Auch ein solcher muss sein Recht erst dadurch ausweisen, dass er Frieden und neue Ordnung in dem eroberten Lande schafft, ihm das Gesetz einer überlegenen Kultur aufprägt. So waren einst deutsche Fürsten und Ordensritter in die slawischen Lande östlich der Elbe gezogen und hatten sie höheren Lebensformen gewonnen. Mit solcher echten Kolonisation hatte Englands Vorgehen in Irland nicht die mindeste Ähnlichkeit gehabt. Irland war ja auch, als die Engländer kamen, keineswegs ein Land tieferer Kulturstufe gewesen – im Gegenteil, es hatte durch seine Mönche voreinst den Grund zu einer gemeinsamen abendländischen Kultur legen helfen. Die englischen Barone, die seit König Heinrich II. (1171) sich auf der Grünen Insel einnisteten, waren den irischen Stammesführern weder an politischer Gestaltungskraft noch an geistiger Bildung überlegen, sie hatten nur den einen Vorteil, daß hinter ihnen ein starkes, einheitliches Königtum stand, während es dem irischen Volk versagt geblieben ist,seine schöpferischen geistigen Kräfte in staatliche Einheit zu sammeln.

Die Erfolge der Portugiesen und Holländer im Indienhandel weckten in England das Verlangen, sich gleichfalls an der Ausbeutung Indiens zu beteiligen. 1599 wurde die Ostindien-Kompanie gegründet. – Nach einem alten niederländischen Stich.
Wenn Elisabeths Vater, Heinrich VIII., einen Schritt weiter ging als seine Vorgänger und sich 1541 zum „König von Irland“ erheben ließ (die ihn dazu hoben, waren nicht die Iren, sondern die englischen Barone von Dublin), so geschah das nur, damit er einen Rechtstitel darauf hatte, als „Reformator“ die Güter der irischen Klöster zugunsten seines Staattssäckels einzuziehen. Irgendetwas, das einer Regierung, einer Gestaltung des Volkslebens ähnlich gesehen hätte, haben auch die Tudorkönige nicht in Irland eingeführt. Es ging, wie immer, nur um Landbesitz, und gegenüber den Zugriffen englischer Adliger, Kronbeamter und Juristen blieben die irischen Bauern wehrlos wie bisher. „Nichts, was gegen einen Iren verübt wird, kann Verbrechen genannt werden; denn ein Ire ist rechtlos“ – das war der Grundsatz, nach dem England in Irland „Kolonisation“ trieb. Die Eingeborenen der Grünen Insel galten dem hochmütigen „Herrenvolk“ der Engländer nicht mehr als etwa die Negersklaven, die Hawkins nach Westindien einschmuggelte. Sie wurden erbarmungslos misshandelt und ausgeplündert, dem Hunger und der Verzweiflung preisgegeben damals wie Jahrhunderte hindurch bis heute.
Und ein so gequältes Volk sollte nicht das Recht gehabt haben, um seiner Selbstbehauptung willen zu den Waffen zu greifen? Auch dass die Iren Hilfe bei Spanien suchten, ist nur zu begreiflich, denn aus Eigenem waren sie nicht stark genug, um auf einen Erfolg hoffen zu dürfen.
Wenn König Philipp nun die Iren zum Aufstand ermutigte und sie mit Geld und Waffen unterstützte, so tat er es nicht deshalb, weil er England mit Gewalt wieder katholisch machen wollte, sondern weil es ihm darauf ankam, die englische Seeräuberei in Amerika zu verhindern. Mit dem befreiten Irland als Bundesgenossen gedachte er, Elisabeth in ihre Schranken zurückweisen zu können. Es war die Überlegung eines Staatsmanns, an der niemand etwas Unredliches wird finden können. Dass allerdings die Aufstände der irischen Stammesführer allesamt misslangen und in grausamer Niedermetzlung von irischen Frauen und Kindern durch die englische Soldateska ihr fürchterliches Ende fanden, hat seinen Grund in der Langsamkeit und Kraftlosigkeit, mit der die Erwägungen des spanischen Königs in die Tat umgesetzt wurden.

Ein Privilegienbrief der Ostindien-Kompanie 1698 erneuerte König Wilhelm III. von England, aus dem Hause Oranien, die Privilegien der Ostindien-Kompanie, zu deren Aktionären außer der Londoner Kaufmannschaft auch viele Mitglieder des Hochadels zählten
Dieselbe Schwerfälligkeit war auch der Fluch, der über der einzigen großen Anstrengung lastete, die Spanien unternahm, um die Bedrohung seines Kolonialreiches aus der Welt zu schaffen: der Entsendung der Großen Armada (1588). Auch hier hat die tendenziöse englische Geschichtsschreibung ein verzerrtes Bild geliefert, das von vielen als echt übernommen wurde. Sie hat es so dargestellt, als habe Philipp die Armada entsandt, um die Hinrichtung der katholischen Maria Stuart (1587) zu rächen. Philipp als der hartnäckige Friedensstörer, das fromme protestantische England in der Defensive- so soll es nach englischem Wunsche aussehen. Aber die Wirklichkeit war anders. Spanien hatte damals noch echte Seehelden; die Männer, die die türkische Macht im Mittelmeer in der gewaltigen Seeschlacht von Lepanto (1570) gebrochen hatten, drängten schon lange den König zum Handeln. Sie glaubten, „den Tag nicht mehr erwarten zu können, wo man den angelsächsischen Piraten das Handwerk gründlich legen und der spanischen Nationalschande der stillschweigend ertragenen elisabethanischen Herausforderungen mit Feuer und Schwert ein Ende bereiten wird“ (L. Pfandl). Philipp hat lange versucht, durch gütliche Verhandlungen eine Bereinigung der Atmosphäre zu erreichen. Erst als dann, mitten in den Unterhandlungen, die Nachricht von einer neuen Raubexpedition Drakes nach Kuba und Florida eintraf – erst dann hat er sich für den Krieg entschieden. Im März 1586 begann er, die Armada auszurüsten.
Man kann den Engländern nicht nachsagen, dass sie es lieben, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. Nach ihrem Siege über die Armada aber verlegten sie sich auf die Demut und Bescheidenheit.
Die Medaille, die Elisabeth prägen ließ, erhielt die Umschrift: „Afflavit Deus, et dissipati sunt“ (Gott blies, und sie wurden zerstreut). Warum diese Berufung auf den Allmächtigen? In Wirklichkeit ist der Untergang der Armada der Rückständigkeit des spanischen Schiffbaus, der mangelhaften Organisation des Nachschubs, der schlechten Zusammenarbeit mit dem Landheere in den Niederlanden und der Unfähigkeit des Oberbefehlshabers einerseits, der nautischen und taktischen Überlegenheit der Engländer und der unbezweifelbaren Tüchtigkeit ihrer Führer, besonders Drakes, zuzuschreiben. Sie bestimmten das Gesetz des Handelns, und sie waren es, die durch geschickte Ausnutzung von Brandern die Auflösung der spanischen Flotte auf der Höhe von Gravelingen erreicht haben. „Als Wind und Wellen die Endkatastrophe herbeiführten, da trafen diese eine schon geschlagene, zermürbte, wehrlose, eine fliehende Flotte, die auch ohne Stürme keinen Schaden mehr angerichtet hätte“ (L. Pfandl).
Von Höchstädt bis Waterloo gibt es viele Schlachten, an deren Gewinn sich England ungerechterweise das Verdienst zumisst. Hier, wo es ihm nicht streitig gemacht werden kann, hält es sich mit frommem Augenaufschlag zurück. „Gott blies …“ England verzichtet auf den Ruhm und schreibt ihn allein dem Allmächtigen zu. Und warum hat dieser die angeblich so ausschlaggebenden Naturgewalten mobilisiert? Die Antwort versteht sich von selbst: er wollte ein Wunder wirken und dadurch der Menschheit beweisen, dass Englands Sache die ihm wohlgefällige sei. Zwar galt in damaliger Zeit jede kriegerische Entscheidung als ein Urteil, das Gott über Recht und Unrecht der Kämpfenden fällte, und so hätte es schon genügt, wenn Elisabeth darauf verwiesen hätte, dass Gott sich im Siege der englischen Waffen ausgesprochen habe. Aber um wie viel eindrucksvoller musste es sein, wenn man der Welt den gewaltigen Kontrast vor Augen stellte: auf der einen Seite das stolze, unbesiegliche Spanien, auf der anderen das kleine, wehrlose England, das aus eigener Kraft niemals würde haben siegen können, wenn Gott nicht durch ein Wunder die Gewichte auf der Waage verschoben hätte! Wie unendlich viel besser musste die Sache Englands sein, wenn Gott es solchen Wunders für würdig befand!
Es kommt auch heute wohl bisweilen vor, dass eine Gangsterbande im Kampf mit der Polizei die Oberhand behält. Trotzdem würde jedermann lachen, wenn der Gangsterhäuptling daraus die Folgerung ziehen würde, er sei durch diesen Ausgang des Gefechts als rechtschaffener Hüter der Ordnung bezeugt, die Unterlegenen jedoch als Verbrecher. Als aber England im Falle der Armada es ebenso machte, erhob sich in der Welt seltsamerweise kein Gelächter. Ja, wie sehr dieser geniale propagandistische Trick noch in späteren Jahrhunderten und auch in Deutschland Erfolg gehabt hat, können wir etwa bei Schiller sehen, der in seinem Gedicht „Die unüberwindliche Flotte“ ganz unbefangen den englischen Standpunkt sich zu eigen gemacht hat. Ihm galt, wie später dem liberalen Bürgertum, England so recht als das Land der Freiheit: „Dir drohen diese Gallionenheere, Großherzige Britannia! Weh deinem Freigebornen Volke!“ Niemand, der die „feuerwerfenden Kolosse“ der Armada herankommen sieht, zweifelt, dass sie England den Untergang in der Knechtschaft bringen werden. Da hat der Allmächtige ein Einsehen:
„Soll, sprach er, soll mein Albion vergehen, Erlöschen meiner Helden Stamm, Der Unterdrückung letzter Felsendamm Zusammenstürzen, die Tyrannenwehre vernichtet sein von dieser Hemisphäre? Nie, rief er, soll der Freiheit Paradies. Der Menschenwürde starker Schirm verschwinden! Gott, der Allmächtige, blies, Und die Armada flog nach allen Winden.“ Die „Tyrannenwehre“, „der Freiheit Paradies“, „der Menschenwürde starker Schirm“ – das Jahrhundert der Aufklärung, dessen Sprache der junge Schiller hier noch spricht, hat England sein religiös verbrämtes und darum nur noch frevelhafteres Eigenlob nachgeschwatzt und diesen ganzen Apparat von Worten dem Jahrhundert des Liberalismus weitergereicht. Zum Nutzen und Frommen Englands.

Walter Raleigh, der weltmännische Seeräuber und Begründer der Kolonie Virginia, prägte das zynische Wort: „Leute, die auf kleine Beute ausgehen. aber nach Millionen jagt, den darf man nicht einen Piraten nennen.“
Die Größe der weltgeschichtlichen Entscheidung, die der Untergang der Armada bedeutet, soll mit solchen Betrachtungen nicht herabgesetzt werden. Die Nacht vom 7. zum 8. August 1588, da die englischen Brander auf die vor Anker liegenden spanischen „Feuerkolosse“ losgelassen wurden, bedeutete in Wahrheit das Ende der spanischen Herrschaft zur See. England erntete die Frucht seiner Piraterie; es hatte nun freie Bahn auf den Meeren. Den Seesieg zu einer Offensivaktion gegen Spanien auszunutzen, gelang den Engländern damals nicht. Drakes Versuch, in La Coruna englische Truppen zu landen, mit denen er den König von Spanien in seiner eigenen Hauptstadt zu bedrohen gedachte, endete mit einem schmählichen Misserfolg. Drake konnte nicht verhindern, dass seine Leute sich an dem Wein, den sie in der Stadt erbeutet hatten, maßlos betranken, und die Folge war, dass die ganze Besatzung der Flotte an einer Art Ruhr erkrankte; als Drake nach einem missglückten Handstreich auf Lissabon den Befehl zur einem Rückfahrt gab, waren von 15.000 Mann nur noch 7000 am Leben.
Elisabeth verhehlte ihren Ingrimm nicht. Sie hatte, wie auch die übrigen Aktionäre, das Kapital, das sie für diese Fahrt eingezahlt hatte, verloren, und das wog für sie schwerer als die Erinnerung an Drakes frühere Taten. Der Seeheld fiel in Ungnade: für eine Weile hatte Spanien Ruhe vor dem gefährlichsten seiner Feinde. Das Kapital der Londoner City begann, sich nach anderen Betätigungsmöglichkeiten umzusehen.
Auch hierbei sollte es sich als sehr nützlich erweisen, dass die spanische Überlegenheit zur See gebrochen war. Wie denn die englischen Staatsmänner überhaupt nicht verfehlten, sich auch diplomatisch die Türen für weitere Raubüberfälle in spanischen Besitz offen zu halten. Sie fanden dafür ein sehr einfaches Mittel.
England erklärte nämlich nun ein für allemal (vor Beginn der Piratenfahrten hatte es das Gegenteil zu Protokoll gegeben!), dass es den vom Papste verbrieften spanisch – portugiesischen Rechtstitel auf alle neuentdeckten Länder grundsätzlich nicht anerkenne, sondern nur diejenigen Länder als rechtmäßigen Besitz Spaniens oder Portugals ansehen werde, die von einer dieser Mächte auch faktisch in Besitz genommen seien.

Neu-Amsterdam um die Mitte des 17. Jahrhunderts An der Mündung des Hudson hatten holländische Siedler und Kaufleute diese blühende Kolonie geschaffen, die England 1664 raubte und in New York umbenannte. – Nach einem alten niederländischen Stich.
Das hörte sich soweit ganz korrekt an, und vom Rechtsstandpunkt auch der damaligen Zeit ließ sich kaum etwas dagegen einwenden. In der Praxis aber sah es mit dieser Anerkennung des „faktischen Besitzes“ dann doch beträchtlich anders aus. England behielt sich nämlich (was es nicht offen erklärte) die Feststellung darüber vor, ob eine Kolonie wirklich im Besitz der Spanier war. Wurde in der Folgezeit, z. B. ein spanischer Hafen in Westindien von den Engländern angegriffen und es gelang den Spaniern nicht, ihn mit Erfolg zu verteidigen, so war das eben ein Beweis dafür, dass Spanien diesen Hafen nicht „faktisch im Besitz gehabt hatte“, und somit gehörte er, als bisher herrenloses Land, von Rechts wegen den Engländern.
Die angebliche Anerkennung des spanischen Besitzstandes von englischer Seite lief also darauf hinaus, dass das Faustrecht zum Völkerrecht proklamiert wurde. Für die europäischen Länder wagte England das natürlich nicht; denn wie musste es ihm ergehen, wenn die Großmächte des Festlandes ihm diese seltsame völkerrechtliche Theorie am eigenen Leibe vordemonstrieren würden? Aber für alles, was über See, was „jenseits der Linie“ lag (nämlich der durch die päpstliche Bulle von 1493 und die darauf gegründeten spanisch – portugiesischen Verträge bestimmten nordsüdlichen Teilungslinie 370 Meilen westlich der kapverdischen Inseln sowie einer west-östlichen in der Höhe des Kap Bojador) -, für alle diese Regionen, also für den südlichen Atlantik, für den ganzen Stillen und den ganzen Indischen Ozean, für Amerika, Afrika und Asien galt fortab das Faustrecht.
Die „habsüchtigen Pfeffersäcke“
Es schien, als könne die Londoner Plutokratie jetzt zufrieden sein. Die Hanse war aus dem Handel Nordeuropas zurückgedrängt, Spanien und das mit ihm (seit 1580) unter derselben Krone vereinte Portugal waren gelähmt. Stand England nicht der Weg zur ersten Handelsmacht der Welt offen?
Doch gerade jetzt meldete sich ein höchst lästiger und unerwarteter Konkurrent: die Holländer. Ihre große Zeit war im Anbrechen. Die siegreiche Durchführung ihres Freiheitskampfes gegen Spanien hatte den nördlichen Niederlanden ein starkes Selbstbewusstsein gegeben. Während Antwerpen, Gent und Brügge unter den Stürmen des Krieges schweren Schaden litten, waren Holland und Seeland, die reichsten der sieben abgefallenen Provinzen, kaum merklich berührt daraus hervorgegangen. Amsterdam hatte das Erbe Antwerpens angetreten und war die wichtigste Hafen- und Handelsstadt des europäischen Festlandes geworden.
Als daher England in den letzten Jahren der Königin Elisabeth sich anschicken wollte, die Früchte seines Raubkrieges gegen Spanien zu pflücken, zeigte sich, dass es wieder einmal zu spät gekommen war. Denn Holland hatte, ganz ohne staatlich finanzierte Piraterie, auf dem Gebiet, das England nun als seine Domäne ausbeuten wollte, dem Überseehandel, einen bedeutenden Vorsprung gewonnen. Es verdankte diesen vor allem seiner Überlegenheit im Bau von Handelsschiffen. Und diese Überlegenheit war nicht erlistet, sondern beruhte auf echtem Erfindungsgeist.
Die Engländer hatten sich wohl zu glänzenden Taktikern des Seeraubs entwickelt, aber sie hatten, von der Sucht nach Beute ganz gefangen genommen, eine der wichtigsten Fragen der Schiff-Fahrt über weite Strecken vernachlässigt. Die Bedienung der Segel nämlich verlangte in jener Zeit eine im Vergleich zu modernen Schiffen beträchtlich größere Zahl von Arbeitskräften, und darum wurde auf längere Strecken das Problem der Mannschaftsversorgung oft recht schwierig. Es war nicht möglich, außer der Ware, die man exportieren wollte, noch genügend Vorrat an Lebensmitteln und frischem Wasser für die ganze Zeit der Fahrt an Bord zu nehmen. Daher war ein Segler, sobald der erste Vorrat aufgebraucht war, zu häufigen Landungen genötigt. Für die Spanier und die Portugiesen war das keine allzu große Schwierigkeit; denn die Häfen, in denen der Vorrat ergänzt wurde, gehörten zumeist ihnen. Die Engländer und die Holländer hingegen waren in den Häfen der iberischen Mächte ungern gesehene Gäste, und es musste ihnen alles daran liegen, sich von diesen Zwischenlandungen möglichst unabhängig zu machen.
Während nun aber die Engländer in ihrem Schiffbau alles beim Alten ließen, war es den Holländern gelungen, das Problem weitgehend zu lösen. Durch Verbesserungen und Vereinfachungen im Takelwerk halten sie es dahin gebracht, dass die Zahl der Bemannung eines Handelsschiffes auf die Hälfte sank; sie konnten also bei einer gegebenen Anzahl von Matrosen doppelt soviel Schiffe auf Fahrt schicken wie die Engländer und brauchten mit diesen Schiffen überdies lange nicht so oft zur Einnahme von Vorräten zu landen.
Der erste große Erfolg, den sie diesem technischen Fortschritt zu danken hatten, rief in der City von London große Verblüffung hervor. Im Jahre 1598 nämlich lief, nach sorgfältiger Vorbereitung und genauem Studium der nautischen Probleme, eine Flotte von zweiundzwanzig niederländischen Schiffen nach dem Fernen Osten aus. Sie gelangte unbeschädigt nach Bantam, dem großen Pfefferausfuhrhafen auf Java, wo ihr die portugiesischen Behörden keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen wagten. Reich beladen mit Gewürzen kehrte sie heim. Innerhalb der nächsten Jahre wurde diese holländische Ostindienfahrt noch öfter und mit einer immer größeren Anzahl von Schiffen wiederholt.

Oliver Cromwell – Der durch den Bürgerkrieg gegen Karl I. zur Herrschaft gekommene Diktator Englands (1649-1658) führte die Raubpolitik der Könige fort. Er plante die Vertreibung Spaniens aus ganz Amerika, erlangte aber nur Jamaika. – Gemälde von Philipp Lely.
Es war also bewiesen, dass eine tüchtige seefahrende Nation, ohne mit den Kolonialbehörden in Konflikt zu kommen, an dem Handel mit den vielbegehrten Gewürzen teilnehmen konnte. Und es konnte nicht ausbleiben, dass dieser Erfolg die „wagenden Kaufleute“ von London auf den Plan rief. Wie immer, wenn ein anderes Volk aus eigener Kraft etwas Neues in die Welt gebracht hat, woraus sich wirtschaftlicher Nutzen ziehen läßt, so waren auch jetzt die Engländer zur Stelle, um zu erklären: wir wollen auch an diesem Geschäft beteiligt sein! Den Tisch haben die anderen gedeckt, die Engländer setzen sich daran.
Der Handelsneid auf die Holländer ist das Motiv zur Gründung der „Ostindischen Gesellschaft“ gewesen. Die Aktionäre, die am 22. September 159. Zeichnung eines Aktienkapitals von 6 Millionen Mark heutigen Wertes zusammentraten, mit dem „zur Ehre unseres Heimatlandes“ eine „Fahrt nach Ostindien und anderen Inseln jener Gegend“ finanziert werden sollte, waren größtenteils Mitglieder der „Levante Kompanie“ – ein Zeichen dafür, dass die City ihre Orientinteressen bedroht sah, wenn die tatkräftigen Holländer den Gewürzhandel von den Straßen des Vorderen Orients auf den direkten Seeweg um das Kap ablenkten. Es ist aber charakteristisch für die Tendenz Englands, die Geschichte in seinem Sinne zu fälschen, dass man bei den älteren englischen Historikern, die auch die festländische Meinung vielfach beeinflusst haben, nicht dieses kapitalistische Motiv für die Gründung der Ostindischen Gesellschaft angegeben findet, sondern ein ganz anderes. Um der Wohlfahrt seines Volkes willen, so heißt es, habe England den direkten Handel mit Ostindien in seine Hand nehmen müssen; denn die „Habsucht der Holländer“ habe den Pfefferpreis künstlich herauf geschraubt. Das ist natürlich eine Albernheit, denn Holland hatte ja keineswegs ein Monopol, und England hätte sich bei den Portugiesen oder den Türken billigeren Pfeffer kaufen können – wenn es billigeren Pfeffer gegeben hätte.

Seeschlacht vor der Themsemündung 1653 Trotz seiner Berufung auf den protestantischen Glauben verbündete sich Cromwell mit dem katholischen Frankreich gegen dos protestantische Holland, um dessen Seemacht zu vernichten. Doch die Holländer leisteten hartnäckig Widerstand. – Gemälde von Wittern van der Velde.
Aber der Preis des Pfeffers hing nicht von dem guten oder bösen Willen der Kaufleute ab, sondern von der Güte der Ernte, und es konnte also geschehen, dass er ein paar Jahre hintereinander hoch blieb. Aber was kann man nicht einer leichtgläubigen Welt alles einreden? Die Legende von den „habsüchtigen Pfeffersäcken“ fand lange Zeit willige Ohren …
Dass allerdings Pfeffersäcke bisweilen ein sehr unbequemes Besitztum sein können, sollten die Aktionäre der ersten englischen Ostindienfahrt, wenn auch nicht am eigenen Leibe, so doch am eigenen Portemonnaie recht unliebsam erfahren. Diese erste Ostindienfahrt wurde überhaupt so recht ein Beweis für die Rückständigkeit der englischen Schiff-Fahrt. Fünf Fahrzeuge waren es nur, die die Aktionäre auszurüsten vermochten – die Holländer schickten im gleichen Jahre (1601) achtzig in den Malaiischen Archipel. Während die Holländer die Routen genau kannten, geriet das englische Geschwader aus Unkenntnis der nautischen Verhältnisse an der westafrikanischen Küste in das Gebiet der Windstillen und verlor so einen ganzen Monat. Dieser Zeitverlust machte die Lebensmittel so knapp, dass ein Fünftel der Mannschaft vom Skorbut hingerafft wurde. Es dauerte fast anderthalb Jahre, bis man bei Atschin auf Sumatra vor Anker gehen konnte, und auch hier war der englische Anführer auf Seeraub angewiesen, wenn er Waren einnehmen wollte, denn der Pfeffer war knapp und teuer. Zum Glück kam eine stattliche portugiesische Raravelle des Weges daher, die – nach rechter Seeheldentradition – gekapert wurde. Gegen das so erbeutete Kaliko konnte man dann endlich im nächsten Jahre in Bantam ausreichend Pfeffer eintauschen und sich auf den Heimweg machen.
Die Schiffe waren morsch geworden, die Mannschaften durch Krankheiten weiter dezimiert – kurz, es war eine recht jämmerliche Fahrt, und der lose Pfeffer in den Laderäumen, der durch alle Ritzen drang und nach dem alles roch und schmeckte, machte sie nicht genußreicher.
Als die Segler aber endlich in die Themse eingelaufen waren – zweieinhalb Jahre waren seit der Abfahrt verstrichen, die Königin Elisabeth war inzwischen gestorben, und Jakob L, der Sohn der Maria Stuart, saß auf dem Thron -, kam die Reihe zu fluchen an die Aktionäre. Sie hatten nun Unmengen von Pfeffer (aus dem einen der Schiffe allein wurden 210 000 Pfund herausgeholt), viel mehr, als die englischen Küchen aufnehmen konnten. An Ausfuhr war auch nicht zu denken, denn die Holländer hatten soeben riesige Mengen Pfeffer auf den europäischen Markt geworfen. Man fragte beim Schatzamt an, ob dieses nicht den Pfeffer aufkaufen und für Zeiten der Knappheit einlagern wolle. Aber das Schatzamt hatte selbst viel zuviel Pfeffer; er stammte von einem portugiesischen Kauffahrteischiff, das vor einiger Zeit gekapert war…
So beschloss denn die Ostindische Kompanie, die Dividende an die Aktionäre statt in Geld in Pfeffer zu bezahlen. Ein wahrhaftes Danaergeschenk. Denn auch zu den niedrigsten Preisen war der unglückselige Pfeffer nicht loszuwerden, und so mancher, der sich goldene Berge von der Indienfahrt versprochen hatte, blieb an die sieben Jahre auf seinen Pfeffersäcken sitzen.
Kein Wunder, dass der Ingrimm auf die Holländer immer tiefer in den Gemütern der Londoner Kaufleute Wurzeln schlug.
Es sollte länger als ein halbes Jahrhundert dauern, bis die Stunde der Rache schlug. Denn in den Jahrzehnten nach dem Tode Elisabeths nahm Holland, von England fast ungehindert, seinen Aufschwung zur ersten Seemacht der Welt. Die zwölfjährige Waffenruhe in dem Kampf mit Spanien (1609-1621) gab ihm Gelegenheit, alle seine Kräfte auf die Ausweitung des Überseehandels zu konzentrieren, und als dann Spanien, leichtfertig und schlecht gerüstet, 1621 den Krieg entfesselte, konnte Holland seine ganze Überlegenheit entfalten. Die schwachen Nachfolger Philipps II. vereinigten wohl die Kronen Spaniens und Portugals auf ihrem Haupt, aber sie vermochten die beiden Weltreiche nicht gegen den Ansturm des kleinen Holland zu verteidigen. In beiden Hemisphären, in Afrika, Asien und Amerika wurden holländische Kolonien Erstritten oder neu geschaffen: Angola und Mozambique, Ceylon, Sumatra und Java, Bahia und Curacao – ein neues Weltreich erstand. Um die Mitte des Jahrhunderts befuhren 6000 holländische Schiffe die Ozeane, überall vermittelten holländische Faktoreien den Warenumschlag, holländische Seefahrer entdeckten in Nord und Süd neues Land: Spitzbergen und Nowaja Semlja, Neuseeland und Tasmanien.
„Und wo warst du, als man die Welt geteilet?“‚ Wieder einmal hätte England auf diese Frage betreten schweigen müssen. Wieder einmal war es nachgehinkt und zurückgeblieben. Elisabeths Nachfolger, Jakob I., der Sohn der Maria Stuart, war kein Erbe des Krämerblutes der Tudors und Boleyns; er war in keinem Sinne des Wortes ein „wagender Kaufmann“. Er konnte nicht mit Geld rechnen, er warf es zum Fenster hinaus, verschenkte es an junge Männer, die ihm gefielen. Korruption lähmte den Gang der Regierung, willkürliche Zölle, die den leeren Kronschatz fällen sollten, den Fortschritt des Handels. Die Zahl der Schiffe nahm nicht zu – England geriet auf den Ozeanen ins Hintertreffen.
Und gerade jetzt wäre die Zeit gewesen, von Spaniens Niedergang Nutzen zu ziehen – aber wieder versagte England. Gering nur, gemessen an der Ausbreitung des niederländischen Kolonialreiches, war das, was England sich von dem spanischen Kolonialreich „eroberte“: und nicht im Krieg, wie die Holländer, sondern im Frieden, gestützt auf das von ihm verkündete Faustrecht.

„In Jamaika herrscht wieder Ordnung“ Da die Besiedlung Jamaikas mit Weißen nicht die Insel zu einer Negersklavenkolonie gemacht. Aufstände der misshandelten Schwarzen waren an der Tagesordnung und wurden von den englischen Behörden mit sadistischer Grausamkeit unterdrückt. -Zeichnung von Honorè Daumier (1865).
Da wurde zunächst (1606) von Abenteurern zweifelhafter Art ein Zug nach der Küste Nordamerikas unternommen, an jenen Landstrich, wo vor schon einmal Walter Raleigh gelandet war und dem er zu Ehren der „jungfräulichen Königin“ den Namen Virginia gegeben hatte. Es war ein Einbruch in spanisches Gebiet, ohne Zweifel, und Madrid verfehlt nicht, dagegen zu protestieren. Aber in London macht man kein Hehl daraus, dass ein spanischer Angriff auf die neue englische Kolonie nicht als eine Wahrung spanischer Rechte, sondern als ein Überfall angesehen werden würde – und vor einem Krieg mit England schreckte man, nach den Erfahrungen der Armada, in Spanien zurück.
Die Hauptstadt der neuen Kolonie wurde Jamestown getauft, zu Ehren des neuen Königs, der im übrigen an ihr mehr Ärger als Freude erlebte. Denn als vor Jahren die ersten Schiffsladungen mit Tabak aus den spanischen Kolonien nach Europa gekommen waren und unter den feinen Leuten auch in England die Mode des Pfeifenrauchens aufgekommen war, hatte Jakob voller Empörung zur Feder gegriffen und eine geharnischte Streitschrift wider diese lästerliche Unsitte veröffentlicht. Und nun stellte sich heraus, dass in der Nähe von Jamestown keineswegs, wie man erwartet hatte, große Gold- und Silberminen lagen, wohl aber, dass die Indianer von Virginia eine ganz besonders schmackhafte Sorte von Tabak anbauten, ja, dass Tabak überhaupt die einzige Ausfuhrware war mit der die Kolonisten ihren Bedarf an Wolle und andere einheimischen Gütern bezahlen konnten. Sie fingen also auch an, Tabak zu pflanzen, bestellten sich einige Schiffsladungen voll Negersklaven und erreichten es, dass nach etwa 20 Jahren der Tabak aus Virginia in ganz Europa gesucht war. So musste es Jakob noch Erleben, dass die Stadt, die seinen Namen trug, der wichtigste Ausfuhrhafen für das Kraut wurde, das er mehr als alles andere in der Welt verabscheute.
Die Lahmheit des spanischen Protestes machte Mut zu weiteren Einbrüchen in das amerikanische Reich. 1611 wurden die Bermuda-Inseln, 1616 die Küste von Guiana (wo man den Zugang zum Dorado vermutete), 1624 die kleinen Antillen St. Christoph und Barbados, Antigua und Montserrat besetzt. Kleine Brocken nur von einem gewaltigen Kuchen, und jedenfalls nicht die Rosinen. Besonders in Nordamerika hätten bei stärkerer Initiative die Engländer sehr viel wichtiger Landstriche erbeuten können. Aber auch hier liefen ihnen die Holländer den Rang ab. Langsam nur wuchsen die englischen Besitzungen. Schnell aber blühte die Kolonie auf, die Holländer 1612 an der Mündung des Hudson-Flusses gegründet hatten: Neu-Amsterdam, das schon nach wenigen Jahren 10 000 Einwohner zählte.
Kläglich versagten auch alle englischen Versuche, mit den Holländern in dem großen fernöstlichen Reich Portugals Schritt zu halten. Es war wie das Wettrennen zwischen dem Hasen und dem Swinegel: immer, wenn eine englische Expedition meinte, jetzt den Platz für eine Faktorei und einträglichen Gewürzhandel gefunden zu haben, so lagen dort schon holländische Schiffe, und holländische Beamte komplimentierten die Ankömmlinge höflich, aber bestimmt wieder zum Hafen hinaus. Was Wunder, dass der Hass gegen die „Pfeffersäcke“ immer stärker anschwoll …
Nur an einer Stelle der Welt gelang es der City, wirklich Fuß zu fassen und den Grund zu späteren Profiten zu legen. Wenn nämlich auch die englische Ostindienfahrt sich nicht im Entferntesten mit der niederländischen messen konnte, so hatten die englischen Kapitäne doch bald etwas sehr Wichtiges begriffen: daß nämlich die malaiischen Händler auf den Gewürzinseln sich überhaupt nicht mit englischer Wolle und nur ungern mit Geld bezahlen ließen, wohl aber mit indischen Baumwollwaren, besonders dem bedruckten Kaliko. Sie fingen also an, sich auf den Zwischenhandel zwischen Vorderindien und dem Malaiischen Archipel einzustellen. Auch hierbei kann England keine Originalität für sich in Anspruch nehmen. Vor ihm hatten schon Portugal und Holland dieselbe Erfahrung gemacht und nach ihr gehandelt.
Aber Vorderindien ist ein unermessliches Gebiet, und keine europäische Macht war stark genug, eine andere hier völlig auszuschließen. So gelang es der Ostindischen Kompanie nach langen vergeblichen Anstrengungen, an beiden Küsten Vorderindiens sich von dem Großmogul und seinen Unterkönigen die Erlaubnis zur Errichtung von Faktoreien erteilen zu lassen.
Daß die Holländer sie – nicht durch Gewalt, sondern durch die Überlegenheit ihrer Schiff-Fahrt, ihrer Organisation und ihrer Politik gegenüber den eingeborenen Fürsten – von den Sunda- Inseln verdrängt hatten, wurmte die „wagenden Kaufleute“ in London gewaltig. Als dann noch englische Faktoren in Ainboina auf Java einen Handstreich gegen die holländischen Behörden geplant hatten und daraufhin von diesen als Hochverräter dem Henker überantwortet wurden, ertönte ein allgemeiner Schrei nach Rache. Das „Massaker von Amboina“ (1624) wurde ein Hauptschlager der antiholländischen Propaganda und ist es auf lange Zeit geblieben.

Barbarische Methoden in Westindien Im englischen Unterhaus war 1797 zur Sprache gekommen, daß ein englischer Sklavenhalter einen wegen Krankheit arbeitsunfähigen Neger dreiviertel Stunden lang in einen mit kochendem Zuckersaft gefüllten Kessel gesteckt hatte. Zeichnung des Engländers James Gillray..
Aber die Rache musste noch verschoben werden. Denn es kamen nun die Zeiten, da König Jakobs Sohn und Nachfolger, Karl I., sich mit dem Parlament, und das heißt: mit der City von London, überwarf. Der König, der die Londoner Plutokratie besteuern wollte, war ein noch gefährlicherer Feind für sie als die Spanier und die Holländer zusammengenommen. Ein Vierteljahrhundert lang (1625-1650) schaltete sich England im erbitterten inneren Kampf, ja schließlich im Bürgerkrieg, wie aus der europäischen so auch aus der Weltpolitik aus. Während auf den Schlachtfeldern Englands das Blut von „Kavalieren“ und „Rundköpfen“, von Königstreuen und Parlamentstreuen, in Strömen floss, weitete Holland sein Kolonialreich und seine Handelsübermacht zur See immer mehr aus. Englischen Schiffen aber wagten festländische Kaufleute nicht mehr ihre Waren anzuvertrauen; denn da die Parteien des Bürgerkrieges einander auch zur See bekämpften und die alte Piratentradition aufeinander anwandten, so konnte keiner sicher sein, ob ein Schiff auch seinen Bestimmungshafen erreichen werde.

Henry Morgan „Hibustier und Gouverneur“ An seinen Namen knüpft sich die Erinnerung an die entsetzlichen Taten der englischen Freibeuter, die Morgan bei ihren Plünderungen gegen Puerto Bello und Panama anführte. Der Verbrecher endete als Gouverneur von Jamaika. – Alter holländischer Stich..
Als daher der Bürgerkrieg mit der Hinrichtung König Karls I. und der Machtergreifung Oliver Cromwells, des „Lord- Protectors“, zu Ende gegangen war, befanden sich Handel, Industrie und Schiff-Fahrt in einer jämmerlichen Lage. Es musste die Sorge einer starken Staatsführung sein, England wieder den Anschluss an die anderen Überseehandel treibenden Nationen Europas zu verschaffen, und niemand wird Cromwell verdammen, weil er hier zu rigorosen Mitteln griff. Aber es ist doch ungemein bezeichnend, dass der „revolutionäre“ Lord- Protector, kaum dass er die Macht in Händen hatte, wieder in die Bahnen der elisabethanischen Tradition einlenkte, nämlich in die Bahnen der kleinlichen Schikane und der Seeräuberei. Auch er konnte sich nicht vorstellen, dass es einen anderen Weg gebe, England groß zu machen, als den, andere Nationen von dem Platz, den sie aus eigener Kraft gewonnen hatten, zu verdrängen.
Da waren es nun vor allem die Holländer, die bei Seite gestoßen werden mussten, und der erbitterte Feind der „Papisten“, der Mann, der im Namen des geeinigten Christentums Tausende von irischen Mönchen hinschlachten ließ, vergaß die „Solidarität der protestantischen Nationen“ völlig, wenn es um die lästigen Konkurrenten am anderen Ufer der Nordsee ging. Dass die Holländer nun keineswegs die kurzsichtigen Beutelschneider waren, als die die englische Geschichtslegende sie hinstellt, bewiesen sie gerade am Anfang der Cromwellschen Herrschaft dadurch, dass sie Cromwelt einen großzügigen Kolonialpakt vorschlugen: sie erklärten sich bereit, ihre Kolonien dem englischen Handel zu öffnen, wenn England das gleich tue, und die englischen Kaufleute zollpolitisch ebenso zu behandeln wie die eigenen. Die Antwort auf diese Angebot, das eine friedliche Ära der gemeinsamen Expansion hätte eröffnen können, war der Erlass eines Gesetzes, das von englandfreundlichen Historikern oftmals als der Ausfluss höchster nationaler Weisheit gepriesen worden ist: der so genannten „Navigationsakte“ (1651), in der Schiffen anderer Nationen der Handel zwischen Übersee und England ganz verboten im übrigen aber die Einfuhr von Waren nach England nur dann erlaubt wurde, wenn diese Waren aus dem Heimatland des betreffenden Schiffes stammten.
Als einstmals die spanischen Könige das Monopol des Handels mit ihren Kolonien verkündet hatten war das ein Grund für England gewesen, Spanien der unrechtmäßigen Beschränkung der Handelsfreiheit zu bezichtigen. Jetzt ahnte England den Todfeind von einst nach und errichtete selber ein solches Monopol! Und das in einem Augenblick, wo der englische Schiffsraum nicht im Mindesten ausreichte, den in Frage kommenden Warenverkehr zu bewerkstelligen. Einen wirtschaftlich vernünftigen Sinn konnte das Gesetz nicht haben, und in der Tat währte es nicht lange, bis die englischen Kaufleute sich beschwerten, daß ihre Geschäfte stockten, weil sie nicht genügend Schiffsraum zur Verfügung hätten. Aber diese Schädigung des eigenen Handels nahm Cromwell ohne Bedenken mit in Kauf, weil der Hauptzweck erreicht war: die Holländer zu brüskieren. Ehe man sich noch in Amsterdam in die Sache hineingefunden hat, kommt ein zweiter Schlag: Cromwell meldet Entschädigungsforderungen an, und zwar für lange zurückliegende Beschlagnahmen englischer Schiffe in Ostindien, für das „Massaker in Ambina“ und dergleichen. Vergeblich versuchen die Holländer, durch Verhandlungen eine freundlichere Atmosphäre zu schaffen. Ein dritter Schlag macht die wahren Absichten Englands offenkundig: die holländische Heringsflotte in der Nordsee wird von englischen Kriegsschiffen angegriffen und als Prise in englische Häfen eingebracht. Kein Zweifel: England will den Krieg Und Holland nimmt die Herausforderung an.
Damit hat England seinen neuen Erbfeind entdeckt. Jetzt werden alle Register des Hasses und der Verachtung gegen die engstirnigen Krämer von Amsterdam, gegen die habsüchtigen Pfeffersäcke gezogen. Holland ist nicht mehr der Verbündete gegen Papst und Spanien; es ist der große Wucherer, die Hyäne der Weltmeere, die um der Reinheit des Evangeliums willen verjagt werden muss. Es ist das neue Karthago, das von dem neuen Rom – England – zerstört werden muß.
Allerdings fehlt es auch damals in England nicht ganz an Leuten, die die Verlogenheit der Kampfparole durchschauen – und zwar gerade unter denen, denen Cromwell seinen Aufstieg verdankt, den kleinen Leuten also, den Puritanern. Da laufen manche anonyme Flugschriften durch das Land, die dem Lord- Protector und den Herren von der City recht unangenehme Wahrheiten sagen. „Es soll um nichts Geringeres gehen, so heißt es hier etwa, „als um Gottes Ehre und die Ausbreitung des wahren Evangeliums – und dabei streben sie nach nichts mehr als nach Gewinn für sich selbst und danach, sich in den reichen Besitzungen anderer festzusetzen.“ Welch treffende, für alle Zeiten gültige Charakteristik der englischen Politik! Aber diese Stimmen verhallten ungehört. Für Cromwell ist längst, wie einst für Elisabeth und Drake, kein Unterschied mehr zwischen „Gottes Ehre“ und Englands Reichtum.

Der Sturm auf Puerto Bello Eins der schmählichsten Kapitel englischer Kolonialgeschichte: mitten im Frieden überfallen die Flibustier die spanische Hafenstadt Puerto Bello in Mittelamerika, metzeln die Besatzung nieder und plündern die Häuser aus. – Alter holländischer Stich..
Immerhin dauerte es eine Weile, bis er ganz auf der Höhe der elisabethanischen Methoden war. Der direkte auf Holland, mit dem er es zuerst versuchte, erwies sich nicht als sehr gewinnbringend. Zwar gelang es, in den ersten zwei Kriegsjahren (1652-1654) ungefähr 1700 holländische Handelsschiffe als Prisen einzubringen – etwa den zehnten Teil der holländischen Handelsflotte. Aber auch die eigenen Schiffsverluste waren nicht unerheblich, und vor allem bedrohte Hollands Kriegsflotte unter überlegenen Führern – Tromp zunächst, dann De Ruyter – mehrmals in höchst gefährlicher Weise die englische Küste. Zeitweise konnten die Holländer die Themsemündung blockieren und damit die englische Hauptstadt von der überseeischen Zufuhr abschneiden.
Durch einen Krieg in der Nordsee und im Kanal, das musste Cromwell einsehen, war „Karthago“ nicht zu zerstören. Man musste schon nach anderen Mitteln suchen, vor allem aber nach Verbündeten. So liquidierte denn Cromwell den Krieg zunächst einmal (1654) und hielt Umschau nach Mitstreitern. Er brauchte nicht lange zu suchen; denn der Kardinal Mazarin, der Regent Frankreichs, war auch seinerseits auf der Suche nach Helfern. Ihm ging es nicht aus überseeischen, sondern aus festländischen Interessen heraus um die endgültige Eindämmung der spanischen Macht in Südeuropa, und er war es, der in London die Anregung gab, sich der schwachen Positionen des spanischen Kolonialreiches zu bemächtigen. Vielleicht gelang es den Engländern, Spanien die Edelmetallzufuhr aus Amerika abzuschneiden, so rechnete er, und für diesen Gewinn war ihm der Preis der Ausbreitung des englischen Kolonialreiches nicht zu hoch. Er war sogar bereit, den Engländern zum Dank für die Hilfe in Amerika den spanisch – niederländischen Nordseehafen Dünkirchen mit französischen Truppen zu erkämpfen, mit anderen Worten also, England eine Festlandsbasis zum Kampf gegen Holland zu verschaffen. Cromwell ließ sich diese Angebote nicht zweimal machen, und gleich nach dem Friedensschluss mit den Holländern segelte eine englische Kriegsflotte nach Westindien, ohne dass Spanien der Krieg erklärt worden wäre, ja, ohne daß auch nur der Vorwand zu einem kriegerischen Vorgehen gesucht worden wäre. Das Faustrecht „jenseits der Linie“ trat wieder einmal in Kraft. Allerdings war Cromwell nicht gesonnen, sich mit einem Überfall auf die Schatzflotten zu begnügen, wenn er auch hoffte, einen guten Teil der Kosten für den abgeschlossenen Krieg gegen Holland auf diese Weise wieder hereinzubringen. Sein eigentliches Ziel ging weiter. Er wollte nichts Geringeres als Spanien aus Amerika hinausdrängen, und darum erhielt der Admiral der nach Westindien segelnden Flotte, die diesmal nicht von einer Aktiengesellschaft unter finanzieller Beteiligung des Staatsoberhauptes, sondern vom Staate selbst auf Raub ausgesandt war, den Auftrag, sich der Haupthäfen von San Domingo, der Schlüsselstellung zu den spanischen Besitzungen in Mittelamerika, zu bemächtigen.
Es war die größte Enttäuschung in Cromwells Leben, dass dies nicht gelang. Ausbrüche ingrimmigen Zornes und schlaflose Nächte waren die Folgen der Nachrichten aus Westindien: der Überfall auf San Domingo sei an der Wachsamkeit und militärischen Überlegenheit der Spanier gescheitert; dafür sei allerdings eine andere stattliche Insel in Besitz genommen worden: Jamaika. Doch Cromwell hatte wenig Freude an diesem Erfolg der englischen Faustrechtstheorie, denn Jamaika lag im Innern der Karibischen See und war überdies von den Spaniern noch kaum nutzbar gemacht worden. Alle Arbeit stand also noch bevor, und der strategische Gewinn war gering.
Man versuchte nun, Hals über Kopf die Neugewonnene Kolonie, dieses Danaergeschenk, zu besiedeln. Denn wenn auch niemand in London so recht wusste, wozu Jamaika gut sein könne, so sollten es doch jedenfalls die Spanier auf keinen Fall wiederhaben. Ein Aufruf an die Kolonisten in Nordamerika verhallte ungehört; vergeblich versuchte ein Abgesandter der Londoner Regierung ihnen klarzumachen, dass es ihre patriotische und religiöse Pflicht sei, nach Jamaika überzusiedeln; denn diese Insel, so sagten sie, sei „ein Land des Überflusses, wo man schnell reich werden kann – und hat uns Gott nicht versprochen, dass wir an der Spitze aller Völker stehen sollen, nicht am Ende?“ Es half nichts, die Neu-Engländer beackerten lieber ihren kargen Boden und verschmähten das Paradies. Die Zauberworte „Zucker, Indigo, Baumwolle“ hatten keine Lockung für diese Männer, unter denen es viele mit dem Gebot eines gottgefälligen Lebens sehr viel ernster nahmen als die Herren der City. So blieb nichts übrig, als die neue Kolonie mit Gewalt zu besiedeln. In Schottland wurden eines Tages sämtliche Landstreicher auf den Straßen aufgegriffen und nach Jamaika verfrachtet. Ein andermal brachte eine Flotte tausend junge Männer und ebenso viele Mädchen aus Irland; man hatte sie einfach auf die Schiffe geschleppt und setzte sie nun hier im Tropenparadies aus. Dann wieder kämmte man die Londoner Gefängnisse aus und verschiffte die Verbrecher in die neue Eroberung, schließlich musste noch ein Schub Juden nachhelfen, kurz, es war ein tolles Sammelsurium, das nun Jamaika bevölkern und zur Blüte bringen sollte.
Noch nach Jahren gab es auf Jamaika keine Pflanzungen. Die unfreiwilligen Kolonisten arbeiteten nicht. Der Urwald wucherte wie zuvor, nur in der Hafenstadt Kingston wimmelte es von Menschen und auch von Waren. Hier lagen Zucker und Indigo, Ingwer und Baumwolle, Blauholz und Silber. Aber nichts von diesen wertvollen Gütern war auf der Insel selbst gewachsen, alles war den Spaniern geraubt. Kingston war ein Hehlernest, die Kolonie Jamaika lebte vom Zwischenhandel zwischen Seeräubern und der sehr ehrenwerten Kaufmannschaft von London. Ihre Lieferanten waren die „Flibustier“, der Schrecken des Karibischen Meeres. Wer waren die Flibustier?
Verwildertes Vieh auf einer von den Spaniern verlassenen Insel Westindiens, eine Gruppe zerlumpter Männer, die darauf Jagd macht, um den Hunger zu stillen – damit fängt ihre Geschichte an. Die schiffbrüchige Besatzung eines gestrandeten Piratenschiffes mag es gewesen sein, Engländer oder auch „Wassergeusen“, denen das Lauern auf spanische Schatzgalleonen zum Verhängnis geworden war. Männer jedenfalls, die längst jeder Zucht und Sitte entwöhnt waren. Sie sahen den Indianern die Arten der Jagd und des Konservierens der Jagdbeute ab, und bald fanden sie heraus, dass das nach indianischer Methode getrocknete Fleisch in den Hafenstädten als Schiffsvorrat guten Absatz fand. Sie verjubelten den Erlös mit Dirnen, und wenn dann das Geld ausging kehrten sie wieder zurück in ihre Jagdgründe. Weib und Kind hatten sie nicht, für nichts zu nichts zu denken.
Dann kam wohl einmal der Tag, da ihnen ein gestrandetes Schiff in die Hand fiel, das sich wieder flottmachen ließ – jedenfalls, aus den Jägern wurden Piraten, Freibeuter. „Freebooter“ hieß das englisch, und die Franzosen sprachen es wie „Flibustier“ aus. Sich selbst aber nannten diese Seeräuber, die keinem Volke und keinem Staate mehr angehören wollten und keinen Herrn über sich anerkannten als ihren Räuberhauptmann – sich selbst nannten sie „Brüder der Küste“. Denn das war nun ihr Gewerbe: sie fuhren an den Küsten des Karibischen Meeres entlang und lauerten den spanischen Kauffahrern auf. Da sie nun ihre Beute natürlich in keinem spanischen Hafen losschlagen konnten, so war ihnen Jamaika eine große Stütze. Denn das Gesindel, das hier unter einem englischen Gouverneur dem Herrgott den Tag stahl, übernahm gern den Hehlerdienst. Ohne Jamaika keine Flibustier, ohne Flibustier kein Jamaika. Die englischen Beamten wachten darüber, daß alles seinen ordentlichen Gang ging. Sie stellten Kaperbriefe aus, so dass die Flibustier sicher waren, nicht etwa einem englischen oder französischen Kriegsfahrzeug ausgeliefert zu werden; sie buchten die Ein- und die Ausgänge und erhoben die vorgeschriebenen Zollsätze, kurz, wenn die Flibustier auch nichts waren als gemeine Seeräuber, so wurden sie doch von Englands Gnaden zu behördlich konzessionierten Seeräubern. Ein Risiko, wie früher zu Drakes Zeiten, brauchten die Herren von der City bei diesem Geschäft nicht zu laufen. Das allein. trugen die Flibustier, diese Galgenvögel, ganz allein.
„No prey, no pay“ (keine Beute, kein Geld) war die Regel. Und für die Ausstellung eines Kaperbriefes hatten die Flibustier überdies noch einen Teil der Beute an den Gouverneur abzuliefern.

Die Flibustier vor Panama Um den spanischen Kolonisten Aussagen über den Verbleib ihres Vermögens zu erpressen, wandten die Flibustier beispiellos raffinierte Foltermethoden an. – Alter holländischer Stich..
Es war ein unsauberes, aber rentables Geschäft, und es ersparte der City von London die Unkosten, die sonst mit der Neugründung einer Kolonie oder einer Handelsniederlassung verbunden zu sein pflegen. Aber es hielt sich eine ganze Zeit lang nur in mittleren Grenzen, bis ein Mann es in die Hand nahm, der ihm wirklich großzügigen Charakter zu geben wusste und die Flibustier lehrte, nicht nur nach der kleinen Beute der Küstenschiffe, sondern nach den Millionen der großen spanischen Städte zu jagen.
Dieser Mann, ein würdiger Nachfolger Drakes, hieß Henry Morgan. Über seine Jugend lesen wir in alten Berichten, dass er bäuerlicher Herkunft war, aber keine Lust zur Landarbeit hatte, in den Straßen der Hafenstadt Bristol herumlungerte und dabei von Agenten aufgegriffen wurde, die ihn kurzerhand nach einer in England üblichen Methode, Arbeitskräfte für die Kolonien zu beschaffen, als Leibeigenen auf eine westindische Pflanzung verkauften. Als dort seine Dienstzeit abgelaufen war, wurde er zum zweiten Male der Landarbeit überdrüssig und schloss sich den Flibustiern an, bei denen er es dank seiner Beherztheit bald zum Kapitän brachte. Auch der damalige Gouverneur von Jamaika scheint in ihm einen Mann erkannt zu haben, der über den Durchschnitt weit herausragte, denn sonst hätte er dem Dreiunddreißigjährigen wohl nicht die Vollmacht zu einem Unternehmen ausgestellt, das nur gelingen konnte, wenn es durch seine Kühnheit und Durchtriebenheit alles in den Schatten stellte, was die Flibustier bisher zuwege gebracht hatten: dem Angriff nämlich auf die spanische Hafenstadt Puerto Bello an der atlantischen Küste der Landenge von Panama, dem Umschlagplatz des ganzen Südamerikahandels.
Der Charakter des Unternehmens war eindeutig. Es ging nicht um Eroberung, denn eine dauernde Besetzung des stark befestigten Platzes war ausgeschlossen; über kurz oder lang hätten die 500 Mann, die Morgan zur Verfügung hatte, doch einem spanischen Gegenangriff, der bei der Wichtigkeit des Ortes unausbleiblich war, weichen müssen. Es war also nicht einmal das von England proklamierte Faustrecht, das hier waltete, sondern das unverhüllte Verbrechertum, sanktioniert von den Kolonialbehörden in Jamaika und von der Regierung in London, ausgeübt gegen einen Staat, mit dem man in Frieden lebte. Puerto Bello war eine volkreiche Stadt mit starken Kastellen. Nicht mit Waffengewalt, nur mit Schrecken war es einzunehmen. Darauf gründete sich Morgans Taktik. Und sie hatte Erfolg.
Als es ihm nämlich gelungen war, in das erste Kastell mit einem Handstreich einzudringen, ließ er die überrumpelte Besatzung in einen Raum zusammenpferchen und sprengte das Kastell mitsamt den Gefangenen kaltlächelnd in die Luft. Die Explosion weckte die schlafende Stadt und scheuchte die Menschen auf die Straße.

Die Holländer vor Chatham 1667 Unbeschreibliche Panik entstand in London, als während des zweit englisch-holländischen Krieges Admiral De Ruyter überraschend an der Themsemündung erschien und Truppen an Land setzte. – Nach dem Gemälde von W. Schellinks.
Die Kunde vom Herannahen der Flibustier verbreitete Entsetzen. Die Verängstigten packten ihr Geld und ihre Juwelen zusammen und suchten sie in Sicherheit zu bringen, in Brunnen, in Zisternen, irgendwo. Dieses Durcheinander, das dem spanischen Gouverneur die Möglichkeit benahm, die Bevölkerung im Hauptkastell zu versammeln, wie es der Verteidigungsplan vorsah, passte trefflich in Morgans Berechnung. Er ließ seine Leute in der Stadt ausschwärmen und befahl ihnen, den Bewohnern nicht nur alles abzunehmen, was sie an Geld und Wertsachen noch bei sich führten, sondern vor allem auch „so viele Mönche und Nonnen zu ihm zu bringen, als sie deren habhaft werden könnten“ (wie der Chronist der Flibustier berichtet).
Welchen Zweck er mit dieser letzteren Maßnahme verfolgte, zeigte der weitere Verlauf. Nachdem Morgan nämlich bei einem ersten Versuch, das Hauptkastell zu stürmen, einige Dutzend seiner Leute verloren hatte – die Spanier verteidigten sich, indem sie Steine und Töpfe siedenden Öls auf die Angreifer hinabwarfen – führte er die Mönche und Nonnen ins Feld. Er ließ in aller Eile breite Leitern zimmern, auf denen drei oder vier Leute nebeneinander klettern konnten, und zwang die Klosterleute, diese Leitern zu halten.
Doch die grausame Kriegslist verfing nicht. Wohl flehten die Ärmsten von unten her den Gouverneur an, er möge das Kastell übergeben, um ihrer aller Leben zu schonen, aber der spanische Offizier wusste, was er von den Versprechungen der Flibustier zu halten hatte, und befahl seinen Leuten, weiter zu kämpfen. Nicht wenige der Mönche und Nonnen wurden von dem siedenden 01 getötet; doch schließlich gelang es, die Leitern anzulegen und sie zu erklettern. Die Spanier hatten ihre Munition verschossen, ein paar Handgranaten räumten unter ihnen auf. Die Festung war gefallen. Der Rest der Besatzung wurde getötet, die Stadt den Flibustiern zur Plünderung überlassen. Morgan sah kühl dem Treiben zu, das nun anhob; er überantwortete die Frauen und Kinder der Stadt den schändlichen Ausschweifungen seiner Leute, die sich schließlich in solchem Zustande befanden, dass, wie der Chronist meldet, „fünfzig beherzte Leute die Stadt hätten wiedernehmen und allen Piraten den Garaus machen können“. Morgan selbst nahm nicht an den Gelagen teil, er war ein kühler Rechner. Er wartete, bis seine Leute ihren Rausch ausgeschlafen hatten, und dann, ehe er sich mit ihnen wieder auf die Schiffe begab, brandschatzte er die ausgeplünderte Stadt. Die Beute, die er mit nach Jamaika führte, war stattlich genug. Jeder Flibustier erhielt etwa 10000 Mark (heutigen Wertes). Und doch war alles nur ein Vorgeschmack von dem, was Morgan noch im Sinne hatte. Er gedachte nämlich, alle Taten seiner Vorgänger im Seeräubergewerbe zu überbieten und nichts Geringeres zu erbeuten als die Stadt Panama selbst am Stillen Ozean, die bis dahin noch nie einen Engländer gesehen hatte. Wirklich fand sein Plan, den Marsch über die Landenge anzutreten und sich der sagenhaften Schätze Panamas zu bemächtigen, die Billigung des Gouverneurs, der sich davon einen weiteren Aufschwung seiner Hehlerkolonie und eine Belobigung von Seiten der Londoner Regierung versprach. Kaum hatte allerdings Morgan mit seiner Räuberflotte Kingston verlassen, da traf ein Schreiben aus London ein, das den Gouverneur nicht wenig bestürzte. Darin hieß es nämlich, es seien Verhandlungen mit Madrid wegen der endgültigen Anerkennung des englischen Handels und der englischen Kolonien in Westindien im Gange, und daher sollten bis auf weiteres keine Kaperbriefe mehr an Flibustier ausgestellt werden. Es blieb dem Gouverneur also nichts übrig, als Morgan eine Gegenorder zu erteilen. Aber die Antwort, die der Räuberhauptmann ihm zukommen ließ, vermochte wieder neue Hoffnungen in ihm zu erwecken. „Nur um Wasser, Lebensmittel oder Holz einzunehmen, werde ich auf spanischem Boden landen“, so schrieb Morgan; „dagegen werde ich keinen Spanier antasten – es sei denn, ich erhielte Nachricht, dass man von spanischer Seite einen Anschlag auf Jamaika vorhat.“
Der Gouverneur konnte zufrieden sein. „Es sei denn. . .“ Nun denn, es war nicht daran zu zweifeln, dass Morgan in der Stunde, die ihm recht schien, im Besitz einer solchen Nachricht sein würde …
So verhandelte man denn in Madrid in aller Güte und Umständlichkeit über einen endgültigen Frieden in Westindien, und der englische Botschafter versicherte, dass die Waffenruhe von Seiten seiner Regierung gesichert sei. Währenddessen aber zog Morgan mit sechshundert Flibustiern über die Landenge von Panama, um zu sengen und zu rauben.
Leicht wurde es ihnen nicht gemacht, ihr Ziel zu erreichen. Die Spanier, von Indianern über das Nahen des Feindes unterrichtet, hatten alle Stationen geräumt und alle Vorräte beiseite geschafft. Zu essen fanden die Flibustier kaum einmal etwas, und sie mussten froh sein, als sie eines Abends in einer verlassen Hütte ein paar leere Ledersäcke fanden, aus denen sie sich ein Nachtmahl bereiten konnten. Kurz: Xenophons Zehntausend können das Meer nicht mit größerer Erleichterung begrüßt haben als Morgans Sechshundert den Stillen Ozean und an seinem Rande den Turm der Kathedrale von Panama. „Alle Trompeten wurden geblasen und alle Trommeln gerührt, zum Zeichen, wie sehr sich ihre Geister wieder belebt hatten.“
Aber das Schlimmste stand ihnen noch bevor. Denn ehe sie Zeit gefunden hatten, ihre Kräfte zu sammeln, wurden sie von den Spaniern angegriffen. Reiterei und Infanterie stürmten auf sie ein, dazu auch eine Schar wilder Stiere, die die Spanier auf sie losließen. Aber das Glück war mit Morgan und seinen Flibustiern, die Stiere erschraken vor dem Musketenknallen und liefen davon; die Pferde sanken in den vom Regen durchweichten Boden ein und konnten nicht voran, und die Infanterie war den Flibustiern im Schiessen unterlegen. Nach zweistündigem Gefecht stand Morgan mit seiner, allerdings stark gelichteten Schar am Eingang der Stadt. Die Spanier, kopflos geworden, sprengten selbst das Fort in die Luft. Ein kurzer Widerstand auf dem Marktplatz – dann war Panama in Morgans Händen.
Diesmal verbot er seinen Leuten den Genus von Wein. Er sagte, die Spanier hätten ihn vergiftet. Der wahre Grund war, dass er sie nüchtern halten wollte, denn die Hauptarbeit lag noch vor ihnen: das Einbringen der Beute. Es wurde eine schwere Arbeit; als es Mitternacht vom Turm der Kathedrale schlug, flammte es an allen Stellen der Stadt auf. Die Bewohner hatten durch ihre Negersklaven die Häuser in Brand stecken lassen. Sie selbst waren geflohen, und es war nun die Sache der Flibustier, sie aus Wäldern und Bergen wieder herbeizuholen.
Tag für Tag wurden Streifen ausgeschickt und brachten Gefangene heim, bis es schließlich an die dreitausend waren. Sie mussten angeben, wo sie ihr Gold und Silber versteckt hatten, und wenn sie das nicht taten, wurden sie gefoltert. „Da wurde etwa“, erzählt der Chronist, „ein armer Kerl gefunden, der in der allgemeinen Verwirrung die Tafthosen eines vornehmen Mannes angezogen hatte, an deren Gurt ein kleiner silberner Schlüssel hing. Wie das nun die Piraten bemerkten, fragten sie ihn, wo der Schrank zu diesem Schlüssel sei. Als er darüber nichts zu sagen wusste, legten sie ihn auf die Folterbank und renkten ihm die Arme aus. Dann legten sie einen Strick um seine Stirn, an dem sie heftig zogen, dass seine Augen groß wurden wie Eier und fast aus dem Schädel fielen. Doch auch damit konnten sie ihm keine Angaben entlocken. Worauf sie ihn dann an den Armen aufhängten, ihm die Nase und die Ohren abschnitten und ihm das Gesicht mit brennendem Stroh versengten, bis er keinen Laut mehr von sich gab. Als sie nun alle Hoffnung verloren hatten, von ihm etwas zu erfahren, befahlen sie einem Neger, ihm eine Lanze durch den Leib zu rennen, womit denn sowohl sein Leben als ihr Vergnügen ein Ende fand.“
In vielen anderen Fällen muss die Folter besseren Erfolg gezeitigt haben. Jedenfalls: als Morgan nach vier Wochen Panama wieder verließ, führte er fünfundsiebzig Lasttiere mit sich, die Silber, Gold, Kirchengeräte und andere Schätze auf dem Rücken trugen, für etwa zehn Millionen Mark in heutigem Gelde. Der Gouverneur frohlockte; denn sein Anteil an der Beute machte ihn zum schwerreichen Mann. Die Flibustier aber hatten reichlich Grund zur Klage. Denn als vor der Einschiffung nach Jamaika die Lasttiere abgeladen wurden, erklärte ihnen Morgan, auf jeden holländindischen Smyrnaflotte eröffnete (1672), so konnte es ihn auch, während Frankreich gegen ganz Europa im Felde stand, unbehelligt als Kaperkrieg fortführen.

Die Landung Wilhelms III. von Oranien Durch den Oranier, der von der Plutokratenpartei der Whigs herbeigerufen wurde, am 5. November 1688 an der Westküste Englands landete und den letzten Stuartkönig Jakob IL zur Flucht zwang, wurde Holland endgültig ins Schlepptau der englischen Politik genommen. – Nach einer Miniatur von W. Schellinks.
Und als dann nach zwei Jahren das Ziel erreicht, die holländindische Handelsflotte dezimiert ist, da überlässt England es Frankreich, allein mit den Großmächten des Festlandes fertig zu werden und schließt Frieden mit Holland, das froh ist, den Kampf zur See beizulegen. Es erkauft sich die Möglichkeit, gegen Frankreich weiteren Widerstand zu leisten, mit der Preisgabe seiner Vormacht zur See.
Damals fasste also England auf Kosten Hollands, das die Position gewonnen und ausgebaut hatte, Fuß an die Guinea-Küste Westafrikas, dem Gebiete des Sklavenexports. Was Hawkins einst den Portugiesen ablisten musste, das zwang jetzt England dem in Not befindlichen Erben des portugiesischen Imperiums, Holland, durch Erpressung ab und schuf sich damit die Grundlage, auf der es in den folgenden Jahrzehnten zum Inhaber eines Monopols für Sklavenhandel, zum größten und skrupellosesten Sklavenhändler aller Zeiten werden konnte.

Die Seeschlacht bei La Hogue Nachdem Holland unschädlich gemacht worden war, wurde Ludwig XIV. von der britischen Plutokratie zum Weltfeind Nr. 1 erklärt. Mit Hilfe der Holländer gelang es, bei La Hogue 102 die französische Flotte zu vernichten. Gemälde von Benjamin West.
Die Rechtfertigung, die einst Spanien und Portugal für die Einführung der Negersklaverei hatten geltend machen können, dass es ihnen nämlich an Arbeitskräften für ihre tropischen Kolonien gebrach, konnte England nur in bescheidenem Maße für sich in Anspruch nehmen. Wie die Begebenheiten in Jamaika zeigten, lag ihm nicht gerade viel an Pflanzerkolonien, um so mehr aber an dem Handelsgewinn, den die Einrichtung der Sklaverei in sich schloss. Von dem amerikanischen Besitz der Holländer nahm es sich daher in dem Friedensschlusse von Westminster (1674) nicht die westindischen Inseln, Curacao etwa, sondern die blühende Handelsstadt Neu-Amsterdam mit ihrem Hinterland, die es allerdings schon vor acht Jahren überfallen und besetzt hatte. Die Stadt selbst, nicht nur die größte, sondern auch die einzige blühende Stadt Nordamerikas damals, wurde dem Bruder des Königs, dem Herzog von York, zum Geschenk gemacht und führte fortab den Namen New York. Auch hier also, auf dem zukunftsreichsten aller ihrer Kolonialgebiete, schufen die Engländer nichts Neues, sondern drängten sich mit Gewalt an einen gedeckten Tisch.
Nicht aus eigener Kraft hatten sie Holland niedergerungen, sondern mit der Drohung des französischen Schwertes. Und nun hatten sie sich selbst aus dem Kampfe herausgezogen – in der Hoffnung, daß auch Frankreich sich ebenso wie Holland verbluten werde.
EIN HUNDERTJÄHRIGER KRIEG
Der Kampf um Spanien
Aus dem Niedergang der spanischen Weltmacht hatte einst nicht England, sondern Holland die Kraft zum Aufstieg gefunden. Jetzt, nachdem Hollands Seemacht gelähmt war, ging zum zweiten Mal Englands Rechnung nicht auf. Vergeblich wähnte es, nun, während der Kontinent vom Kriege zerrissen wurde, unbehelligt in die Stellung der größten Überseemacht einrücken zu können.
Denn Frankreich, der Bundesgenosse, den England nach bewährter Methode im Kampfe gegen die europäische Koalition allein gelassen hatte, erlag wider Erwarten nicht, sondern stieg in diesem schweren Kampfe dank der Überlegenheit seiner Feldherren, seiner militärischen Organisation und seiner finanziellen Rüstung zur ersten Macht des Festlandes auf. Turenne, Louvois und Colbert – diese drei erhoben Ludwig XIV. zum glänzendsten Herrscher Europas. Und was für England besonders bitter war, die führenden Staatsmänner Frankreichs, vor allem Colbert, sahen nicht wie vorher noch Mazarin allein auf das Festland, sondern erkannten, dass Frankreichs Vorherrschaft in Europa ihren Rückhalt in einem starken Kolonialreich finden mußte.
Der Ausbreitung Frankreichs in Europa auf Kosten Spaniens, Hollands und des Deutschen Reiches hätte England beruhigt zusehen können, solange nur Frankreich eine kontinentale Militärmacht blieb. Es gehört zu den seltsamen Erfolgen englischer Propagandatricks, dass die Welt lange geglaubt hat, England habe sich allein um des „europäischen Gleichgewichtes“ willen seit den Tagen, da Ludwig XIV. auf der Höhe seiner Macht stand, gegen Frankreich gewandt. Auch in unseren deutschen Schulgeschichtsbüchern pflegte bis vor kurzem die Beteiligung Englands an den Kriegen im Zeitalter Ludwigs XIV., Friedrichs des Großen und Napoleons so dargestellt zu werden, als sei sie aus einem gewissermaßen schiedsrichterlichen Interesse an der gleichmäßigen Verteilung der Macht in Europa erfolgt. Die Verschiebungen im Kolonialbesitz erschienen demgegenüber als ein bloßes Anhängsel, sozusagen als eine Zugabe. In Wahrheit haben die Dinge aber jederzeit genau umgekehrt gelegen: England richtet sein Verhalten zu den europäischen Mächten ausschließlich danach ein, ob diese Mächte ihm in seinen überseeischen Interessen hinderlich sein können oder nicht. Nicht die Militärmacht, die ihren festländischen Nachbarn überlegen ist, wird, wie die Gechichte beweist, von England als Gefahr empfunden, wenn das auch zumeist von der englischen Propaganda in den Vordergrund geschoben wird, sondern diejenige Macht, die industriell und handelspolitisch eine eigene Initiative entfaltet. Die mehr als hundertjährige Gegnerschaft Englands gegen Frankreich, die, mit unwesentlichen Unterbrechungen, von 1688 bis 1815 währte, ist nur unter diesen Gesichtspunkten richtig zu verstehen. Nicht der Raub des Elsaß, nicht die Verbrennung der Pfalz, also nicht das, woran wir Deutsche zuerst denken, wenn wir den Namen des Sonnenkönigs aussprechen, war es, was England zum Feinde Frankreichs machte, sondern die handelspolitische und koloniale Aktivität, die das Frankreich Ludwigs XIV. unter Colbert und seinen Nachfolgern entfaltete.
Schon am Anfang des Jahrhunderts hatten französische Kaufleute Faktoreien in Madagaskar gegründet. 1664 nun rief Colbert die Französische Ostindienkompanie ins Leben, an der sich König Ludwig XIV. mit einem Grundkapital von dreißig Millionen Mark (heutigen Wertes) beteiligte; er stellte das Kapital zinsfrei zur Verfügung, denn er war wohl ein wirtschaftlich denkender Fürst, aber nicht ein Krämer wie Elisabeth. Bald gab es französische Faktoreien in Indien – Pondichèry vor allem (seit 1673) -, die es mit den englischen an Betriebsamkeit wohl aufnehmen konnten. Ein nicht geringer Teil des Handels wurde nach Frankreich abgelenkt; zur alten Hafenstadt des Levantehandels, gestellten sich nun die atlantischen Häfen Bordeaux deren Speicher sich mit den Produkten der mit Gewürzen, Zucker, Indigo, Kaffee und Tabak füllten. Und nicht zuletzt auch mit Baumwolle. Denn im Frankreich Colberts erstand, vom Staate organisiert und gefordert, eine vielseitige Industrie, voran die Produktion wollener und baumwollener Tuche.

John Churchill, Herzog von Marlborough – Der Vorfahr Winston Churchills, ein Feldherr von Rang, aber ein Mann von zweifelhaftem Ruf, kommandierte im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1714) die englischen Armeen auf dem Festland, die allerdings zum größten Teil aus deutschen Soldaten bestanden. Gemälde von Adriaen van der Werff.
Dies alles war schon bedenklich genug. Schlimmer aber war, dass das Frankreich Colberts auch in Amerika eine starke Aktivität entfaltete. Eine französische Kolonie an den Ufern des St.- Lorenz- Stroms, die Kolonie Kanada, bestand schon seit der Zeit Richelieus.
Nun förderte Colbert, dieser hervorragendste Wirtspolitiker seines Jahrhunderts, die Ansiedlung und die Industrie in diesem „neuen Frankreich“. In den siebziger Jahren bereits hat sich die Zahl der Kolonisten verdoppelt. Getreide-, Hanf- und Flachsfelder dehnen sich aus, Spinnräder schnurren, in den Schmieden dröhnt der Hammer, Fischerflotten fahren aus, und auf den weiten Ebenen weiden die Herden. Und zur gleichen Zeit arbeiten sich wagemutige Soldaten und Forscher von dem Gebiet der Großen Seen aus südwärts vor. Große Flussläufe werden gefunden, der Illinois, der Ohio, der Missouri und schließlich der gewaltige Mississippi selbst bis zu seiner Mündung im Golf von Mexiko. Die englischen Kolonien liegen alle an der Küste und in dem schmalen Hinterland. Kein englischer Soldat, kein englischer Forscher hat sich jemals über die Sperre der Rocky Mountains hinübergewagt, das Innere des Kontinents ist im wahren Sinne des Wortes herrenloses Gebiet. Wer kann den Franzosen das Recht streitig machen, wenn sie es jetzt für ihren König in Anspruch nehmen und es „Louisiana“ nennen? Die Engländer am allerwenigsten.
Aber ihnen ist die Aktivität der Franzosen ein Dorn im Auge; die Kette von Posten und kleinen befestigten Plätzen, die sich von den Großen Seen bis zum Golf von Mexiko erstreckt, ist ihnen unbehaglich. Es sieht doch aus, als könne der ganze Kontinent einmal französisch werden …
Es ist besonders ärgerlich für England, dass diese starke und zielbewusste Aktivität gerade in die Zeit fällt, da es gedachte, sich aus den Trümmern der holländischen Seemacht selbst die unbestrittene Weltherrschaft zu bauen. Wieder einmal ist es so gekommen, dass England in dem Wettlauf um die Reichtümer der Welt der Hase ist – und diesmal ist Frankreich der Swinegel. Darum also wird Frankreich von nun an der Erbfeind und bleibt es über ein Jahrhundert lang, bis die kontinentalen Verbündeten Englands, seine „Festlandsdegen“, ihm die Vormacht erkämpft haben.
Denn in diesem Zweikampf mit Frankreich bildet England nun jene Methode aus, die es in dem letzten Kriege gegen Holland (1672-1674) zuerst erprobt hatte: die Methode, die den direkten Angriff auf das Land des Gegners meidet und sich statt dessen der festländischen Gegnerschaften, die Frankreich aus seiner Expansionstendenz erwachsen müssen, bedient. Solange der Gegensatz der Häuser Bourbon und Habsburg die europäischen Verhältnisse bestimmt, ist es Österreich, das zugleich Englands Schlachten schlägt; dann, als Wien und Paris sich einander genähert haben, ist es Preußen – und schließlich ist es die ganze große Koalition der Mächte, die sich gegen Napoleon zusammengeschlossen hat.
Der Mann, der England diese Methode gelehrt hat, war ein Holländer, nämlich Wilhelm III., der Oranier, der 1688 dank der „glorreichen Revolution“ an die Stelle des letzten Stuart Jakob Il. getreten war. Der Oranier, Jakobs Schwiegersohn, landete zur rechten Zeit in England; die Hauptstadt erklärte sich für ihn, und Jakob musste der Krone entsagen. Damit war für alle Zukunft die Führerstellung der Monarchie in England gebrochen; das Zeitalter der Parlamentsherrschaft und damit der City- Plutokratie hob an. Der neue König aus Holland bequemte sich gern zu den Zugeständnissen, die die Macht der Krone einengten; denn für ihn, den Holländer, war England vor allem das Land, das den Ring um Ludwig XIV. schloß.
Wenn der Oranier die Eindämmung der französischen Vormacht zur Aufgabe seines Landes machte, so schwebte ihm dabei vor allem die Erhaltung der Selbständigkeit seines Vaterlandes vor. Und soweit hat seine Politik auch Erfolg gehabt. Während aber Holland, durch die Lasten des langwierigen Festlandskrieges immer mehr gedrückt, der Stärkung seiner Seemacht immer weniger Aufmerksamkeit zuwandte, konnte England seine ganze Kraft auf die überseeische Ausbreitung lenken. So wirkte der Mann, den die breite Masse in England bis an das Ende seiner Regierung (1702) als Fremden betrachtete und der auch wirklich nie aufhörte, als Niederländer zu fühlen, doch, ohne es eigentlich zu wollen, mehr zu Englands als zu seines Vaterlandes Gunsten.

Praktisches Christentum – Im Vertrag von Utrecht 1713 hatte England eins seiner wichtigsten Kriegsziele erreicht: ihm fiel das Monopol des Sklavenhandels nach Amerika zu. Während die Kassen der Plutokratie sich füllten, wurden Millionen von Negern in grausamster Weise aus ihrer Heimat verschleppt. – Zeichnung des Engländers R. Newton (1790
Während die Kassen der Plutokratie sich füllten, wurden Millionen von Negern in Als daher im Jahre 1692 die vereinigten Flotten Englands und Hollands in der großen Seeschlacht bei La Hogue die französische Kriegsmarine vernichtet hatten, schlug das vor allem zum Nutzen Englands aus. Die Folge war eine der glänzendsten Konjunkturen, die die englische Wirtschaft bisher erlebt hatte.
Das sichtbarste Zeichen dieser Konjunktur war die Gründung der Bank von England (1694), nicht einer staatlichen Bank übrigens, sondern einer Bank von Privatleuten, die am Staat verdienen wollten und auch verdienten. Denn sie trat dadurch ins Leben, dass ein Konsortium von City- Plutokraten dem Staat für die Bedürfnisse seiner Kriegführung den Betrag von 200 Millionen Mark (heutigen Wertes) vorstreckte und sich dafür „verschiedene Abgaben und Zölle, sowohl auf dem Raumgehalt der Schiffe und Boote, als auf Bier, Dünnbier und andere geistige Getränke“ verschreiben ließ.
Eine der weltgeschichtlichen Ironien, an denen Englands Geschichte so reich ist, wollte es, dass der erste „Gouverneur“, wie der Präsident der Bank von England genannt wurde, ein Franzose war, der Hugenotte Sir John Houblon. Denn wiederum stärkte damals, wie einst zurzeit, da die Wolle Englands Glück machte, ein Zustrom tüchtiger Ausländer, Franzosen und Holländer, die Leistungsfähigkeit und wirtschaftliche Wendigkeit der Handeltreibenden Kreise Englands.
Es war schon im Kampfe gegen Spanien und dann gegen Holland nicht Englands Art gewesen, mit einem Schlage die Vernichtung des Gegners anzustreben, und wenn dieser Schlag misslang, den Vergleich zu suchen. Es war vielmehr schon ein erprobtes Mittel, sich des „Friedensschlusses“ als einer zeitweiligen Waffenruhe und als einer Gelegenheit zu weiterer Rüstung und diplomatischer Vorarbeit zu bedienen. So wurde denn auch der Friedensschluss von Ryswyk (1697) von England ganz bewusst als eine Pause aufgefasst, während der es sich zu neuem Schlage stärken wollte. Denn auf die Hochkonjunktur nach der Schlacht bei La Hogue war wenige Jahre später eine schwere Krise gefolgt, die, wie die Krise am Ende der „Gründerzeit“ in Deutschland nach 1870, auf fieberhafte Überspekulation und verfehlte Kapitalsanlagen zurückging. Das Geld wurde knapp, ein Run auf ihre Schalter veranlasste die Bank von England zur Einstellung ihrer Zahlungen. Es war Zeit, bei den Verbündeten für Frieden zu plädieren. Mit der Vernichtung der französischen Kriegsmarine war ja ohnedies eins der wichtigsten Kriegsziele Englands erreicht.
Ganze vier Jahre währte der Friedenszustand, dann lieferte Ludwig XIV. der englischen Propaganda den Anlass, wieder mit vollen Segeln auf Kreuzzugsfahrt zu gehen. Karl II., der letzte habsburgische Spanier, war gestorben, und der Enkel Ludwigs XIV., Philipp von Anjou, wurde zu seinem Nachfolger aufgerufen. Das Recht auf die Erbfolge der Bourbonen war von England nicht bestritten worden; im Gegenteil, die englische Diplomatie hatte, ehe der spanische König starb, in Paris sondiert, inwieweit Ludwig der XIV. auf das Reich seines Enkels, dessen Thronfolge man ausdrücklich anerkannte, Einfluss zu nehmen gedachte, und erst als es misslungen war, ihm Zugeständnisse zugunsten Englands abzugewinnen, entdeckte man in London, dass die Vereinigung der spanischen und der französischen Krone in einer Dynastie eine große Gefahr für ganz Europa sein werde. „Europas Freiheiten sind bedroht“, so verkündete Wilhelm III. und warb für den Kreuzzug gegen den Unterdrücker der „kleinen Völker“.

Auf einem Sklavenschiff – Gegen die unwürdige, vielfach sadistischen Gelüsten entspringende Behandlung der Negersklaven regte sich selbst in England schließlich die Empörung. Doch die Vorkämpfer für Abschaffung des Sklavenhandels konnten ihr Ziel erst erreichen, als die Sklavenwirtschaft unrentabel wurde (1833)
Es mag dahinstehen, ob die Vereinigung Spaniens mit Frankreich wirklich für die Mächte des europäischen Festlandes unerträglich gewesen wäre. Am Ende des Krieges jedenfalls, der dreizehn Jahre lang unter dieser Parole in Deutschland, den Niederlanden und Italien tobte und der in den Geschichtsbüchern der „Spanische Erbfolgekrieg“ heißt, obwohl er besser der „Krieg um die spanische Konkursmasse“ benannt würde, am Ende dieses Krieges blieb es bei der bourbonischen Nachfolge in Spanien, ohne dass den „Freiheiten Europas“ daraus ein Schade erwuchs. „Dass die habsburgische Hauspolitik, soeben durch große Erfolge über die Türken in ihrer Unternehmungslust gekräftigt, diese Vereinigung nicht zugeben wollte und ihre vermeintlichen besseren Ansprüche auf den spanischen Thron geltend machte, wussten Wilhelm III. und seine Diplomaten geschickt auszunutzen. Für sie ging es ja in Wirklichkeit nicht um die Frage, ob eine Dynastie in Europa das Übergewicht erhielt (dann hätten sie auch gegen eine habsburgische Nachfolge in Spanien kämpfen müssen), sondern darum, ob von Paris oder von Wien aus stärkerer Widerstand gegen die überseeische Ausbreitung Englands zu erwarten war.
Da konnte nun kein Zweifel sein. Frankreich hatte soeben seine Leistungsfähigkeit als Kolonialmacht, sowohl was den privaten Unternehmungsgeist als was die Zielbewusstheit der staatlichen Verwaltung anbetraf, auf eine für England recht empfindliche Art bewiesen, und in Indien wie in Amerika regten sich nach wie vor französische Siedler und Kaufleute, Soldaten und Seefahrer. Unter französischer Leitung musste also das spanische Kolonialreich einen neuen Aufschwung erfahren; von Kanada bis nach Feuerland ein einziges Kolonialgebiet, nach den Grundsätzen Colberts, den Grundsätzen wirtschaftlicher Rationalität ausgenutzt, nicht starr wie das spanische System, sondern beweglich, wachsam, anpassungsfähig und außerdem gewiss nicht zu Konzessionen an England geneigt – das musste das Ende der englischen Hoffnungen auf Amerika sein. Dagegen der Erzherzog aus Wien, was brachte er nach Madrid mit, das dem verfallenden spanischen Kolonialsystem neuen Aufschwung hätte geben können? Die Wahl war nicht schwer, und die Geneigtheit in Wien, den englischen Angeboten Gehör zu schenken, ließ das Beste erwarten. Hilfstruppen zu stellen musste England allerdings zusagen. Aber das Wesentliche bewilligte der Kaiser ohne Zögern: England und Holland (auch Holland, denn noch saß ja Wilhelm III. auf dem englischen Thron) sollten alles, was ihnen während des Krieges an Eroberungen in Amerika gelänge, auch nach dem Kriege als ihr Eigentum betrachten können. So wurde Österreich der „Festlandsdegen“ für England und blieb es ein halbes Jahrhundert lang. Alle glänzenden Waffentaten, alle Siege des Prinzen Eugen konnten nicht verhindern, dass sich Österreich und mit ihm ganz Deutschland zermürbten für die Interessen Englands.
Angeblich um die Existenz Spaniens zu retten, hatte England den Krieg entfesselt. Dass aber in Wahrheit Spanien das Schlachtopfer war, zeigte schon in den ersten Jahren des Krieges eine echt englische Gewalttat, die bis heute ungesühnt geblieben ist. Man vergaß in England nicht, dass einst zu den Zeiten Elisabeths Spanien und andere Mittelmeerstaaten Miene gemacht hatten, die Straße von Gibraltar für englische Schiffe zu sperren. Das geschwächte Spanien hatte mit dieser Drohung nie Ernst machen können. Nun aber, wenn das bourbonische Doppelreich die stärkste Mittelmeermacht werden würde, musste da nicht die Schließung des Einganges ins Mittelmeer eine wirksame Waffe gegen England werden? Große Kapitalien waren in den Wollexport nach den türkischen Ländern und in die Einfuhr von Korinthen, Ölen und Arzneimitteln investiert. Der englische Levantehandel, der ja damals noch infolge der Sperre, die das Osmanenreich über den ganzen Vorderen Orient legte, vom Indienhandel getrennt war, galt mit Recht als ein starker Posten im Haushalt der englischen Wirtschaft.

Englischer Totentanz – Die Zeichnung des Franzosen Willette stammt aus den Tagen, da England grausames Vorgehen gegen die Buren überall Empörung weckte (1899). Sie trägt die Unterschrift: „An dem Tage, da das perfide Albion krepiert, wird Freude auf Erden sein.“
Um der englischen Interessen im Mittelmeer willen hatte schon Cromwell ein Auge auf den Felsen von Gibraltar geworfen. Auch in Spanien hatte es nicht an Männern gefehlt, die die Bedeutung dieses Platzes erkannten und für den Ausbau einer starken Verteidigungsstellung eintraten. „Gibraltar ist der bedeutendste Platz an den Küsten des atlantischen und mittelländischen Meeres“, so schrieb ein spanischer Staatsmann unter den letzten Habsburgern; „der Feind, der es einnimmt, kann sich zum Herrn beider Meere machen und den gesamten Handel nach dem Orient in seine Gewalt bringen.“ Trotzdem hatte die schwerfällige und lahme spanische Militärverwaltung nichts unternommen, um den wichtigen Ort zu sichern, und auch jetzt, zu Beginn des Krieges, war alles beim alten geblieben, obwohl der Kommandant von Gibraltar in Madrid dringende Vorstellungen erhob. Diese Fahrlässigkeit wog um so schwerer, als dem Felsen, der die Meerenge beherrschte, auch unmittelbare strategische Bedeutung zukam. Frankreich konnte zur See nur dann mit Aussicht auf Erfolg auftreten wenn es ihm gelang, seine Mittelmeerflotte mit der atlantischen zu vereinigen, und eben dies konnte verhindert werden, wenn sich der Gegner am Felsen Gibraltar festsetzte. Dieses aktuelle Motiv war es, das für die deutschen Generale, die dem Erzherzog den Einmarsch von Madrid erkämpfen sollten, den Ausschlag gab. An die englischen Levante-Interessen dachten sie natürlich nicht. Aber sie konnten für eine gewaltsame Landung an der spanischen Küste die Hilfe der englischen Flotte nicht entbehren, und so kam für England – Gelegenheit macht Diebe – die Stunde einer neuen Räuberei.
Es waren deutsche Truppen, die unter Befehl Landgrafen Georg von Hessen- Darmstadt am 1. August 1704 im Schutze der englischen Schiffsgeschütze die schmale Landenge, die zum Felsen von Gibraltar führt, besetzten Und nach zweitägigem Bombardement konnte man den allzu schwach befestigten Hafen einnehmen. So verstand sich von selbst, dass auf den eroberten Festungswällen deutsche Flaggen gehisst wurden, der habsburgische Doppeladler und der hessische Löwe. Die Absicht war ja, dem Erzherzog als dem rechtmäßigen König von Spanien, sein Land untertan zu machen.
Aber der englische Admiral Rooke war anderer Ansieht. Sobald der Landgraf sich fortbegeben hatte, um an einer anderen Stelle des Kriegsschauplatzes das Kommando zu übernehmen, sah die spanische Bevölkerung zu ihrem Erstaunen, wie die Fahne des Erzherzogs, ihres Königs, heruntergeholt und statt dessen die englische Flagge aufgezogen wurde. Rooke hatte Gibraltar als englisches Gebiet erklärt!
Als dann allerdings Spanier und Franzosen gemeinsam versuchten, den so leichtfertig preisgegeben Platz durch Angriffe vom Lande und von der See aus zu gewinnen, da war der Landgraf wieder nötig, um den Engländern ihre Beute zu erhalten. Deutsche Truppen sicherten in opfervollen Kämpfen den Engländern den Besitz des Felsens …
Was hingegen die englischen Besatzungstruppen bestraf, so tobten sie ihre Kampfeslust an der wehrlosen spanischen Bevölkerung von Gibraltar aus und, als wollten sie zeigen, wie sie den „Protestantismus“ verstanden, zogen sie zu dem von ganz Spanien verehrten wundertätigen Bilde der Maria mit dem Jesusknaben an der Südspitze der Halbinsel, der „Lieben Frau von Europa“, und schnitten, um die Wunderkraft des Bildes auf die Probe zu stellen, den Kopf des Jesusknaben ab.
Der Kaiser hatte den Engländern Amerika geschenkt. Sie nahmen es nicht. Sie hätten es nur nehmen können, wenn die spanischen Kolonien sich freiwillig unter englische Botmäßigkeit begeben hätten. Eine solche Losreißung Amerikas aus dem spanischen Imperium wurde auch wirklich während des Krieges von England versucht. Es ergingen Aufrufe an sämtliche Kolonisten, sie sollten sich gegen den bourbonischen König erheben und das „Joch der fremden Tyrannei“ abschütteln zugunsten des Erzherzogs von Wien, so hieß es weiter; denn über dessen Zusagen an England verlautete wohlweislich kein Wort. Aber die Kolonisten hörten nicht auf den Ruf, und so wurde das hauptsächlichste Kriegsziel Englands nicht erreicht.
Von dem Augenblick an, da das feststand, hatte England kein wesentliches Interesse an der Fortführung des Krieges mehr und schlug den Weg von Verhandlungen ein. Überdies war nach zehnjähriger Dauer des Krieges, im Jahre 1711, der Erzherzog Karl selbst Kaiser geworden, und die Wiedervereinigung der Imperien Spaniens und Österreichs in einer und derselben Hand war in London noch weniger erwünscht als die Fortdauer der Herrschaft des bequemen und leicht lenkbaren Philipp V. Die Hauptgefahr, Ludwig XIV. als Gebieter eines weltweiten überseeischen Reiches, drohte nicht mehr. Der Kampf auf dem Festland hatte alle Kräfte Frankreichs in Anspruch genommen, und bald nach Beginn des Krieges war die französische Kriegsflagge von den Ozeanen verschwunden. Mochte Frankreich immerhin auch nach dem Kriege als stärkste Macht in Europa selbst dastehen – seine Expansionskraft war gelähmt.
Auf der Höhe seiner Erfolge hatte der Sonnenkönig sich von Spanien das Monopol des Negerimports in die amerikanischen Kolonien übertragen lassen. Musste nun nicht dieses Monopol als reife Frucht des Krieges England zufallen?

Der Schwindel mit den Südsee -Aktien – Eine bezeichnende Episode aus dem Werdegang der britischen Plutokratie: alle Schichten der Gesellschaft stürzen sich auf die Aktien der „Südsee- Gesellschaft“. Die Gründer dieses Schwindelunternehmens lockten die Käufer mit Hoffnungen auf Raubzüge in Amerika und märchenhafte Gewinne. – Gemälde von E. W. Ward.
So geschah es in der Tat. Durch einen großherzigen Verzicht auf koloniale Abtretungen erreichten die politischen Sachwalter der City von London, daß Spanien im Friedensschluss von Utrecht (Juli 1713) England das begehrte Monopol zusprach. Was Hawkins einst als Schmuggel begonnen, war jetzt legaler Handel geworden. Das Ansehen Englands bei den Negerhäuptlingen, die für die City auf Sklavenjagd gingen, hob sich mehr und mehr. Die Westküste Afrikas war englische Domäne geworden.
Dass aber Englands Freude am Schmuggel nicht zu kurz kam, dafür sorgte eine andere Bestimmung des Utrechter Vertrages. Danach erhielt nämlich England von Spanien die Erlaubnis, einmal im Jahre mit einem so genannten „Freischiff“ (das, also keiner besonderen Lizenz bedurfte) von fünfhundert Tonnen nach Puerto Bello zu fahren und dort Waren für die spanischen Kolonisten zollfrei zu verkaufen. Die Engländer wären nicht Engländer gewesen, bitten sie nicht bei dem Abschluss dieses Vertrages schon gewusst, wie sich dieser Handel mit dem Freischiff in der Praxis gestalten würde.

König Georg I. (1714-1727) – Er übernahm das Präsidium der auf Betrug aufgebauten „Südsee- Gesellschaft“ und entfesselte damit eine allgemeine Spekulationswut. Als das Schwindelgebäude zusammengebrochen war, entging er nur mit Mühe einem peinlichen Gerichtsverfahren. – Stich von Bernard Picart.
Wehe den Spaniern, wenn sie sich unterfingen, nachprüfen zu wollen, ob das Schiff nicht am Ende tausend Tonnen und mehr fasste oder ob es nicht in den Häfen, wo es vor Anker ging, immer neue Warenladungen an Bord nahm. Solche unziemliche Neugierde musste ein Kriegsfall werden …
Das war die Beute, die England aus der spanischen Masse erhalten konnte, und um ihretwillen ließ es den Kaiser, die deutschen Fürsten und das spanische Volk, für dessen Befreiung es in den Krieg gezogen war, kurzerhand im Stich, allen Verträgen, die es bei Kriegsausbruch feierlich besiegelt hatte, zum Trotz. Damals war es, dass deutsche Enttäuschung das in Frankreich geprägte Wort vom „perfiden Albion“ zum ersten Male sprach. Selbst ein so offiziöses Werk englischer Kulturpropaganda wie die „Encyclopedia Britannica“ muss heute zugeben, dass das „gewissenlose Verlassen seiner Verbündeten auf dem Schlachtfeld einen Makel auf dem guten Namen Englands hinterließ“ – wobei es in echt englischer Selbstgerechtigkeit die Voraussetzung unterschiebt, als erfreue sich England in aller Welt sonst eines „guten Namens“. So war denn doch der Gewinn, den England aus dem Kampf um Spanien davongetragen hatte, nicht gering zu veranschlagen. In die spanische Sperre um den Amerikahandel war eine breite Bresche gebrochen, und die portugiesische war gar ganz niedergerissen worden. Denn Portugal hatte sich im „Spanischen Erbfolgekrieg“ aus Sorge, von Frankreich erdrückt zu werden, auf die Seite des Erzherzogs geschlagen, und das hieß: es war Englands Verbündeter gegen Spanien geworden. Dieses Bündnis, also der Schutz der portugiesischen Handelsschiff-Fahrt durch die englische Flotte (denn als Seemacht hatte Portugal nicht mehr mitzusprechen), kostete die Lissaboner Regierung einen Handelsvertrag mit England (1703), der nach dem geschäftstüchtigen englischen Diplomaten, der die Verhandlungen führte, der „Methuen- Vertrag“ heißt. Danach hob Portugal die Zölle auf den Import englischer Wollwaren ganz auf, wofür allerdings England die Zölle auf portugiesischen Wein stark herabsetzte, zum Nachteil der französischen Weine. Dieses Monopol auf die Versorgung der englischen Plutokratie mit Portwein führte zu einer bedenklichen Ausdehnung der portugiesischen Weinkulturen auf Kosten des Ackerlandes. Portugal büßte seine wirtschaftliche Autarkie ein und wurde von England abhängig, ja, es wurde wirtschaftlich und in entscheidenden Stunden auch politisch geradezu ein Teil des britischen Imperiums. Vor allem aber öffnete sich durch den Methuen-Vertrag Brasilien dem englischen Handel. Auch gegenüber Frankreich verzichtete England für diesmal auf den Raub größerer Gebiete. Die Schleifung der Festungswälle von Dünkirchen an der Kanalküste, die Übertragung der Souveränitätsrechte von Akadien (seitdem Neu-Schottland genannt) und der Landstriche an der Hudson-Bai im äußersten Norden Amerikas – das waren die scheinbar bescheidenen Zugeständnisse, die Ludwig XIV. zu machen hatte. Dennoch waren sie von großer Tragweite. Das bedeutete die endgültige Ausschaltung Frankreichs aus der Nordsee, das andere die Einnistung englischer Pelzjäger in den Waldgebieten um Kanada.
Kanada und Indien
Die Koalitionsmethode, die Wilhelm III. in die englische Politik eingeführt, hatte im „Spanischen Erbfolgekrieg“ ihre erste große Probe glänzend bestanden. Nicht nur Spanien selbst, Kampfpreis und Schlachtopfer zugleich, hatte seine europäischen Außenstellungen (Italien und die südlichen Niederlande) verloren und war zermürbt; auch das Deutsche Reich, Frankreich und die Niederlande waren von dem langen Kriege erschöpft. England allein pflückte die Früchte eines Sieges, der es wie stets vorher und nachher nicht viele Opfer gekostet hatte; denn nur 18.000 gebürtige Engländer hatten im Feld gestanden – neben 90.000 Niederländern und weit über 100.000 Kaiserlichen. Kein Wunder, dass die nun anhebende Friedenszeit in England allgemein als ein goldenes Zeitalter begrüßt wurde. Unzählige neue Unternehmungen zur Erschließung überseeischer Gebiete traten ins Leben, und die City-Magnaten verstanden es, auch den kleinen Mann mit dem Gründungsfieber zu infizieren. Der Dividendensegen prasselte nur so herab, und Tausende sahen sich zu ihrem freudigen Staunen in der Lage jener wackeren Mrs. Mary Butterworth, deren Brief an einen guten Freund auf die Nachwelt gekommen ist: „Ich weiß nicht, wie es zugeht, denn das geht über meinen Verstand; jedenfalls soll sich binnen kurzem der Wert meiner Anteile verdreifachen, ohne dass auch nur einen Pfennig zuzahle …“
Natürlich blieb auch diesmal, wie es sich bei jeder Gründerzeit gehört, der Krach nicht aus. Er lebt in der Geschichte unter dem Namen „Südsee-Schwindel“ fort, und wenn es sich dabei auch im Grunde um höchst interne schmutzige Wäsche Englands handelt, die den anderen Völkern nur ein Lächeln ablocken könnte, so zeigt er doch, dass auch in dieser Zeit, wo England schon eine veritable Großmacht war, die Parole des Seeraubs noch immer imstande war, das Geld aus den Truhen hervorzulocken. Denn während der Schotte John Law, der gleichzeitig in Frankreich ein verhängnisvolles Gründungsfieber entfachte, die fiktiven Werte, auf die er seine Notenbank basierte, doch wenigstens in den französischen Besitzungen Indiens und Amerikas ansiedelte und also den kleinen französischen Sparer doch immerhin nur auf die Ausbeutung von Ländern lüstern machte, die Frankreich bereits gehörten, so warb die Londoner „Südsee- Gesellschaft“ die Leute mit Aussichten auf fremdes Eigentum. Denn die „Südsee“ (es war ebenso wohl der südliche Atlantik wie der südliche Pazifik, besonders in seinem amerikanischen Teil, gemeint) gehörte ja nun, wie England im Vertrage von Utrecht feierlich anerkannt hatte, Spanien. Auf das „Faustrecht jenseits der Linie“ hatte die englische Regierung ausdrücklich Verzicht geleistet, um Sklavenmonopol und Freischiff dafür einzuhandeln. Und nun wurde zur Zeichnung von Aktien aufgerufen für eine Gesellschaft, deren Zweck darin bestand, den Spaniern ihre südamerikanischen Kolonien fortzunehmen oder doch durch Einbrüche in diese Kolonien hohe Gewinne zu erzielen!
Als Gouverneur dieser Gesellschaft, die mit einem Kapital von 160 Millionen Mark heutigen Wertes sogar die Bank von England in den Schatten stellte, fungierte kein Geringerer als seine Majestät König Georg I. Deutlicher hätte sich kaum noch demonstrieren lassen, dass das durch Beschluss des Parlaments geschaffene Königtum ein Aushängeschild für die City-Plutokraten war! Immerhin waren weder der König noch die Finanzmagnaten unvorsichtig genug, es wirklich mit einem Raubzug auf die spanischen Kolonien à la Drake oder Morgan mitten im Frieden zu versuchen. Diese schönsten Zeiten der feucht-fröhlichen Seeräuberei waren jetzt vorüber, denn es gab nun keine getrennte Buchführung mehr für die europäischen und die kolonialen Angelegenheiten. Die Weltpolitik hatte ein anderes, wesentlich einheitlicheres Gesicht bekommen: ein Konflikt in Amerika musste jetzt auf Europa zurückwirken, ja im Grund sogar in Europa ausgetragen werden. Ganz so leichtfertig wie es sich vielleicht die wackere Mrs. Butterworth vorstellte, konnte England nun nicht mehr in der „Südsee“ operieren, und darum musste auch die Leitung der Bank, als ihr nach einigen Jahren eine Verdoppelung des Grundkapitals angezeigt erschien, Gerüchte im Lande verbreiten, wonach Spanien bereit sei, einen Teil von Peru an England abzutreten. An allen diesen Gerüchten war kein wahres Wort. Weder so noch so wurde die „Südsee“ wirklich zum Operationsfelde der Gesellschaft gemacht – das Ganze war ein reines Schwindelmanöver der City, das den Zweck hatte, die Staatsschulden aufzukaufen und sich dafür wichtige Abgaben in die Hand spielen zu lassen.
Diesmal also stand die Seeräuberei auf dem Papier, und das eigentliche Ziel war, den Staat selbst zum Geschäftsobjekt zu machen. Als dann allerdings die wirklichen Absichten der Südsee-Gesellschaft im Parlament bekannt wurden, schreckte das die Zeichner der Aktien keineswegs ab. Sollte die Gesellschaft sich ruhig erst am Staate bereichern – umso stärker konnte sie ja dann in der Südsee auftreten.

Das Rattenbeißen – Die Rohheit des englischen Volkscharakters erweist sich an dem sadistisch-grausamen Spiel mit Tieren, wie es in Gestalt der Fuchsjagd noch heute beliebt ist. Lange Zeit war das „Rattenbeißen“ ein verbreitetes Vergnügen: der Hund, der in der kürzesten Zeit die meisten Ratten totbeißt, erhält einen Preis. – Holzschnitt aus der französische Zeitschrift „Le Monde Illusirg“ (1870).
Die Kurse stiegen auf 300, 400, 800, ja schließlich auf 1200 Prozent. Grundeigentümer verpfändeten Haus und Hof, Damen ihre Kleider und ihren Schmuck, um die zauberträchtigen Aktien zu erwerben, und wer nicht genügend Mittel hatte, eine zu erstehen, der begnügte sieh gern damit, Aktionär irgendeiner anderen Gesellschaft zu werden; denn wenn nur erst die Südsee anfing, ihre märchenhaften Schätze über England auszuschütten, dann mussten ja auch alle anderen Unternehmungen florieren. Da gab es denn keinen Marktschreier und keinen Jobber, der nicht sein dankbares Publikum gefunden hätte. Einer gründete eine Gesellschaft, um Salzwasser süß zu machen, ein anderer, um den Whisky zu verfeinern. Esel sollten angeblich aus Spanien eingeführt, Abtritte praktischer gereinigt und Sägespäne geschmolzen werden. Die abenteuerlichsten Versicherungsgesellschaften taten sich auf, darunter auch eine, in der die weibliche Keuschheit das Versicherungsobjekt war. Den Höhepunkt des Schwindels aber erreichte doch wohl jener Findige, der die Gründung einer Gesellschaft „zur Ingangsetzung eines Unternehmens, von dem aber niemand erfahren wird, worin es eigentlich besteht“, ankündigte und fortfuhr: Jeder Zeichner einer Aktie von zwei Pfund Sterling soll das Recht erhalten, jährlich hundert Pfund Sterling Dividende zu beziehen.“ Innerhalb von fünf Stunden hatten sich tausend Zeichner gefunden, worauf der Biedermann seine Bude dicht machte und sich einen neuen Trick ausdachte. Der Südseegesellschaft und ihrem königlichen Gouverneur waren, wie sich denken lässt, diese neuen Konkurrenten wenig angenehm. Man sann Mittel, wie man diese „Blasen“ (bubbles) – so nannte man sie – zum Platzen bringen könne. Aber als man dann schließlich mit Hilfe des Parlaments erreicht hatte, dass die Aktienkurse der kleinen Gesellschaften auf den Nullpunkt sanken, da war es auch um das eigene Unternehmen geschehen. Das Vertrauen sank von einem Tag auf den andern, es dauerte nicht lange, dann wurden die Aktien, die des Königs Majestät selbst gutgesagt hatte, zu Altpapierpreisen gehandelt. Mit den kleinen war auch die ganz große Blase geplatzt – das Phantom, Südsee löste sich in Nebel auf …
Und dabei hätte man doch das Silber aus Peru so gut gebrauchen können! Denn die Ostindiengesellschaft klagte immer wieder darüber, dass sie Schwierigkeiten hatte, für die Gewürze, die Baumwolle und vor allem für den zur Pulverbereitung so nötigen Salpeter die rechte Gegenleistung zu bieten. Englische Wolle war nun einmal nach wie vor im heißen Indien kein begehrter Artikel, und so musste man mit dem zahlen, was die indischen Verkäufer am dringendsten verlangten: mit Silber. Nach der Auffassung der Zeit musste es aber das Ziel jeder staatlichen Wirtschaft sein, mehr Waren zu exportieren als zu importieren, nicht aber die Einfuhr mit barem Gelde zu bezahlen. Ja, wenn man das Silber direkt aus Amerika nach Indien bringen könnte, wenn also die spanischen Kolonien den englischen Import aus Indien bezahlen würden!
Ein gewichtiger Grund mehr also, um des Friedens von Utrecht leid zu werden und auf eine Wiederaufnahme des Kampfes mit Spanien zu hoffen. Wie, wenn die Spanier doch eines Tages an den verdächtigen Praktiken mit dem englischen „Freischiff“ Anstoß nehmen würden? Und siehe da, die Spanier nahmen Anstoß. Der König in Madrid hatte den Engländern den Raub Gibraltars nicht vergessen, und noch weniger, dass sie seit Utrecht zu mehreren Malen das Versprechen, ihm den Felsen zurückzugeben, gebrochen hatten. Die Regierung, durch innere Reformen gekräftigt, fühlte sich stark, den Engländern zu trotzen, und begann, den englischen Schmuggel in Westindien etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
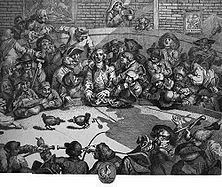
Der Hahnenkampf
Auch der Hahnenkampf galt in England früher als „königlicher Sport“ – so genannt, weil die Krone Abgaben von den Veranstaltern bezog. Hier tobte sich auch die in England unausrottbare Wettleidenschaft aus. – Stich von William Hogarth..
Ein Geschwader von Küstenwachtschiffen wurde mit der Kontrolle der amerikanischen Gewässer betraut, und das „Freischiff“ musste sich von nun ab vor seiner Abfahrt aus London erst mit allerlei Papieren versehen, die der spanische Botschafter nur nach genauer Besichtigung von Schiff und Ladung ausstellte. Die Zollwächter in den amerikanischen Küstenplätzen erhielten Anweisung, alle englischen Schiffe zu durchsuchen – kurz, Spanien trat in jeder Weise dem guten Namen und der Ehre Englands zu nahe. Die City schrie nach Vergeltung. Doch unbegreiflicherweise wollte der Chef der Regierung, Sir Robert Walpole, selbst ein skrupelloser Geschäftsmann, aber einer, der politisch seinen eigenen Kopf hatte, im Augenblick von einem Kriege nichts wissen. Das Parlament schwankte. So blieb denn den Plutokraten nichts übrig, als dem Unterhaus handgreiflich zu demonstrieren, was für unerhörte Verhältnisse in Westindien durch spanische Misswirtschaft und Brutalität eingerissen seien.
Der Zeuge, den sie zu diesem Zweck vor den Schranken des Hauses erscheinen ließen – Kapitän Jenkins war sein Name -, war im buchstäblichen Sinne des Wortes ein Ohrenzeuge. Er erzählte zunächst in bewegten Worten, wie sein ehrbares Fahrzeug auf offener See vor Jamaika von einem spanischen Kaperschiff angehalten, seine Besatzung gefoltert, er selbst an einer Rahe festgebunden und beinahe erhängt worden sei. Dann präsentierte er vor aller Augen das Ohr, das ihm die Spanier schließlich – unter gräulichen Verwünschungen gegen Seine Majestät von Großbritannien – abgeschnitten hätten. Er zog es, in Baumwolle verpackt, aus seiner Tasche und ließ es im Hause herumreichen. Es war ein Anblick, der die sehr ehrenwerten Parlamentsmitglieder erstarren ließ. Heftige Worte gegen den allzu nachgiebigen Premierminister wurden laut. Und nicht lange, dann hallte die ganze Insel wider vor Entrüstung über die einem ehrlichen englischen Seemann angetane Schmach. Lieder flogen von Mund zu Mund, und von Plymouth bis zu den Orkney-Inseln gab es nur eine Parole: Vergeltung für die schändliche Behandlung, die Jenkins‘ Ohr widerfahren war.
Erst als der Krieg schon lange entbrannt war, geschah es, dass der zollfreie Portwein dem Mitgliede des Unterhauses, auf dessen Veranlassung Jenkins seinen Bericht abgestattet und sein Ohr vorgezeigt hatte, die Zunge löste. Das Erfreulichste an der ganzen Sache sei gewesen, so sagte er und lachte sich dabei noch nachträglich ins Fäustchen dass keiner im Hause so neugierig gewesen war, die Perücke des alten ehrlichen Seemanns zu lüften. Denn dann würde man gesehen haben, dass er unter der Perücke seine beiden Ohren unversehrt am Kopfe hatte …
So hatte also Jenkins‘ Ohr seine Schuldigkeit getan. Wenn auch Walpole noch versuchte, zu widerstreben er musste Spanien den Krieg erklären (Oktober 1739). Diesmal nun sollte es aufs Ganze gehen. Man wollte gleich das Herz des spanischen Kolonialreiches treffen: die Hafenstädte an der Landenge von Panama. Von hier fuhren die spanischen Silberflotten aus, hier hatte Spaniens amerikanisches Reich seine verwundbarste Stelle. Eine große Streitmacht wurde also aufgeboten. Mit 115 Schiffen, 15.000 Matrosen und Seesoldaten und 10.000 Mann Landungstruppen wurde Admiral Vernon ausgeschickt, Amerika zu erobern. Während er auf Morgans Spuren Panama zustrebte, sollte ein anderer Admiral, Anson, als Erbe des Drakeschen Ruhmes die spanischen Silberflotten im Stillen Ozean erbeuten.

Ausmarsch englischer Truppen – Unbarmherzig wird die Verwilderung der englischen Armee gegeißelt, die 1745 zur Abwehr des in Schottland gelandeten Stuart-Prätendenten auszog. Nach dem Siege über ihn bei Culloden tobte sich ihre Blutgier gegenüber den Anhängern des Geschlagenen aus. – Gemälde von William Hogarth.
Aber nun, wo es zum ersten Mal ein offener Kampf war, fiel das Gottesurteil gegen England aus. Zwar wurde Puerto Bello, der Schauplatz von Morgans erster Ruhmestat, genommen; aber der Angriff auf das wichtigere Cartagena misslang völlig, und auch Kubas Hauptstadt Santiago hielt stand. Die Spanier waren eben doch nicht solche Schwächlinge, wie man es sich in den Londoner Kaffeehäusern vorgestellt hatte und die Küstenflotte, die gebaut war, um den englischen Handel zu kontrollieren, leistete jetzt als Kaperflotte Dienste, die in der City sehr unangenehm auffielen. Der englische Handel mit Amerika, der durch den Sieg erst recht in Blüte kommen sollte, war nun völlig unterbrochen. Und was Anson betraf, so war er weit entfernt davon ein echter Nachfolger Drakes zu sein. Nur eins von seinen sechs Schiffen erreichte die Heimat wieder, und wäre es ihm nicht kurz vor dem Aufbruch zur Heimfahrt gelungen, eine mit Silber von Peru nach Manila segelnde Galeone zu kapern, so hätte er mit leeren Händen heimkehren müssen. So allerdings trösteten zweiunddreißig Wagenladungen mit Silberbarren, die ihren feierlichen Einzug in London hielten, die City ein wenig über den jämmerlichen Fehlschlag des Unternehmens – des größten, das England je gegen Amerika angesetzt.
Während noch Vernon vergeblich die mittelamerikanischen Häfen berannte, trat ein Ereignis ein, das in London große Bestürzung hervorrief: Frankreich griff in den Seekrieg ein. Damit hatte man nicht gerechnet: denn der Leiter der französischen Politik, der Kardinal Fleury, galt mit seinen neunzig Jahren nicht mehr als ernst zu nehmender Gegner auf diplomatischem Felde, und noch viel weniger traute man ihm starke Außenpolitik zu. In Wirklichkeit hatte aber Fleury den spanisch-englischen Konflikt mitverfolgt und stellte sich nun im ungünstigen Augenblick für England an Spaniens Seite. Es half jetzt nichts, dass man die französischen Kaperschiffe, die dem englischen Handel das Leben schwer machten, der Piraterie beschuldigte und überhaupt versuchte, den Spieß umzudrehen, die letzte Stunde des englischen Amerikahandels schien geschlagen zu haben. Frankreich und Spanien gemeinsam als Herren Amerikas – was sollte da aus dem Indienhandel werden, was aus den Pelzjägern an der Hudsonbai, was aus der Londoner Plutokratie?
Schon waren die französischen Flotten, deren Vereinigung auch der Felsen von Gibraltar nicht hatte verhindern können auf der Fahrt nach Amerika, schon sanken die Kurse auf der Londoner Börse in beängstigende Tiefen, da brachte in zwölfter Stunde ein unerwartetes Ereignis England die Rettung. Kaiser Karl VI., der letzte Habsburger, starb, ganz überraschend (Oktober 1740), und eine Anzahl von Mächten machte seiner Tochter Maria Theresia die Nachfolge in ihren Erblanden streitig. Zu diesen Mächten gehörte auch Spanien, dessen Königin und eigentlich Regentin, Elisabeth Farnese, den Gewinn Mailands höher schätzte als die Erhaltung des amerikanischen Imperiums. Schon dies war eine Entlastung für England. Noch stärker aber atmete man in der City auf, als bekannt wurde, dass auch Frankreich sehr gegen die Neigung des Kardinals Fleury, der in England den Hauptgegner sah, in den Krieg eintrat, um die habsburgische Hausmacht verkleinern zu helfen. Es war, wie man in London sogleich erkannte, ein entscheidender Fehler der französischen Politik, der die Schlagkraft Frankreichs in Übersee lähmen musste. Um Böhmen für Bayern, Mähren für Sachsen, Schlesien für Preußen und die Lombardei für Spanien zu gewinnen, ließ Frankreich den sicheren Sieg gegen England aus der Hand!
In London begriff man sofort, wie dieser Fehler auszunutzen war: alles verfügbare Kapital musste in den Festlandskrieg investiert werden, damit Frankreich und Spanien die Hände gebunden wurden! Möglichst wenig selbst kämpfen, dafür aber die Feinde des Feindes, mit einem verlogenen Worte die „Verbündeten“ genannt, mit den Überschüssen aus dem Überseehandel zu unterstützen, das wurde nun das englische Prinzip. Die unkluge Wendung der französischen Politik gab England die große Entdeckung ein, die es von nun ab in den eisernen Bestand seiner Methoden aufnahm: der Krieg als Fortsetzung des Geschäfts mit anderen Mitteln. In Wien, in Mainz, in Köln, in Darmstadt, in Turin arbeitete das englische Geld. Frankreich wurde gezwungen (es klingt erstaunlich gegenwartsnah), alle seine Kräfte, für eine Zerstückelung Deutschlands einzusetzen.

William Pitt der Ältere (1708-1778) – Pitt entstammte einer Familie, die in Indien Reichtümer gesammelt hatte, und wurde der unbeugsame Verfechter einer hemmungslosen Ausbreitung der britischen Macht. Von ihm stammt der klassische Ausspruch: „In Deutschland haben wir Kanada erobert.“ Stich von R. Hodgson.
Je länger der Krieg sich hinzog, desto aufreibender wurde er für Frankreich, desto mehr war England entlastet. Die in Subsidien angelegten Gelder, die in die Milliarden gingen, trugen dann nach Friedensschluss ihre Zinsen in Gestalt eines erweiterten Handelsvolumens.
Die englische Rechnung ging auf. Es half den Franzosen nichts, dass ihre Kolonialtruppen in Amerika wie in Indien den Engländern überlegen waren, dass sie von Kanada aus Neuschottland zurückeroberten und Madras einnahmen – Maria Theresia und die Reichsfürsten, Spanien und Sardinien besorgten die englischen Geschäfte so gut, dass Frankreich nach achtjähriger Dauer des Krieges froh war, die Partie remis geben zu können. Und das hieß: es gab alle seine kolonialen Eroberungen wieder heraus.
England konnte sich in diesen Friedensschluss von Aachen (1748) um so getroster einlassen, da es ihn lediglich als eine kurze Pause betrachtete, in der es seine maritime Rüstung steigern konnte, während es Frankreich dauernd unter dem „Alpdruck der Koalitionen“ gefangen hielt. Ein Meister in diesem doppelten Spiel trat damals an die Spitze der englischen Regierung: William Pitt, selbst ein schwerreicher Mann, Erbe eines jener „Nabobs“, die an indischen Gewürzen und indischer Baumwolle ihr Vermögen gemacht hatten, und ein echter Sohn der City. Aber er stand turmhoch über dem Durchschnitt; zu seiner unwiderstehlichen Energie, seiner hinreißenden Redegabe gesellte sich ein Organisationstalent, wie es England seither nicht wieder gesehen hat. Er war auch einer der seltenen Männer, die den frommen Augenaufschlag, den „Cant“, verschmähten und dem rücksichtslosen Machtwillen der Plutokratie, deren Repräsentant er war, unverblümten Ausdruck gaben. Großbritannien muss allein die Sonne unseres Planetensystems sein“ – das waren Bilder, wie er sie liebte. Den lieben Gott und die Humanität ließ er ungeschoren – für einen Engländer bedurfte es nach seiner Ansicht keiner Begründung, dass England die Weltherrschaft gebühre. Auf dem Kontinent sollte das englische Geld arbeiten; Englands Manneskraft so verkündete er immer wieder, gehöre der See. Keine Expeditionsarmeen, „die Flotte ist unser Heer“.
Diesem zielbewussten, brutalen Willen hatte Frankreich nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Seine Grenzen waren verwundbar; es konnte nicht seine ganze Kraft auf die Kolonien konzentrieren. Und dazu kam, dass die öffentliche Meinung in Paris nicht wie in England von der Geschäftswelt und ihrem politischen Organ, dem Parlament, gemacht wurde, sondern von den Salons, in denen die „Philosophen“, die Schriftsteller der Aufklärung, das Wort führten. Denen aber galten die kolonialen Bemühungen wenig; sie hielten Kanada für eine Schneewüste und verspotteten mit viel Erfolg die Regierung, die sich anstrengte, die überseeischen Besitzungen zu halten. Nur eine Ausnahme machte Voltaire, der einflussreichste unter ihnen, bei der Beurteilung überseeischer Besitzungen: die Zuckerplantagen in Westindien, denn hier war er Aktionär. So war der Kampf um Kanada und um Indien schon entschieden, noch ehe er ausbrach.

Habana Die Hauptstadt der spanischen Kronkolonie Kuba war oftmals das Ziel englischer Raubüberfälle. Noch im Jahre 1762 wurde sie von einer britischen Flotte überrumpelt und besetzt. Doch vermochte England den Raub nicht festzuhalten. – Nach einem alten holländischen Stich.
Vorwände, den Krieg vom Zaun zu brechen, gab es genug. Da waren die immer noch ungeklärten Grenzen zwischen Neuschottland und Kanada, da waren die Reibereien zwischen den Pelzjägern, da waren Zwistigkeiten in Indien. Trotzdem, man hielt es in London nicht einmal für nötig, Paris vom Beginn des Krieges in Kenntnis zu setzen, sondern verfuhr einfach so, als herrsche immer noch das Faustrecht jenseits der Linie“. Der Angriff auf Kanada wurde im Frieden eröffnet, und ein groteskes Vorkommnis unterstrich dabei den frechen Übermut der Engländer. Drei Schiffe eines französischen Geschwaders nämlich, das zur Sicherung des St. Lorenz-Stromes von Brest angefahren war, gerieten bei den Bänken von Neufundland zwischen englische Schiffe. Zur Verblüffung des französischen Kommandanten eröffneten die Engländer das Feuer. Da er seinen Ohren nicht trauen mochte, nahm der Kommandant das Sprachrohr und fragte zweimal zu den Engländern hinüber: „Sind wir im Frieden oder im Krieg?“ Und vom nächsten englischen Schiff klang es durch das Sprachrohr zurück: „Im Frieden! Im Frieden!“ Dann aber vergaß der Engländer, das Sprachrohr rechtzeitig vom Munde zu nehmen; denn man hörte ihn auf den französischen Schiff en noch laut und vernehmlich „Feuer!“ kommandieren, ein Befehl, der sofort befolgt wurde. Nur eins von den französischen Schiffen entkam, die andern wurden genommen.
Und nun ging der Krieg mitten im Frieden fröhlich weiter. Die französischen Bewohner Neuschottlands, deren Vorfahren einst das Land gerodet hatten, wurden kurzerhand aus ihren Häusern verschleppt und zu Schiff in die westindischen Tropen deportiert. Alle erreichbaren französischen Handelsschiffe im Kanal und im Atlantik, dreihundert an der Zahl, wurden angehalten und ihre Besatzungen unter Androhung der Todesstrafe gezwungen, in der britischen Marine Dienst zu tun. Alles, wie gesagt, ohne jede Kriegserklärung, gegen alles Herkommen, alles Völkerrecht und allen Anstand. Aber der Zweck war erreicht: Frankreich konnte seine Flotte nicht mobil machen.
Inzwischen ging das diplomatische Spiel auf dem Festland weiter. Österreich war im letzten Kriege ein zu schwacher Helfer für die englischen Interessen gewesen; es hatte die französischen Kräfte nicht genügend gefesselt. Hingegen hatte sich Preußen unter König Friedrich als die stärkste Militärmacht Europas gezeigt. Diesen Verbündeten Frankreichs matt zu setzten musste also das Ziel Londons sein. Es gelang mit Hilfe der neuen Großmacht Russland, die England jetzt zum ersten Male in sein System einer ständigen Beunruhigung Europas hineinbezog. Denn der Drohung mit einem gemeinsamen englisch-russischen Angriff auf Preußen wich König Friedrich aus. Er versuchte, sich durch einen Vertrag mit London seine Neutralität zu sichern, und entfremdete sich eben dadurch, wie man in England gehofft hatte, seinen französischen Verbündeten, der nun bei dem alten Gegner Österreich Anlehnung suchte. So kam es in dem nun ausbrechenden „Siebenjährigen Kriege“ zu der „Umkehrung des Allianzsystem“: Preußen mit England, Österreich mit Frankreich. Russland schwenkte zwar, die. was die festländischen Fragen betraf, mit Österreich und Frankreich in die antipreußische Linie ein, blieb aber gleichzeitig in dem englisch-französischen Konflikt neutral, so dass die englische Kriegführung von dieser Seite aus nicht behindert wurde.
So hatten die Engländer diesmal einen Vorsprung in der überseeischen Kriegführung. Wenn ihnen auch Landungsversuche in der Bretagne schmählich misslangen (sie mussten sich so eilig wieder zurückziehen, dass der junge Herzog von Marlborough sein Essbesteck liegen ließ, das ihm der französische Gouverneur mit einem ironischen Schreiben nachsandte), so konnten sie doch die französischen Küsten erfolgreich blockieren. Die französischen Flotten, unzureichend bemannt, lagen untätig in den Heimathäfen, und die Kolonialtruppen in Kanada und Indien erhielten – keine Verstärkung. Darum war es nur eine Frage der Zeit, dass beide Gebiete den Engländern zufielen, vorausgesetzt dass es gelang, den Krieg auf dem Festland entsprechend lange hinzuziehen. Und das gelang – dank König Friedrichs Feldherrngenie und seinem heldenmütigen Widerstand gegen die überlegenen Kräfte dreier Großmächte.

Lord Clive (1725-1774) – Durch geschicktes Ausnutzen der inneren Gegensätze in Indien gelang es Clive, der seine Laufbahn als Schreiber bei der Ostindien-Kompanie begonnen hatte, das Reich des Großmoguls zu zerschlagen und damit den Grund zur englischen Zwischenherrschaft über Indien zu legen. – Stich von Miss Jane Drummond.
Er hielt England die Bundestreue und folgte keinen Verlockungen zu einem Sonderfrieden. Als aber Kanada und die wichtigsten Plätze Indiens gefallen waren (jenes 1759, diese 1761), da hatte England genug vom Kriege. So wenig wie einst im „Spanischen Erbfolgekrieg“ kümmerte es sich noch weiter um das Schicksal seiner festländischen Verbündeten, sobald es selbst sein Schäflein im Trockenen hatte. Zwar William Pitt fühlte die Verpflichtung des gemeinsamen Durchhaltens bis ans Ende, schon mit Rücksicht auf die zukünftige Bündnisfähigkeit Englands. Aber es zeigte sich, dass Pitt nicht England war, sondern vielmehr einer der seltenen Männer, die im Denken und im Charakter über das für England tragbare Durchschnittsmaß hinausgewachsen sind und daher von ihrem Lande, sobald sie ihm unbequem sind, wie ein Fremdkörper wieder ausgeschieden werden. Die City fand, dass man für den Augenblick nicht mehr verlangen konnte, und setzte ihren Willen, das Geschäft erst einmal zu liquidieren, mit Erfolg durch. Im Februar 1761 war Pondichèry, Frankreichs wichtigste Besitzung in Indien, gefallen; im Juni desselben Jahres begannen in Paris die Friedensverhandlungen – während König Friedrich noch immer nicht wusste, wie er sich der erdrückenden Übermacht entledigen sollte. Noch scheiterten die Friedensabsichten der City an dem zähen Widerstand Frankreichs, und England erhielt so Gelegenheit, seine koloniale Beute noch zu vergrößern, und zwar auf Kosten Spaniens, das im Anfang des Jahres 1762 in den Krieg hineingezogen wurde. Havanna und Manila wurden erobert, starke Schlüsselstellungen des spanischen Kolonialreiches also, die man aber doch, sehr zum Unwillen des grollenden Pitt, in den nun wieder einsetzenden Friedensverhandlungen nur als Pfänder behandelte.
Wie schon oft, so erwies sich auch jetzt, dass die englische Raubgier sich nicht mit Kühnheit zu paaren pflegt. Ein Durchhalten wäre nicht nur ehrenhafter gegen den Verbündeten gewesen – „Verrat, Heimtücke und Schande“ nannte es Pitt im Unterhaus, dass man Friedrich von Preußen im Stich ließ -, sondern auch gewinnbringender. Jetzt eine wirklich heroische Anstrengung der Nation, und Cromwells Traum wäre Wirklichkeit, ganz Amerika englisch geworden. Aber außer Pitt war niemand mehr für heroische Anstrengungen zu haben, und so begnügte man sich mit dem, was ohne das zu haben war.
In Deutschland haben wir Kanada erobert“, so sagte Pitt. Aber wer hatte die Schlacht bei Roßbach geschlagen, durch die Frankreich auf lange Zeit hin militärisch gelähmt wurde? Friedrich dem Großen also hatten es die Engländer zu danken, dass sie Quebec nehmen und behalten konnten, dass Kanada nun zum englischen Kolonialreich gehörte, dieses Riesengebiet, das französischer Fleiß erschlossen, das sonst die Engländer keinen Schuss Pulver wert gedünkt haben würde, und das außer Indianern nur eine fünfundsiebzigtausend Köpfe starke französische Bevölkerung hatte.
Auch Louisiana, das Mississippi- Gebiet also, musste Frankreich abtreten; doch die City von London überwies es gnädig an Spanien, das dafür Florida herausgab und weitere Konzessionen an den englischen Handel in Mexiko und Mittelamerika machte. Damit war Frankreich aus Nordamerika herausgedrängt, und Spanien stand allein England gegenüber. Was Indien betraf, so hätte Pitt gleichfalls sagen dürfen, dass England es den Siegen Friedrichs des Großen verdankte. Dass die Franzosen ihre Position in Indien verloren und trotz der Rückgabe Pondichèrys im Friedensschluss nie wiedergewinnen konnten, ist jedenfalls der Fesselung der französischen Kräfte durch den Großen König zuzuschreiben. Dass allerdings gleichzeitig die Engländer über die bisherige Rolle als Händler hinaus zu Herren Indiens zu werden begannen, ist das Verdienst des begabten und skrupellosen Robert Clive, der Zwistigkeiten in dem verfallenden Reich des Großmoguls mit ebenso bedenkenloser wie überlegener militärischer und diplomatischer Kunst auszunutzen wusste. Indische Zwietracht ließ ihm in der Schlacht bei dem Dorfe Plassey (Juni 1757) den Sieg zufallen, und er nutzte den Erfolg aus, indem er der Ostindischen Gesellschaft, bei der er einst als einfacher Schreiber eingetreten war, das Monopol der Steuerpacht in Bengalen erwirkte. Seitdem kassierten Engländer die Steuern für die indischen Fürsten ein. Die rücksichtslose Aussaugung des indischen Volkes bis aufs Blut begann. Unermessliche Reichtümer flossen in die Kassen der Gesellschaft und in die Hände der englischen „Steuerbeamten“. England mästete sich an Indien.
Am Randes des Zusammenbruches
Der Sieg, den Preußens König den Engländern ermöglicht hatte schien ihre Vormacht für alle Zukunft befestigt zu haben. Wer wollte ihnen nun noch in den Weg treten, wenn sie ihr koloniales Imperium – das Wort „Empire“ wurde seit Pitt mit Vorliebe gebraucht – zum Weltreich erweiterten?
Nun, der Triumph war verfrüht. Knapp zehn Jahre nach den Siegesfeiern stand ein großer Teil des „Empire“ in hellem Aufruhr gegen die City von London, und es sah so aus, als solle ihr die ganze Beute wieder entrissen werden.
Nicht aus dem Ansturm übermächtiger Gegner ergab sich diese schwerste aller Krisen, die die britische Großmacht bis auf unsere Tage durchzumachen hatte, sondern aus der Unfähigkeit Londons, das Weltreich vernünftig und gerecht aufzubauen. Denn es waren nun Engländer selbst, die das Reich zertrümmerten – die Männer aus den dreizehn englischen Kolonien Nordamerikas. Zwar stammten nicht alle „Neuengländer, wie sie damals genannt wurden, wirklich aus England; viele der Kolonisten waren Iren, Holländer, Franzosen, nicht wenige auch Deutsche, und der „Schmelztiegel“ Amerika machte seine die Nationalitäten umformende Kraft schon damals geltend. Trotzdem war es nicht diese Verschiedenheit des Amerikanertums vom alten Engländertum des Mutterlandes, was den Ruf nach der Unabhängigkeit Amerikas so bald laut werden ließ; nein, England verlor diese Kolonien, weil es sie, wie alle Gebiete in der weiten Welt, ausschließlich als Objekte wirtschaftlicher Ausbeutung betrachtete. – Die City von London hatte jahrhundertlange Übung darin, Konkurrenten mit scheelen Augen zu betrachten. Es musste ihr Missfallen erwecken, dass sich in den größeren Handelsplätzen Nordamerikas, in Boston und New York, in Baltimore und Galveston, eine starke kommerzielle Unternehmungslust regte. Sollte es etwa dahin kommen, so fragte man sich ärgerlich daß jetzt, nachdem Spanien, Holland und Frankreich niedergerungen waren, neuenglische Schiff-Fahrt sich auf den Weltmeeren ausbreitete, neuenglischer Handel die Dividenden in London schmälerte? Im Fall Spaniens, Hollands und Frankreichs hatte man zu lange gewartet – jetzt war man entschlossen, schnell zuzupacken und die drohende Rivalität im Keime zu ersticken.

Hessische Soldaten vor der Einschiffung – Wie England alle seine Kriege vornehmlich mit fremden Hilfstruppen führte, so mussten auch die Untertanen verantwortungsloser und geldbedürftiger deutscher Kleinfürsten ihr Leben für die Erhaltung der englischen Herrschaft über Amerikas einsetzen, als die dortigen Kolonien sich vom Mutterland losrissen. – Nach einem zeitgenössischen Stich.
Natürlich gab man nicht offen zu, dass die Gesetze über Besteuerung der Kolonien, die man jetzt vom Parlament beschließen ließ, der Niederhaltung der amerikanischen Konkurrenz galten, sondern man begründete sie damit: die Kolonien müssten ihrerseits einen finanziellen Beitrag zu den Kosten liefern, die das Mutterland an ihre Verteidigung wandte. Merkwürdig, dass diese Abgaben samt und sonders den aufblühenden amerikanischen Handel schwer belasteten und dass zugleich durch Verschärfung der Navigationsakte die Freiheit des amerikanischen Kaufmanns, seine Waren zu beziehen, woher, und sie zu verkaufen, wohin es ihm beliebte, auf das empfindlichste eingeengt wurde.
Die Neuengländer hätten nicht zum überwiegenden Teil englischer Abstammung sein müssen, wenn sie solche Maßnahmen ohne Widerspruch hingenommen hätten. Wenn man von London jetzt die „Freiheit“ forderte, so dachte man dabei zunächst nicht an die unbeschränkte politische Selbstbestimmung, sondern eben an die schrankenlose Handelsfreiheit, also genau an das, was man ihnen in London nicht zugestehen wollte. Die verfassungsrechtlichen Fragen, über die schon damals ganze Bibliotheken geschrieben wurden und die nach einer weit verbreiteten Ansicht den Hauptanstoss zum offenen Ausbruch des Konflikts gegeben haben sollen, waren nur die ideologische Verkleidung dieses wirtschaftlichen Machtkampfes. Der Anlass zur Rebellion wurde denn auch eine englische Maßnahme, die weder mit Menschen-, noch mit Bürgerrechten etwas zu tun hatte, sondern den Amerikanern auf brutale Weise demonstrieren sollte, dass sie sich nach wie vor in gottgewollter Abhängigkeit von der Londoner City befänden. Die Ostindische Kompanie wurde nämlich ermächtigt, Tee direkt nach Amerika zu verschiffen und dort zu verkaufen. Das bedeutete, dass die Amerikaner ihren Tee fortan billiger erhielten als die Engländer, denn England erhob einen Schilling Zoll je Pfund, Amerika nur drei Pence. Es bedeutete aber auch, dass die amerikanischen Teehändler samt und sonders den Bankrott anmelden mussten, denn die Gesetze erlaubten ihnen nicht, Tee anderswo zu kaufen als in England. Nicht verwunderlich also, dass sie die Ankunft der ersten allzu billigen Teeladung im Hafen von Boston äußerst missfällig aufnahmen und sie von einer Schar beherzter Strolche kurzerhand ins Meer werfen ließen.

Die Verteidigung von Gibraltar – Während des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges hatte Gibraltar drei Jahre lang eine Belagerung durch die Spanier und Franzosen auszuhalten (1779-1782). Die erfolgreiche Verteidigung verdankte es den deutschen Soldaten der Besatzung, vor allem Hannoveranern. – Gemälde von John Copley.
Jetzt waren die Aktionäre der Ostindien-Kompanie die Geschädigten, und die Staatsmaschinerie wurde mobil gemacht: bis die Stadt Boston den inzwischen mit Meerwasser allzu sehr verdünnten Tee würde bezahlt haben, sollte kein Schiff mehr in den Hafen ein- oder aus ihm ausfahren dürfen; Truppen wurden in die Bostoner Bürgerhäuser einquartiert. Damit war der Kampf unvermeidlich geworden. Da die Kolonien die „Freiheit“ anders nicht erlangen konnten, stritten sie nun für die Unabhängigkeit, für die Loslösung aus dem britischen Weltreich.
Die „amerikanische Revolution“, wie dieser Bürgerkrieg der Neuengländer gegen die Engländer genannt wird, brach aus.
Übermut und Habsucht der City hatten den Konflikt mit den Kolonien heraufbeschworen. Aber wer von den eifersüchtigen Plutokraten hätte gedacht, dass die Aktion gegen Boston zu einem Existenzkampf Englands führen werde? Die landläufige englische Schulbuchauffassung, die wie in anderen Fällen so auch hier auf die festländische, insbesondere die deutsche Schulbuchauffassung abgefärbt hat, liebt es, die Gefahr, in der England damals schwebte, zu bagatellisieren, weil durch eine Darstellung des wahren Sachverhalts der Eindruck von der inneren Folgerichtigkeit, mit der das britische Weltreich im Schutze der Vorsehnung aufgebaut worden sein soll, verloren gehen könnte In Wahrheit aber war diese Gefahr überaus groß, wenigstens von dem Augenblicke an, da sich Frankreich (1778) und dann auch Spanien (1779) mit amerikanischen Unabhängigkeitskämpfern solidarisch erklärten. Bis dahin hatte England den Krieg nur zu Lande, in Amerika, zu führen gehabt, was ihm schon schwer genug fiel. Die Vernachlässigung der Armee rächte sich jetzt; es half nichts, dass man Verbrecher, Landstreicher und Bettler zum Heeresdienst presste und dass König Georg III. als Kurfürst von Hannover sich von seinen deutschen Mitfürsten gegen klingenden Münze Soldaten kaufte. Auch die „Hessen“, wie diese Opfer deutscher Erniedrigung von dem „stolzen Albion“ genannt wurden, vermochten in dem ungeheuren Gebiet nichts auszurichten. Nun aber kam noch der Seekrieg hinzu. England brauchte den größten Teil seiner Flotte um die Blockade gegen die aufständischen Kolonien durchzuführen. Wie sollte es da seine eigene Küsten ausreichend verteidigen?
So wurde das Jahr 1780 zum schwärzesten in der bisherigen Geschichte Englands. Spanische und französische Geschwader lagen auf der Reede von Plymouth und verhinderten jedes englische Schiff am Ausfahren aus dem Kanal. Fünfzigtausend Mann mit vierhundert Transportschiffen warteten in Le Havre auf den Befehl zur Abfahrt. Die „Invasion“ stand vor den Toren. Florida war von den Spaniern erobert, die englischen Inseln Westindiens besetzt, Gibraltar wurde von starken spanischen und französischen Streitkräften belagert.

England setzt den Fuß auf Malta – Zeichnung des Engländers James Gillray soll dem Triumph über die Besiegung Napoleons Ausdruck geben, ist dabei ungewollt zu einer scharfen Satire auf die englischen Raubmethoden im Mittelmeer geworden. Napoleon hat von John Bull einen Boxhieb Marke „Nelson“ bekommen.
Zu allem Überfluss rächte sich jetzt auch die skrupellose Seekriegsführung früherer Zeiten an England. Sonst hatte man die See als eine britische Domäne in Anspruch genommen und die neutrale Schiff-Fahrt unter dem Vorwande, man müsse verhindern, dass der Feind Zufuhr erhalte, rücksichtslos drangsaliert. Auch in den ersten Jahren dieses Krieges war man so verfahren.
Alle Schiffe, die des Handels mit dem Feinde verdächtigt waren, wurden aufgegriffen und in englische Häfen eingebracht; feindliches Gut wurde, einerlei welcher Art es war, einbehalten, obwohl alle Mächte außer England den Grundsatz anerkannten, dass die neutrale Flagge auch das Gut Kriegführender decke; stellte aber das Prisengericht fest, dass Konterbande an Bord sei – wobei England genau wie heute willkürlich festsetzte, was es als Konterbande ansehen wollte -, so wurde die betreffende Ladung auch dann englisches Eigentum, wenn sie Neutralen gehörte; sie wurde dann zu einem Wert, den das Prisengericht benannte, angekauft. So hatte man sich bisher für die starken Verluste durch französische und spanische Kaperschiffe schadlos los halten können. Nun war es aber auch damit vorbei. Unter der Führung der Kaiserin Katharina von Russland schlossen sich alle Neutralen – Preußen, Schweden, Dänemark, Portugal und die Türkei – zu einem „Bunde bewaffneter Neutralität“ zusammen und zwangen damit England, wenn es sich nicht noch mehr Feinde auf den Hals ziehen wollte, auf die Grundsätze des Seerechts fortan Rücksicht zu nehmen. Im letzten Augenblick gelang es London, Holland an dem Eintritt in diesen Bund zu verhindern, indem es nämlich in einem Anfall von Verzweiflung diesem schärfsten Konkurrenten im Ostseehandel kurzerhand den Krieg erklärte und so wenigstens die holländische Schiff-Fahrt ausschaltete. Dafür belieferten nun Schweden und Russen die französische Marine mit Schiffsmaterialien, ohne dass England es wagen konnte, sie daran zu hindern.
Kein Wunder, dass unter dem Eindruck dieser Lage eine Panik in London ausbrach. Pessimismus, ja Defaitismus herrschte in politischen Kreisen. „Die Sonne Großbritanniens ist im Untergehen, wir werden nicht länger ein mächtiges und geachtetes Volk sein“ – so hieß es, oder noch düsterer: „Man jagt uns wie den verwundeten Hirsch, den seine Genossen im Stich gelassen haben.“
Ja, sobald England keine Festlandsdegen für sich hatte, sobald es sich aus eigener Kraft verteidigen musste, zeigte sich seine Schwäche. Einmal, ein einziges Mal im Lauf der letzten Jahrhunderte war sich Europa einig darin, englische Übergriffe abzuwehren – und dieses eine Mal musste es England an den Kragen gehen! Nur eine Rettung blieb ihm: es musste sich aus der Gefahr loskaufen mit einem hohen Preis, der Einwilligung in die Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien, die nun als selbständige Macht, als „Vereinigte Staaten von Amerika“, in den Kreis der großen Mächte traten.
Wieder einmal hatte kleinlicher Krämergeist eine große geschichtliche Stunde versäumt. Die Anwartschaft auf ein Weltreich war England zugefallen – es hatte sie verscherzt. Der englische Staatsverband verlor mehr als ein Viertel seiner weißen Bevölkerung Mehrere westindische Inseln und große Teile de westafrikanischen Küste (vor allem das Senegalgebiet mussten an Frankreich abgetreten werden. Spaniens mittelamerikanisches Reich war nun gesichert vor englischen Angriffen; die englischen Niederlassungen von Farbholzfällern in Honduras und Mexiko, die Spanien im Frieden von 1762 hatte bewilligen müssen, wurdet geräumt, und ebenso, eine schwere Demütigung für das Meerbeherrschende Albion, die Balearen, die sei Utrecht (1713) britischer Besitz gewesen waren. Nur eine wichtige Position behielt England: Gibraltar, das trotz dreijähriger Belagerung gehalten werden konnte. Das machte es den britischen Unterhändlern möglich in den Friedensverhandlungen für den Verzicht von Gibraltar Stützpunkte in Westindien zu fordern, was der Vertreter Spaniens mit Rücksicht auf die Unversehrtheit des amerikanischen Imperiums ablehnte. Ja, der Spanier weigerte sich sogar, in ein Angebot des französischen Außenministers einzuwilligen, der bereit war, französische Inseln in Westindien aufzugeben, wenn Spanien Gibraltar wieder erhielte. Vor der Wahl, England in Amerika oder im Mittelmeer dulden zu müssen, entschied sich Spanien damals für das Mittelmeer als das kleinere Übel. Eine sehr folgenschwere Entscheidung, wie schon die Jahre beweisen sollten…
Der Endkampf
Sechs Jahre nach dem demütigenden Friedensschluss, der für England dadurch noch demütigender wurde, dass er im Spiegelsaal von Versailles unterzeichnet werden musste, brach die Französische Revolution aus und gab den Geschicken Europas, ja der Welt eine andere Richtung.
Der englischen Propaganda sind die seltsamsten und widersprechendsten Dinge möglich gewesen. Gegenüber Spanien und dem Frankreich des absoluten Königtums hatte sie es verstanden, England als den Hort der „Freiheit“ vor die Gemüter der leichtgläubigen Kontinentalen zu stellen. Als aber die Französische Revolution unter der Parole der „Freiheit“ die Völker Europas zum Aufruhr rief, da wurde England die konservative Macht schlechthin, die selbstlos und idealistisch für die Erhaltung der bedrohten Kulturgüter und natürlich für das „europäische Gleichgewicht“ kämpfte. Das Pochen auf die nur in England heimische Freiheit wurde gedämpfter. Dafür erklang um so lauter die Berufung darauf, dass England die Heimstätte der „Tradition“ und der Hort der Achtung für alles geschichtlich Gewordene sei – im Gegensatz zu der französischen Anmaßung, alle politischen Verhältnisse aus der bloßen Vernunft gestalten zu wollen. Hier erwies es sich als ein Glück, daß der König von England noch immer zugleich Kurfürst von Hannover war; denn die hannoverschen Literaten eigneten sich trefflich zur Verbreitung dieses Englandbildes in den Ländern deutscher Zunge, wo denn auch bis auf die jüngstvergangenen Tage immer wieder aufgefrischt worden ist …
Lässt man jedoch die Tatsachen sprechen kommt man zu dem Ergebnis, dass Englands Einstellung den Ereignissen der Französischen Revolution und der napoleonischen Ära gegenüber von dem gleichen Motiv bestimmt war wie sein Verhalten in jeder andere Zeit: nämlich allein von wirtschaftlichen, sprich plutokratischen und machtpolitischen, die ihrerseits wieder aus den wirtschaftlichen entsprangen.
Der Sturm auf die Bastille (14. Juli 1789), die wachsende Entmachtung des Königtums zugunsten der „Hydra von zwölfhundert Köpfen“, wie die Kaiser gegenüber Katharina von Russland die französische Nationalversammlung nannte, der Konflikt mit Österreich und Preußen, der zum Kriege führte (1792) – alle diese für Europa so beunruhigenden Ereignisse ließen die City von London und die Regierung, die ihre Interessen vertrat, ziemlich kühl. ja, man fühlte sich stark erleichtert angesichts der Tatsache, dass der in den letzten Jahren so sehr erstarkte Rivale um die Beherrschung der außereuropäischen Welt durch innere Zwistigkeiten sich selber schwächte. Dass Österreich und Preußen diesmal beide gemeinsam Englands Spiel auf dem Festlande spielten und sogar, ohne dafür Subsidien zu verlangen, konnte der City nur recht sein. Der leitende Staatsmann Englands, William Pitt der Jüngere, erklärte noch 1792, als der unglückliche Ludwig XXI. schon ein hilfloser Gefangener des Pariser Pöbels war, es habe „in der Geschichte dieses Landes noch nie eine Zeit gegeben, wo man mit solcher Sicherheit auf fünfzehn Jahre des Friedens rechnen könne wie im jetzigen Augenblick“. Weil er nämlich nicht daran zweifelte, dass die Armeen des Herzogs von Braunschweig binnen kurzem in Paris sein würden.

Die Seeschlacht von Trafalgar – Nelsons Sieg bei Trafalgar (November 1805) vernichtete die schlecht geführte französische Flotte und nahm damit Napoleon die Möglichkeit, das höchste Ziel seines Strebens zu erreichen: die Zerschlagung der britischen Weltmacht. Gemälde von Turner.
Aber es kam anders. Das französische Revolutionsheer blieb siegreich, es schlug die Österreicher bei Jemappes (November 1792) und besetzte die Österreichischen Niederlande, das heutige Belgien. Antwerpen, vielleicht bald auch Amsterdam in französischer Hand – damit war, wie es ein moderner englischer Historiker ausdrückt, „die Sicherheit des englischen Handels und der englischen Schiff-Fahrt bedroht“. Und das allein war der Grund, warum aus den von Pitt erwarteten fünfzehn Jahren Frieden dreiundzwanzig Jahre Krieg wurden. Dass in dem Augenblick, wo England den Eintritt in den Krieg bereits beschlossen hatte, der Konvent das Todesurteil über Ludwig XVI. fällte, war eine günstige Fügung für die englische Propaganda. Denn nun konnte es so dargestellt werden, als sei das Verbrechen des Königsmordes und überhaupt die Schreckensherrschaft der Grund für England, sich mit Europa solidarisch zu erklären. Eben hatte man noch gesagt, es sei Englands unwürdig, sich in die inneren Verhältnisse eines anderen Landes zu mischen – nun gaben diese inneren Verhältnisse ein vortreffliches Aushängeschild für die englische Politik ab. Der Endkampf zwischen England und Frankreich begann.
In den kriegerischen Ereignissen auf dem Festland spielte die englische Expeditionsarmee eine klägliche Rolle; ihr unfähiger Befehlshaber, der Herzog von York, musste mehrmals nach unrühmlichen Gefechten die Waffen strecken.

England und Frankreich teilen sich die Welt – Dabei ist es für den englischen Zeichner Gillray selbstverständlich, dass England (Pitt der Jüngere) den größeren Teil erhält während sich Frankreich (Napoleon I.) mit Europa begnügen muss.
Es zeigte sich, dass die Leute recht gehabt hatten, die Pitt vor solchen Experimenten warnten. Warum sollte sich England auch, angesichts einer so stattlichen Zahl von Festlandsdegen, mit seiner Armee in Europa engagieren? Seine wahren Kriegsziele lagen ja doch anderswo. Wo, das wurde den Bewohnern der holländischen Kapkolonie, dieses „Hauses auf dem halben Wege nach Indien“, auf sehr handgreifliche Weise deutlich gemacht, als im September 1795 eine englische Flotte vor Kapstadt erschien. Truppen wurden gelandet, und der Befehlshaber überreichte dem holländischen Gouverneur ein Schreiben, in dem es hieß, dass der Prinz von Oranien, Statthalter der Vereinigten Niederlande, die Übergabe der Kolonie an England wünsche, „um dieselbe dem Zugriff der Franzosen zu entziehen“. Die Parallele mit dem Vorgehen Englands im Jahre 1940 ist mit Händen zu greifen! Es war natürlich leichter, dem verbündeten Holland seine Kolonien abzunehmen, als mit den französischen Armeen in Europa fertig zu werden. Und weil es sich doch um eine bequeme Erweiterung des indischen Besitzes handelte, wurde auch gleich Ceylon von britischen Truppen besetzt.
Es gab nur einen Mann in Europa, der begriff, um welcher Ziele willen England den Krieg führte und der in der britischen Insel den Feind alles europäischen Friedens erkannte: Napoleon Bonaparte. Durch seine Siege in Italien war Frankreich zur stärksten Macht im Mittelmeer geworden, und diesen Vorsprung gedachte er nun auszunutzen, um England den entscheidenden Schlag zu versetzen. Sein wahrhaft weltgeschichtliches Unternehmen gegen Ägypten – weltgeschichtlich nicht nur als Plan, sondern auch in seinen Folgen – zielte darauf ab, die türkische Orientsperre zu durchbrechen, das Rote Meer und damit den kürzesten Weg nach Indien unter französische Kontrolle zu bringen und so England die Fundamente seiner finanzkapitalistischen Macht abzugraben. Wenn dieses Unternehmen auch scheiterte, so hat es doch die undurchdringliche Sperre, die die Welt in zwei voneinander streng getrennte Bezirke – den europäisch-atlantischen und den indischen Bereich – schied, für alle Folgezeit beseitigt, den Vorderen Orient für das Spiel der europäischen Politik geöffnet und damit die Verwundbarkeit der britischen Machtstellung offenkundig gemacht – allerdings auch die angespannteste Abwehr Englands hervorgerufen. Wir werden heute nicht geneigt sein, wie es frühere Generationen in Deutschland taten, das Scheitern der Napoleonischen Expedition nach Ägypten als ein im Grunde auch für uns erfreuliches Ergebnis zu feiern. Nelsons Seesieg bei Abukir (1798) machte das Nachschubproblem für Napoleon unlösbar und schuf England die Stellung als beherrschende Macht des Mittelmeeres. An Nelsons Namen knüpft sich aber auch obwohl der große Admiral nicht die Verantwortung für die späteren Geschehnisse trägt, die Erinnerung an den Raub einer Insel, die England entgegen ich beschworenen Verträgen bis heute nicht wieder herausgegeben hat- Malta.
Bevor Napoleon zu seinem ägyptischen Unternehmen aufbrach, hatte Malta unter der Souveränität des Johanniterordens gestanden, der seinerseits wieder die Insel von dem König von Neapel und Sizilien zu Lehen trug. Der Staat der Malteserritter, diese letzte Erinnerung an die Zeit der Kreuzzüge, fand ein Ende in dem Augenblick, als Napoleon Malta zu einem Stützpunkt für seinen Feldzug gegen Indien wählte. Da landeten französische Truppen vor La Valetta und nahmen die Hafenstadt ein. Es war strategisch selbstverständlich, dass Nelson versuchte, seinem großen Gegner diesen wichtigen Platz wieder zu entringen.
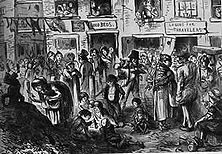
Hier hält König Cholera Hof – Trotz aller Anklagen wohlmeinender Menschenfreunde, trotz aller Untersuchungsausschüsse und wohltätigen Vereine ist es nicht möglich gewesen, aus den englischen Großstädten das krasse Elend zu vertreiben, das dort in den Jahren der „industriellen Revolution“ seinen Einzug hielt. -Zeichnung aus dem“ Punch“ (1852)
Der schwächliche König von Neapel war mit England im Bunde und gab Nelson gern die Vollmacht zu einer Vertreibung der Franzosen unter der Voraussetzung, dass nach Schluss des Krieges der alte Zustand wieder hergestellt werde. Das war auch die Meinung Nelsons; ihm schien es genug zu sein, dass die Franzosen hier verschwanden, und so erklärte er, als er nun die Blockade über La Valetta verhängte, Malta werde nach dem Abzug der Franzosen seinen rechtmäßigen Herren zurückgegeben werden.
Was aber geschah wirklich? Wohl erklärten die Londoner Staatsmänner in Neapel und in Paris, die Besetzung durch England, die übrigens erst nach zweijähriger Dauer der Blockade gelang, gelte nur für die Dauer des Krieges, und man wünsche, dass eine dritte Macht die Garantie für die Wahrung des alten Besitzstandes übernehme. Als es dann aber diesen englischen Zusagen entsprechend so vereinbart war und der Friedensvertrag von Amiens (27. März 1802) die Neutralität der Insel sowie ihre Räumung durch die Engländer binnen drei Monaten festgesetzt hatte, da stellten sich alsbald die wahren Absichten Londons heraus. Napoleon hatte gezeigt, welche Bedeutung der östliche Mittelmeerraum haben konnte, und nun sollte England den Platz aufgeben, von dem aus es den ganzen Verkehr in diesem Raum überwachen konnte? Es vergingen die drei Monate, es vergingen weitere drei, und noch waren keine Vorbereitungen zur Räumung Maltas getroffen. Die sizilianischen Fahnen, die zuerst neben den englischen geweht hatten, waren längst heruntergeholt. Kein Zweifel, die Engländer richteten sich häuslich ein.

Die Tretmühle – Nachdem die großen Grundbesitzer durch das System der „Einhegungen“ die englischen Bauern von der Scholle vertrieben hatten, wurden diese zur Flucht in die Städte gezwungen. Soziale Fürsorge gab es nicht; wer straffällig wurde, verfiel unbarmherzig den brutalen Methoden der Strafvollstreckung. Kein Wunder, dass viele es unter diesen Umständen vorzogen, sich in die Kolonien verschicken zu lassen. – Aus „Le Monde Illustrd“ (1867).
Vergeblich mahnte der Papst, vergeblich drängte Paris – es gab immer neue Ausreden und Verzögerungen, und als dann nach fünfviertel Jahren Frankreich endgültig auf Räumung drängte, da erhielt der englische Gesandte in Paris Anweisung, seine Pässe zu fordern. Malta war für England so wichtig geworden, dass es entschlossen war, die wider alles Recht einbehaltene Insel mit Waffengewalt zu verteidigen.
Auch jetzt also das alte Spiel: kaum hat ein anderer die Bedeutung eines Erdraumes erkannt und schickt sich an, aus solcher Erkenntnis die praktischen Folgerungen zu ziehen, so drängt England sich ein. Es hat sich vorher um diesen Raum wenig gekümmert, hat keine Vorstellung von den weittragenden Möglichkeiten, die hier beschlossen liegen. Es fragt auch nicht, ob die Folgen für Europa segensreich sein können oder nicht. Es hat nur die hysterische Angst, ins Hintertreffen zu geraten. Weltpolitisch gesehen sind die Kämpfe der napoleonischen Zeit, was in manchen geschichtlichen Darstellungen übersehen oder doch nicht klar genug herausgearbeitet wird, ein Duell zwischen England und Frankreich. Die unversöhnliche Gegnerschaft wird auf beiden Seiten klar erkannt- alle anderen Mächte wechseln im Laufe des Kampfes ihre Stellung, bis dann endlich im Jahre 1813 eine Lage herbeigeführt ist, in der sie alle sich gegen Napoleon stellen – gewiss nicht in der Absicht, England stark zu machen, aber doch mit dem Ergebnis, dass England als unbestritten stärkste Weltmacht aus dem Ringen hervorgeht. Verhängnis Europas …
Napoleon führte den Krieg als Angreifer – nicht im politischen Sinne der „Kriegsschuld“, sondern im strategischen Sinne. Sobald er sich einmal zum Kriege entschlossen hatte, kannte er nur ein Ziel: die Vernichtung der gegnerischen Macht. Das war gegenüber England am schlagendsten möglich, wenn es gelang, die britische Insel selbst zu erobern so steht am Beginn des großen Zweikampfes der kühne und doch bis in alle Einzelheiten durchgerechnete Invasionsplan von 1804. 150 000 Mann wurden an der französischen Kanalküste zusammengezogen und monatelang in Landungsmanövern geübt- sie sollten in über zweitausend Flachgehenden Fahrzeugen nach England geschafft werden und in London den Frieden diktieren. Auf der britischen Insel erweckten die Vorbereitungen Angst und Entsetzen, und vergeblich bemühte sich die Presse, durch Karikaturen auf den „korsischen Banditen“ die Gefahr zu bagatellisieren. Die Panik wurde immer ärger; jeden Tag meldeten sich Leute, die die französischen Boote schon hatten ankommen sehen, und jedermann dachte mit Furcht und Grauen an den Tag da die gewaltige Armee des Kaisers im Triumph von Folkestone auf die Hauptstadt marschieren würde. Doch das Gelingen des Invasionsprojektes hatte eine Voraussetzung; es musste von der französischen Flotte gedeckt werden. Das aber war nur möglich, wenn entweder das Gros der englischen Flotte fern vom Kanal gehalten oder in einer siegreichen Seeschlacht die französische Überlegenheit erkämpft wurde, Das erste gelang: ein Scheinangriff auf die westindischen Besitzungen Englands lockte Nelson nach den Antillen, und als, er dort keine französischen Schiffe mehr fand, nahm er Kurs auf die Straße von Gibraltar. Aber Villeneuve, der französische Admiral, verpasste nun selbst den Einsatz, den Napoleon ihm zugedacht hatte; statt nach Boulogne segelte er, über Nelsons Bewegungen falsch informiert, gleichfalls in die spanischen Gewässer.
„England ist unser!“ hatte Napoleon triumphieren ausgerufen, als er die Nachricht von Nelsons falschem Manöver erhielt. Aber nun, da Villeneuve nicht vor Boulogne erschien, war die große, die einzige Gelegenheit verpasst. Napoleon hatte keine Zeit, zu warten; denn schon rüsteten sich Österreich und Russland zum Angriff. Das Lager von Boulogne wurde aufgehoben, die Truppen in Eilmärschen nach dem Rhein und der Donau beordert. Der Invasionsplan war unmittelbar von seiner Verwirklichung aufgegeben worden. Er konnte nicht wieder aufgenommen werden. Denn in den Tagen, da die Kapitulation der Österreicher in Ulm den ganzen Süden Deutschlands dem französischen Vormarsch öffnete, vernichtete Nelsons Sieg bei Kap Trafalgar (21. Oktober 1805) die französische und die spanische Flotte und damit auch Napoleons Hoffnung, für die Dauer des Krieges jemals wieder die Überlegenheit zur See zu gewinnen.
Zur Unzeit fanden sich nacheinander die Großmächte Europas als Festlanddegen Englands ein. Austerlitz, Jena, Friedland – das waren die Ergebnisse, die sie zu buchen hatten. England aber wurde in diesen Jahren der unbestrittene Herr der Meere.
„Warum hat sich England in die Lage gebracht“, so fragte Napoleon später den Obersten Campbell auf der Fahrt nach Elba, „dass es nur zu existieren vermag, wenn es seine Waren unbeschränkt in allen Teilen der Welt verkaufen kann? Wenn es auf dieses verzichten würde, bliebe es immer noch eine achtbare Nation – aber das genügt ihm nicht, es will groß sein, es will herrschen, es will in keinem anderen Lande Prosperität aufkommen lassen – das ist es!“
Solange ein militärischer Angriff auf England und seine Kolonien nicht wieder möglich war, gab es also für Napoleon nur ein Kampfmittel: die Abdrosselung des englischen Handels mit den europäischen Ländern. Aber es konnte nicht ausbleiben, dass die Völker, die er zu einer europäischen Einheit im Kampf gegen England zusammenschweißen wollte, das französische Joch härter empfanden als die wirtschaftliche Vormacht Englands, die sich für sie, gerade damals eher angenehm als unangenehm auswirkte. Denn England war für sie in erster Linie das Land, das ihnen die billigsten und zugleich die besten Metall- und Textilwaren lieferte. Sie mussten die Waren, die sie bisher von England bezogen, nun von anderswoher teurer und in geringerer Qualität importieren. Der Zwang der Kontinentalsperre lastete wirtschaftlich schwer auf ihnen und trug dazu bei, dass sie die Herrschaft Frankreichs abzuschütteln strebten, was um so begreiflicher ist, als sie ja befürchten mussten, dass Napoleon am Ende die französische Wirtschaftshegemonie an Stelle der englischen setzen wollte.

Die neungeschwänzte Katze – Die Humanitätsapostel der britischen Plutokratie kümmerten sich wenig um die Zustände in den Gefängnissen, wo die unmenschlichsten Misshandlungen der Insassen an der Tagesordnung waren – so etwa das Auspeitschen mit der „neungeschwänzten Katze“. Aus „Le Monde Illustrè“ (1872).
Hätte ein Mann von der Tatkraft Napoleons fünfzig Jahre früher die Geschicke Frankreichs und des Festlandes gelenkt, so wäre ihm vielleicht die Niederringung Englands durch eine Kontinentalsperre gelungen. Denn damals hatte England noch nicht den Vorsprung, den es jetzt geltend machen konnte und dem es jenen Umschwung in den Arbeitsmethoden verdankte, der von den Historikern zumeist die „industrielle Revolution“ genannt wird. Gerade in den Jahren, ehe Napoleon zu seinem titanischen Kampfe antrat, hatten sich zum ersten Mal die wichtigen technischen Erfindungen wie die Dampfmaschine, die Spinnmaschine, der mechanische Webstuhl, die Verhüttung des Eisens mit Koks, die England auf Jahrzehnte hinaus zum Lande der Industrie schlechthin machen sollten, in einem gewaltigen Ansteigen der englischen Exportziffern ausgewirkt. England, das sonst immer zu spät gekommen war, hatte einen Vorsprung gewonnen, den Napoleon nicht mehr einzuholen vermochte, ja, der noch bis in die zweite Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts genügen sollte, England das wirtschaftliche Übergewicht über alle anderen Länder zu geben.
Fügen wir gleich hinzu, dass England diesen Vorsprung mit tiefen sozialen Schäden erkaufte, die bis heute noch nicht annähernd geheilt sind. Hatte schon in den Zeiten der Tudors die Jagd nach dem Goldenen Vlies den Bauernstand zurückgedrängt, so dass ein Thomas Morus klagen konnte, die Schafe hätten die Menschen vertrieben, so wurde diese Vernichtung des freien Bauern mit dem Aufkommen verbesserter Methoden der Landwirtschaft nun vollständig. Immer mehr Großgrundbesitzer machten von dem Recht der „Einfriedigung“ Gebrauch, durch das dem Bauern gegen eine Entschädigung in Geld das Eigentum an seinem Boden genommen werden konnte, und wurden so zu kapitalistischen Farmern. Aus dem Bauern aber wurde ein Landarbeiter, ein Proletarier. So schuf die Agrarplutokratie der Herzöge und Grafen jenes Menschenreservoir, aus dem die aufkommende Fabrikindustrie schöpfen konnte.

Eine Hochzeit in Plutokratenkreisen Auf vielen Blättern hat der bedeutende englische Zeichner James Gillray das hohle Gepränge der „Oberen Zehntausend“ in England und die schweren sozialen Missstände, vor allem den krassen Gegensatz zwischen arm und reich, unbarmherzig gegeißelt.
Den landlos gewordenen Bauern zog es in die Stadt, wo die „Freiheit“ seiner wartete. Die Arbeit selbst, abgelöst von der nährenden Scholle und von dem „goldenen Boden“ des Handwerks, wurde eine Ware, und ihr Preis richtete sich nach Angebot und Nachfrage.
Aber in Europa sah man noch wenig von diesen Nachtseiten der industriellen Revolution – man sah nur, dass der Stahl aus Birmingham, die Wolle aus Yorkshire, die Baumwolle aus Lancashire besser war als jeder andere Stahl, jede andere Wolle und jede andere Baumwolle. Und man verwünschte Napoleon, weil er die Einfuhr dieser herrlichen Dinge verhindern wollte. Seltsamer Widerspruch, an dem der große Mann schließlich gescheitert ist: er, der sonst in so vielen Dingen weiter sah als seine Zeit, wollte die materielle Kultur Europas auf eine Stufe zurückschrauben, die sie soeben überwunden hatte! Die Kontinentalsperre ist nie zu lückenloser Wirksamkeit gekommen. Der Widerstand gegen sie fing in Napoleons eigener Familie an: sein Bruder Ludwig, König von Holland, verweigerte den Beitritt. Er wurde kurzerhand abgesetzt und sein Land Frankreich einverleibt. Den deutschen Häfen an der Nordseeküste ging es ebenso. Aber damit hörte Napoleons Macht auch auf. Schon der Schmuggel in diesen Häfen war schwer zu überwachen; noch weniger aber war zu verhindern, dass England sich neue Wege suchte. Von den türkischen Häfen des Mittelmeers über den Balkan, von dem russischen Riga über Polen kamen die englischen Waren nach Deutschland. Konnte man Russland zwingen, die Kontinentalsperre, der es auf dem Papier zugestimmt, auch wirklich durchzuführen? Napoleon wird es versuchen – und wird an der Beresina erkennen, dass die Einigung Europas gegen England damals noch ein Wahnbild war …
Doch England wartete nicht einmal, bis der Wilderstand gegen die Sperre sich bei den Völkern, die seine Kunden waren, auswirkte. Es griff gleich am Anfang zu – natürlich auf seine Art, gegen die Regeln des Völkerrechts und gegen die Achtung vor der Souveränität kleiner Staaten, in deren Namen es doch zum Kampfe gegen den „Weltherrscher“ Napoleon aufrief.
Es war in den Julitagen des Jahres 1807. Noch hatte sich nicht gezeigt, ob die skandinavischen Staaten bereit wären, sich der Kontinentalsperre anzuschließen; ja, es war eher das Gegenteil anzunehmen. Die englischen Agenten berichteten, dass Napoleon plane, sich der dänischen Kriegsflotte zu einem Angriff auf die britische Insel zu bedienen – Grund also für die englische Diplomatie, wachsam zu sein. Ein Garantiepakt etwa würde Napoleon zur Vorsicht zwingen und Dänemark seine freie Entschließung, die für England kaum ungünstig sein konnte, bewahren.
Aber das genügt dem Außenminister George Canning nicht. Er hat sich von einem Agenten (übrigens ganz entgegen den wahren Sachverhalt) berichten lassen, dass die dänische Kriegsflotte, die vor Kopenhagen ankert, in bester Verfassung und ein gefährliches Machtinstrument sei, also – beschließt er, dieses Machtinstrument der britischen Seeherrschaft dienstbar zu machen.
Da erfährt denn die dänische Regierung zu ihrem Erstaunen durch den englischen Gesandten, dass ihr Verhalten die Sicherheit Großbritanniens gefährde und dass der Beherrscher der Meere das Gefühl der Sicherheit nur wiedererhalten könne, wenn Dänemark sich seiner Flotte entäußere. Zur Unterstützung dieses Wunsches nach Ruhe erscheint zugleich eine englische Flotte von nicht weniger als achtundachtzig Schiffen im Sund. „Durch diese überwältigende Demonstration“ so erklärt Canning im Unterhaus, „soll die Ehre der dänischen Regierung gewahrt werden.“
Aber dieser Versuch, die dänische Friedensliebe zum Nutzen der britischen Macht auszubeuten, schlägt fehl. Zur peinlichen Überraschung Londons hat man in Kopenhagen andere Begriffe von Ehre und lehnt es ab, sich der britischen Drohung zu fügen. „Sollte Bonaparte in Holstein einfallen“, erwidert dem englischen Gesandten der dänische Kronprinz-Regent, „dann sind wir ja von selbst der Verbündete Großbritanniens. Ich verstehe nicht, warum ich mit Gewalt gezwungen werden soll, die Neutralität meines Landes aufzugeben.“
Es bleibt also nichts übrig, als ihm das mangelnde Verständnis mit Waffengewalt beizubringen. Am 16. August stoßen infolgedessen überall von den jüngst im Sund angekommenen Transportschiffen dicht besetzte Schaluppen ab und landen an der Küste zwischen Kopenhagen und Helsingör: die britische Belagerungsarmee. Zwar lassen am Abend jedes Tages die englischen Kommandeure eine Proklamation anschlagen, in der es heißt, dass mit der Landung keine bösen Absichten verbunden seien – „noch ist es nicht zu spät, auf die Stimme der Vernunft und Mäßigung zu hören“ -, aber seltsamerweise hat Dänemark noch immer keinen Sinn für „Vernunft und Mäßigung“, sondern erklärt, dass England die Feindseligkeiten begonnen habe, und beruft seine Miliz aus Bürgern und Bauern ein. Ein Beweis mehr für den ehrlichen Neutralitätswillen der dänischen Regierung, dass sie in diesem Augenblick nicht Napoleon um Hilfe anruft, sondern mit eigener Kraft ihre Unabhängigkeit behaupten will!
Vergeblich warten also die englischen Kommandeure auf eine freiwillige Kapitulation. Sie müssen zum Angriff übergehen. Einer der Unterführer, Sir Arthur Wellesley (der spätere Herzog von Wellington), hat vorgeschlagen, die dänische Hauptstadt nur zu zernieren, aber dieser Wunsch, Blutopfer zu sparen, wird von dem Oberkommandierenden Lord Catheart nicht geteilt. „Wenn uns nicht bis zum 1. September die dänische Flotte ausgeliefert ist, bombardieren wir Kopenhagen.“

Arbeitshaus für Frauen – Die „Arbeitshäuser“ waren die Antwort der Plutokratie auf die von ihr hervorgerufene Entstehung eines industriellen Proletariats. Hier wurden Arbeitslose unter den entwürdigendsten Bedingungen zur Zwangsarbeit angehalten. Die Frauen waren, wie man sieht, Freiwild für die Londoner Kavaliere. – Aus der Pariser „Illustration“ (1849).
Und so geschieht es. Am 2. September beginnen die Geschütze von der See wie vom Land her die wehrlose Stadt zu beschießen. Fünf Tage später steht die halbe Stadt in Flammen, die Kathedrale und die Universität liegen in Trümmern; 1600 Menschen – Zivilbevölkerung der offenen Stadt – sind getötet. Der dänische Kommandant sendet einen Parlamentär, der ungleiche Kampf ist zu Ende. Dänemark kapituliert. Seine Flotte, die sich nun bei näherer Betrachtung als wenig gefährlich herausstellt, wird, so schnell es geht, seetüchtig gemacht und nach England abgeschleppt. Die meisten Schiffe werden als Handelsschiffe – verkauft! Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich die dänische Hauptstadt, ja die Wirtschaft des ganzen Landes von dem Schlage erholt, den ihr Englands Fürsorge für das Wohl der kleinen Staaten zugefügt hat …
Überfall auf Wehrlose oder schlechter Bewehrte, das blieb auch in dieser Zeit der Lieblingsgrundsatz der englischen Politik. Mit dem Einbruch in das holländische Kolonialreich hatte der Kampf gegen die französische „Tyrannei“ angefangen, mit dem Einbruch in das spanische Südamerika wurde er nun fortgesetzt. Spaniens König Karl IV. stand mit Napoleon im Bündnis.
Ein willkommener Anlas, die Völker Südamerikas zu „befreien“. Im Juni 1806 erschien eine englische Flotte im La Plata-Strom und landete eine Brigade. Buenos Aires wurde besetzt, und die englischen Agenten schickten nach London Triumphberichte über die Begeisterung, mit der die Bevölkerung die Befreier von der drückenden Tyrannei Spaniens begrüßt hätten. Einige Wochen später allerdings zeigten sich die Befreiten undankbar und nahmen die englische Brigade gefangen. Einem zweiten englischen General, der mit Verstärkungen aus London kam, erging es im nächsten Jahr nicht besser; ihm gelang nicht einmal mehr die Besetzung von Buenos Aires. Die siegreichen Argentinier gaben ihre Gefangenen nur heraus unter der Bedingung, dass die englische Flotte die südamerikanischen Häfen räume. Weder britische Propaganda noch britische Gewalt hatte die Leute von Buenos Aires vermocht, sich dem englischen Weltreich anzuschließen. Nur einen Erfolg hatte London zu verzeichnen: seine Flotte konnte die Küste Südamerikas blockieren. Kein spanisches, kein französisches Schiff lief in den Hafen ein. Einfuhr und Ausfuhr lagen still, solange den Engländern nicht erlaubt wurde, ihre Frachtschiffe auf der Reede vor Anker gehen zu lassen. Diese Notlage zwang den Vizekönig, das jahrhundertealte spanische Handelsmonopol fallen zu lassen und den Engländern freien Handel in Argentinien zu gewähren.
Noch rechnete man in London damit, dass man die übrigen südamerikanischen Kolonien auf dieselbe Art werde sturmreif machen müssen, und rüstete bereits neue Expeditionen aus, nach Venezuela, nach Mexiko – da nahmen die Dinge mit einem Schlage eine andere Wendung. Napoleon setzte die bourbonische Dynastie in Spanien ab (1808) und machte seinen Bruder Joseph zum König. Das spanische Volk aber erhob sich gegen die französische Herrschaft. Nun konnte man in London leicht das Steuer herumwerfen. Wellesley, dem der Oberbefehl über die Mexiko-Expedition zugedacht war, erhielt die Weisung, sich statt dessen mit seinen Truppen nach Portugal zu verfügen, um von dort aus dem spanischen Volke in seinem Freiheitskampfe beizustehen. Napoleon hatte seinen ersten schweren Fehler gemacht. Wellesley schloss mit der revolutionären Gegenregierung einen Bündnisvertrag ab, in dem er als Entgeld für die militärische Hilfe den freien Handel Englands nach den südamerikanischen Kolonien durchsetzt. Das wichtigste Bollwerk, das der Weltherrschaft der britischen Plutokratie noch entgegenstand, gefallen. Der Kattun, dem nun die Rolle, die einst das Goldne Vlies gespielt hatte, zugefallen war, hielt seinen Einzug in Südamerika. Auch in Brasilien. Denn Portugal hatte schon vorher, um sich Englands Hilfe gegen Napoleon zu sichern, auf alle Handelsbschränkungen in seinem Kolonialreich verzichten müssen.
Damit war in der ganzen von Europa her besiedelten Welt die „Freiheit des Handels“, das heißt die Wirtschaftsdiktatur Englands gesichert. Die Frage der politischen Zugehörigkeit dieser oder jener Kolonie zum britischen Staatsverband mochte später auf den Kongressen ausgehandelt werden. England beschränkt sich nun darauf, so viele Pfänder als möglich an sich zu nehmen, um sie gegebenenfalls später gegen Konzessionen wieder zurückzugeben. So etwa Niederländisch-Indien das nur so lange englisch blieb, als Holland unter französischer Herrschaft stand. Nein, England strebt nicht die Weltherrschaft im buchstäblichen Sinne des Wortes an. Es ist ihm vollkommen recht, wenn auch andere Völker die Lasten der Kolonialverwaltung auf sich nehmen – solange nur England die Schlüsselstellungen und die absolute Freiheit des Kaufens und Verkaufens hat.
So wird es ein symbolischer Vorgang, dass Napoleon sein Leben auf der Insel beschließt, die Englands Proviantstation auf dem Wege nach Indien war. Von dem Felsen St. Helenas herab konnte der gestürzte Kaiser sechs Jahre lang die Schiffe ankommen und absegeln sehen, die indische Baumwolle nach England und englischen Kattun wieder nach Indien brachten.

1807 veranlasste Canning als Außenminister die schamlose Expedition gegen das neutrale Dänemark, die mit der Zerstörung von Kopenhagen endete. In den zwanziger Jahren verschaffte er England die Handelsvormacht in Südamerika. – Gemälde von Thomas Lawrence.
Britannien war Herr der Meere geworden, und er hatte es nicht hindern können.
EIN HUNDERTJAEHRIGER „FRIEDEN“
Rußland oder die Angst um Indien
Man könnte meinen, mit dem Zusammenbruch des Napoleonischen Kaisertums wäre Englands einziges Kriegsziel erreicht gewesen, und es hätte nun die fernere Gestaltung Europas diesem selbst überlassen können. Aber ganz im Gegenteil. Der Leiter der englischen Außenpolitik, Lord Castlereagh, nahm an den Beratungen des Wiener Kongresses, an der Zeichnung der neuen Landkarte Europas also, in sehr nachdrücklicher und unzweideutiger Weise teil. Er hatte einen Lieblingsausdruck, den er auf alle Fragen anwandte: das „gerechte Gleichgewicht“. Dass die Großmächte des Festlandes einander die Waage hielten, das nannte er „gerecht“, und er hat nicht wenig dazu beigetragen, dass die Vorstellung sich in Europa verbreitete, als handle

Die Beschießung Kopenhagens
Da die dänische Regierung nicht gutwillig den Engländern ihre Kriegsflotte auslieferte, befahl der englische Befehlshaber das Bombardement auf die Hauptstadt des neutralen Landes (4. Sept. 1807). Gemälde von Chr. Aug. Lorentzen.
England nur im Sinne einer göttlichen Gerechtigkeit, wenn es die Bildung einer starken Kontinentalmacht verhindere.
Das „gerechte Gleichgewicht“ erforderte es zunächst, dass Frankreich noch vor Beginn der Beratungen als vollgültiges Mitglied in den Kreis der Großmächte aufgenommen wurde; denn das um seine festländischen Eroberungen wie um den größten Teil seines früheren Kolonialbesitzes verkleinerte Frankreich konnte nun von England als willkommener Bundesgenosse auf dem Festland angesehen werden, wenigstens solange es nicht die Scheldemündung und damit den Handel zwischen Mitteleuropa und Übersee in der Hand hatte, und dafür, dass dies nicht geschah, wusste Castlereagh zu sorgen. Die südlichen Niederlande wurden mit Holland zu einem Reich vereint, und als sie sich dann 1830 selbständig machten, wusste England es zu verhindern, dass Frankreich hier wieder Fuß fasste.

Dänemark hat nichts vergessen – Auf dieser Zeichnung aus dem Pariser „Charivari“ 66 vom Jahre 1864 bietet der Engländer dem Dänen seine Flotte als Hilfe gegen Preußen an. Doch der Däne antwortet in Erinnerung an die Beschießung Kopenhagens im Jahre 1807: „Danke schön, mein lieber Engländer, wir kennen eure Methoden, den Leuten zu helfen!“
Damit war also die Konstellation geschaffen, die bis in unsere Tage anhielt. Das Zeitalter des französischen Versallentum gegenüber England begann. So „gerecht“ Castlereagh es fand und viele, die nicht Engländer waren, mit ihm, daß ein Gleichgewicht in Europa hergestellt wurde, so ungerecht hätte er es gefunden, wenn man ihm mit der Forderung nach einem Gleichgewicht in den überseeischen Machtbezirken gekommen wäre. Hier war nichts gerecht als die unbeschränkte Vorherrschaft Englands. Nun erhob zwar niemand jene Forderung. Trotzdem, es war gut vorzubeugen. Keinesfalls durfte es geschehen, daß, ehe England es sich versah, wieder einmal eine andere Macht einen Vorsprung erhielt.
Die Macht nun, die sich damals drohend als zukünftiger Rivale und Gegner abzuzeichnen begann, war Russland. Noch vor fünfzig Jahren hatte man in London dieses Land fast wie eine englische Handelsniederlassung angesehen. Wie einfach war doch seit den Tagen Elisabeths das Geschäft gewesen! Man schickte Pfunde nach Russland, und dafür kamen all die wichtigen Materialien zum Schiffbau in reicher Fülle. „Dann allerdings, von etwa 1770 ab, hatte Russland die Kaiserin Katharina, sie wurde in London nicht wenig dafür getadelt, unvernünftigerweise versucht, sich wirtschaftlich von England unabhängig zu machen. Es hatte nicht nur andere Völker im Handel gleichberechtigt neben England gestellt, es hatte auch versucht, einen eigenen Außenhandel zu entwickeln. Und es hatte, was der Vorliebe der City für das Zarenreich endgültig den Stoß gab, sich zu diesem Zweck eine starke Stellung am Schwarzen Meer geschaffen. Russische Schiffe fuhren auf dem östlichen Mittelmeer, russische Kaufleute ließen sich in Ägypten nieder. Kein Zweifel, Russland bedrohte die Existenz des Türkischen Reiches, wie es bereits das nördliche Persien in seine Abhängigkeit gebracht hatte. Konnte es nicht „eines Tages auch der Übermacht Englands bedrohlich werden“? Unvergessen war in London der Augenblick, da sich Kaiserin Katharina an die Spitze der „Bewaffneten Neutralität“ gestellt und England in seinem Kaperkrieg gegen die neutrale Schiff-Fahrt so schwer gehemmt hatte. Unvergessen auch die Tage, da Zar Alexander 1. mit Napoleon Frieden geschlossen und eine neue Teilung der Erde vorbereitet hatte, wobei Russland dann das Erbe des Sultans anzutreten gedachte. Noch war es zwar nicht so weit, dass man im Unterhause, wie es später geschah, den Zaren den „natürlichen Gegner Englands“ nannte, ihn als Erzfeind und Ausgeburt der Hölle verschrie und in den hohen Tönen liberaler Propaganda die autokratische Herrschaftsform Russlands als eine Sünde wider den Geist der Humanität verdammte – aber alle diese Dinge bereiteten sich doch vor. Und soviel stand jedenfalls fest: Russland durfte nicht so stark aus dem Wiener Kongress hervorgehen, dass es dank seiner Bevölkerungsziffer ein militärisches Übergewicht in etwaigen Kämpfen um Vorderasien erhielt.
Um dieser Befürchtung Englands willen wäre es um ein Haar in Wien statt zu einer Neuordnung Europas zu einem neuen Kriege gekommen, in dem diesmal Österreich und Frankreich bereit waren, für England zu kämpfen. Erst das Entweichen Napoleons aus Elba brachte die Großmächte einander näher und veranlasste Russland, von seinen Forderungen abzustehen. Das „europäische Gleichgewicht“ war noch einmal gerettet.
Seitdem starrte England wie gebannt auf den Koloss im Osten, in ständiger Angst, die Weltstellung der City-Plutokratie könne durch Russland erschüttert werden. Und aus dieser Angst ergab sich etwas, was seltsam ist und doch nur allzu begreiflich: so sehr es London früher beklagt hatte, dass das Türkische Reich eine Sperre zwischen Europa und Indien legte, jetzt musste es diese Sperre zu erhalten versuchen. Denn wenn sie fiel, brach ein neuer Konkurrent in die Gebiete ein, die England als seine Domäne auszubeuten gedacht hatte. Indien und Europa durften also nicht näher miteinander verbunden werden, sondern mussten getrennt bleiben. Nun grenzte allerdings auch das Türkische Reich nicht an Indien, sondern zwischen beiden lag noch ein gewaltiger Raum, den Europa bisher kaum berührt hatte: Turkestan, Persien, Afghanistan. Von diesem Raum musste Europa, und das hieß natürlich zunächst Russland, unbedingt ferngehalten werden. Das konnte nur dadurch geschehen, dass England diesen Raum als ein einziges ungeheures Glacis ansah, auf dem es Posten zu fassen versuchte, um Russland den Weg nach Indien zu verlegen.
So begann mit dem Wiener Kongress ein fast hundertjähriger Kampf zwischen England und Russland, der erst beigelegt wurde, als die Konkurrenzangst Englands sich an einem neuen Rivalen entzündet dem Deutschen Reich der Bismarckzeit. Doch sind Stationen dieses Kampfes nicht, wie in dem großen Duell mit Frankreich, eine Kette von Kriegen. Nur einmal ist die Feindschaft mit Waffen ausgetragen worden: im sogenannten „Krimkrieg“ nämlich, der 1854 über die russische Forderung nach einem Protektorat über die christliche Bevölkerung der Türkei ausbrach. Wohl hatte der Zar Nikolaus I. seinem Einmarsch in die rumänischen Fürstentümer ein Angebot an England vorausgehen lassen, das manches Verlockende hatte; von einer Aufteilung des Türkischen Reiches war die Rede gewesen, bei der Russland den Besitz Konstantinopels sowie die Schutzherrschaft über Rumänien, Bulgarien und Serbien für sich wollte, England aber Ägypten überließ. Das hätte die Ausschaltung Frankreichs aus dem Orient bedeutet, die Erreichung also eines Zieles, für das England lange vergeblich gekämpft hatte. Aber die russische Gefahr schien den englischen Machthabern jetzt größer. Sie lehnten Ägypten ab und verbündeten sich vielmehr mit Frankreich. So verhinderten sie in Tat das Vordringen Russlands nach dem Mittelmeer, wenn auch nur um den Preis, dass die französische Konkurrenz hier jetzt immer aktiver wurde.

Der Tod Napoleons – Der Gouverneur von St. Helena, Sir Hudson Lowe, hat selbst zugegeben, dass er strikte Anweisung hatte, den gefangenen Kaiser mit kleinlicher Grausamkeit zu behandeln. So rächte sich England an dem großen Gegner, nachdem deutsche Soldaten ihn besiegt hatten! – Lithographie von Schuppan.
Der Krimkrieg war der einzige Fall seit dem Sturze Napoleons, wo England einen europäischen Festlandsdegen gegen die ihm bedrohlich scheinende Macht in Bewegung setzen konnte. Seitdem der Wiener Kongress das „Gleichgewicht Europas“ hergestellt hatte, mussten sich auch die englischen Methoden der großen Politik von Grund auf ändern. Man konnte jetzt die Macht des Gegners nicht mehr im Kriege, die die anderen für London führten, zerreiben, sondern man muss sie mit neuen Mitteln schwächen. Das eine war, dass man das Leben des „kranken Mannes am Bosporus“ auf jede Weise zu verlängern suchte. Das zweite, dass man propagandistisch die Solidarität der „freiheitlich regierten“ Staaten gegen die „despotisch regierten“ (Russland und je nach Bedarf auch Österreich oder Preußen) verkündete. So kam England dazu, der Anwalt der „unterdrückten Völker“ zu werden – wobei es allerdings entscheidend

Königin Victoria bei einer Truppenschau in Paris – Das Jahrhundert nach der Niederwerfung Napoleons stand im Zeichen einer immer stärkeren Anlehnung Frankreichs an England wie sie in dem gemeinsamen Kampf gegen Russland während des Krimkrieges ihren Ausdruck fand. – Aus der Pariser „Illustration“ (1858).
war, wer im jeweiligen Falle der „Unterdrücker“ war. Die christlichen Nationen der Türkei – zuerst die Griechen, dann die Rumänen, Serben und Bulgaren – erhielten in ihrem Freiheitskampf von England nur lahme Unterstützung oder gar keine, denn hier war ja der Sultan der Leidtragende. Umso glühender schlugen die Herzen der Londoner Plutokraten für die Polen. denn damit konnte man dem Zaren Schwierigkeiten machen. Ob Whig oder Tory, Liberaler oder Konservativer, das machte hier keinen Unterschied, und nicht ungern sahen es die Minister, wenn die künstlich gesteigerte Erregung der polenfreundlichen Presse ihnen die Möglichkeit gab, im Namen des gekränkten Weltgewissens dem Zaren das Gespenst eines Kreuzzugs gegen die Tyrannei vorzugaukeln. In ihren beiden großen Aufständen von 1830 und 1863 allerdings sollten die Polen wenig von der englischen Unterstützung merken; wohl floss einiges in ihre Kassen, aber der erwartete und versprochene Beistand blieb aus. „Die Polen können auf unsere Sympathien zählen, aber nicht auf unsere militärische Hilfe“, erklärte das englische Kabinett, und als die Polen sich über diese platonische Form der Hilfeleistung wenig erbaut zeigten, mussten sie es sich gefallen lassen, von dem englischen Premierminister im Unterhaus als „sehr kurzsichtige Politiker“ bezeichnet zu werden, weil sie angenommen hätten, es sei England möglich, den Polen militärische Hilfe zu bringen. „Nach Griechenland konnten wir mit unseren Schiffen kommen, aber nach Polen…?“ Nach dieser Seite gelang es also wohl, das Zarentum in der Weltmeinung zu kompromittieren, nicht aber ihm ernstlichen Schaden zu tun. So blieb denn doch nichts übrig, als dem Gegner unmittelbar ntgegenzuarbeiten auf dem Felde, auf dem man ihn erwartete, auf dem Vorfelde Indiens also.

„Hilfe für Polen“
Die Westmächte hatten den Polen vor ihrem Aufstand gegen Russland militärische Hilfe zugesichert. Als aber die Polen losschlugen, begnügte sich die Diplomatie Englands und Frankreichs mit der Übersendung von Noten und verhöhnte die polnische Vertrauensseligkeit – ein überraschend zeitnahes Bild! – Aus dem Pariser „Charivari“ (1863).
Als Händler waren die Engländer zuerst nach Indien gekommen, in Rivalität mit den anderen fahrenden Nationen Europas. Nachdem dann nacheinander Portugiesen, Holländer und Franzosen aus dem Handel hinausgedrängt waren, hatte sich die Ostindische Kompanie aus dem Zusammenbruch des Reiches der Großmoguln den fettesten Bissen zu sichern verstanden: die Steuerpacht in Bengalen. Damit war die Grundlage zur politischen Herrschaft über Indien gelegt, und die Generalgouverneure brauchten jahrzehntelang keine militärischen Aktionen zu unternehmen, um sie zu erweitern; es genügte, wenn sie in den zahlreichen Zwistigkeiten innerhalb der indischen Fürstentümer als Vermittler oder als Erpresser auftraten, die etwas unklaren indischen Rechtsverhältnisse nach ihrem Sinn beugten und im Eintreiben von Steuern sowie im Verhängen von Steuerstrafen rigoros vorgingen. Mit geringer Mühe nur konnten sie so den Reichtum Indiens in die Taschen der Aktionäre der City und nicht zuletzt auch in ihre eigenen fließen lassen. Zeigte sich irgendwo Unzufriedenheit, so genügte ein kleines Aufgebot der eingeborenen Truppen, der Sepoys, um die Fügsamkeit wieder herzustellen. Solange England die Meere beherrschte, konnte ihm niemand, so schien es, diese unerschöpfliche und so bequem auszubeutende Quelle des Gewinns streitig machen.
Napoleons Zug nach Ägypten aber hatte gezeigt, dass eine Bedrohung der englischen Herrschaft in Indien möglich war. Truppen aus Indien hatten den Türken zu Hilfe kommen müssen und vertrieben schließlich die Franzosen ganz und gar aus dem Orient. De Angriff war misslungen, und ebenso misslangen die Versuche französischer Agenten, indische Fürsten zu Aufstand gegen die englische Herrschaft zu vereinigen. Trotzdem war England beunruhigt; es konnte nicht mehr erwarten, dass Indien nach wie vor ein mühelose Beute seiner Aussaugungsaktionen bleiben werde. Man musste die Stellung stärken, nach innen wie nach außen.
Die Antwort auf Napoleons ägyptische Expedition war ein Umschwung in der Politik der Ostindische Kompanie. Die Generalgouverneure begannen jetzt, den „Schutz“ eines nach dem anderen der indischen Fürstentümer zu übernehmen. Zum Unterhalt der Schutztruppen traten dann in den betreffenden „Verträgen“ die Fürsten die für die Kompanie wichtigsten Gebiete ganz ab und zahlten überdies einen jährlich Tribut. Die Kompanie, nach wie vor eine private Aktiengesellschaft, wurde auf Weise zum Träger politischer Souveränität.

Warren Hastings (1733-1818) Der Nachfolger Lord Clives als Generalgouverneur von Indien erweiterte das britische Herrschaft mit allen Mitteln brutaler Erpressung und niederträchtiger Hinterlist gegenüber den einheimischen Fürsten. – Nach dem Gemälde von Thomas Lawrence.
Zur gleichen Zeit also, wo die europäischen Großmächte ganz von ihrem Ringen mit Napoleon in Anspruch genommen waren, setzte sich England in Besitz ganz Indiens, ein Vorgang, der in Europa fast unbeachtet blieb. 1798 wurde Audh, 1800 Maisur in das „Schutz“ verhältnis zur Ostindischen Kompanie gebracht und damit die Verbindung zwischen West- und Ostseeküste der Halbinsel hergestellt. 1801 fiel das Karnatik an die Engländer, 1802 der Dekkan, 1803 die Bezirke nördlich des Ganges. 1809 wurde mit den Sikhs ein „Freundschaftsvertrag“ geschlossen, 1814 bis 1816 die Gurkhas niedergeworfen, 1817 bis 1820 die letzten selbständigen Volksgruppen auf der Halbinsel unterjocht.
Doch wenn die Londoner Plutokratie gemeint hatte, jetzt sei sie in der Ausbeutung Indiens ungestört, so hatte sie sich getäuscht. Die Zeiten, da man nur auf indischem Boden mit Indern gegen Inder um Indien zu kämpfen brauchte, waren unwiederbringlich vorbei. Wollte England jetzt Indiens sicher bleiben, so musste es danach streben, die Wege nach Indien in seine Hand zu bekommen.
Denn auch Russland war inzwischen nicht untätig gewesen. Es begann nach Persien und nach Turkestan hinüberzugreifen, nicht wie Napoleon, um die englische Weltherrschaft zu bedrohen, ja wohl überhaupt ohne sich eines Gegensatzes zu England so recht bewusst zu sein, sondern einfach, weil es dem Gesetz seines Wachstums folgte. Nur die plutokratische Angstpsychose in London schob Russland Angriffspläne gegen Indien unter.
Dem Verlangen, Russland zuvorzukommen, entsprangen nämlich die englischen Versuche, sich Afghanistan zu bemächtigen. An sich wäre das Land das von riesigen Bergwällen wie von einer natürlichen Festung umgeben ist, wohl kaum so bald in den Bereich der britischen Interessen gerückt. So aber setzte es sich die Ostindische Kompanie in den Kopf, durch engelandhörige Fürsten aus Afghanistan einen Wall gegen das weitere Vordringen Russlands zu machen. Den Vorwand dazu gab ein persischer Angriff auf Herat (1837), bei dem russische Instruktionsoffiziere mitwirkten. Zwar hoben die Perser auf die englischen Vorstellungen hin nach kurzer Zeit die Belagerung wieder auf; aber das änderte nichts. Man war in Kalkutta nun entschlossen, aus Afghanistan einen unter englischer Vormundschaft stehenden Pufferstaat zu machen.

Die Justiz hilft dem Räuber, seine Beute in Sicherheit zu bringen
Eine Karikatur des englischen Zeichners James Gillray auf den langsamen Gang des Prozesses, den einige Mitglieder des Unterhauses gegen Warren Hastings wegen seiner räuberischen Praktiken in Indien angestrengt hatten.
Das Unternehmen endete mit einer Katastrophe. Zwar gelang es den englischen Truppen, zum größten Teil indischen Sipoys, Kabul, die Hauptstadt Afghanistans, zu nehmen und den englischen Thronkandidaten einzusetzen (1839). Aber es war nur ein Schein. sieg. Die freiheitsliebenden Afghanen waren nicht gesonnen, sich durch fremde Gewalt einen ihnen unliebsamen und überdies unfähigen Herrscher aufzwingen zu lassen, und empörten sich nach wenigen Jahren. Die britischen Besatzungstruppen und Beamten wurden gezwungen, das Land zu verlassen, gerieten auf dem Marsch über den Khaiher- Pass in einen Hinterhalt der Afghanen und fanden hier alle den Tod. Nur ein einziger, ein Arzt, kam zurück, um die schreckliche Kunde nach Indien zu bringen.
Die Rückwirkung dieser Katastrophe auf Indien war gewaltig. Das Ansehen der englischen Herrschaft war schwer erschüttert, und die Generalgouverneure wussten nur ein Mittel, es. wiederherzustellen: neue kriegerische Aktionen. Wo o aber den Anlass zu solchen hernehmen? Zuerst versuchte man es mit einer Art Strafexpedition gegen Afghanistan. Der große Markt in Kabul wurde von britischen Truppen zerstört, die nach dieser Demonstration ihrer „Stärke“ das Land schleunigst wieder verließen. Doch es half dem Generalgouverneur wenig, dass er einige bei dieser Gelegenheit angeblich erbeutete (in Wirklichkeit aber unechte) Tempeltore im Triumph durch Indien führen und eine Denkmünze auf die „Wiederherstellung des Friedens in Asien“ prägen ließ; der Sieg war zu billig erfochten, als dass er die Zweifel der Inder an der Unbesieglichkeit Englands hätte niederschlagen können. So beschloss denn der Gouverneur, die Inder selbst für die Niederlage büßen zu lassen.
Sind, das Land am Unterlauf des Indus, war ein Fürstentum, dessen Unabhängigkeit England wiederholt, zuletzt 1832, in feierlichen Verträgen anerkannt hatte. England hatte schon vertragswidrig gehandelt, als es Sind zum Aufmarschgebiet gegen Afghanistan machte; denn die Verträge untersagten englischen Truppen den Aufenthalt im Lande. Vollends vertragswidrig aber war, dass Kalkutta nun ein Expeditionskorps nach Sind schickte, um von den Fürsten den angeblich rückständigen Tribut für die englische Kreatur auf dem Throne Afghanistans einzutreiben. Der Forderung fehlte jede Rechtsgrundlage, und darum musste der Versuch, sie mit Gewalt durchzusetzen, auf heftigen Widerstand stoßen. Mit solchem Widerstand hatte der englische Resident in Haiderabad, Sir Charles Napier, von vornherein gerechnet – es gehörte zu seinem Programm. Tatsächlich empörten sich denn auch die fürstlichen Garden, als man sie entwaffnen wollte, um britisch-indische Truppen an ihre Stelle zu setzen. Der Vorwand zum Kriege war da. Die überlegene Bewaffnung der europäisch geschulten Eindringlinge entschied den Kampf bald zu ihren Gunsten. Sind wurde dem Besitz der Ostindischen Gesellschaft einverleibt. Es war ein Stück unverhüllter Raubpolitik, und Napier selbst, der nicht zu den frömmelnden, sondern zu den zynischen unter den englischen Eroberern gehörte, nannte es ein „sehr vorteilhaftes, nützliches und humanes Stück Schurkerei“. Aber gegen die vollendete Tatsache half kein Protest.
Zur Wiederherstellung des Respekts vor der Unwiderstehlichkeit der britischen Macht genügte allerdings auch dieser Gewaltstreich nicht. Die wehrhafte religiöse Sekte der Sikhs, der im Fünfstromlande, dem Panjab, die Führung zugefallen war, trotzte den Engländern und rückte im Dezember 1845 in das Gebiet der Kompanie ein. Erst nach langen Kämpfen und schweren Verlusten gelang es den britischen Truppen, die tapferen und europäisch geschulten Sikhs niederzuringen und damit auch das Fünfstromland dem indischen Reich einzuverleiben.
Durch diese Erfolge nun wurde die Verwaltung in Kalkutta siegestrunken und fühlte sich stark genug, die Abrundung des britischen Besitzes mit denselben brutalen Mitteln fortzuführen. Als sei er nicht der Beamte einer Aktiengesellschaft, sondern der Kaiser von Indien selbst, verfügte der Generalgouverneur willkürlich nach indischem Lehnsrecht und zog Fürstentümer ein, die durch Mangel an Erben angeblich „verfallen“ waren. Dieses bequeme Verfahren ergab schon ganz beträchtliche Landstriche, und da man gerade im Zuge war, so fügte man diesen „Einziehungen verfallener Lehen“ auch den volkreichen Staat Audh hinzu. Dessen König mangelte es zwar keineswegs an Leibeserben, aber dafür fand Kalkutta eine andere Handhabe. Vor einigen Jahren nämlich hatte man dem König einen Vertrag auferlegt, wonach „im Falle großer Misswirtschaft“ die Kompanie berechtigt sei, die Verwaltung des Landes zu übernehmen. Zwar hatte man in London aus Angst vor einem neuen Kriege diesen Vertrag verworfen, so dass er also nicht in Geltung war. Aber Kalkutta hatte es vorsorglich unterlassen, dem Könige von dieser Verwerfung Mitteilung zu machen, und so konnte es nun, sowie es Ihm gut dünkte, sich auf den Vertrag berufen. Denn „große Misswirtschaft“ festzustellen, machte natürlich nicht die geringste Schwierigkeit. Der König, zu dessen „Schutz“ die britischen Truppen ursprünglich ins Land gekommen waren, wurde nun kurzerhand abgesetzt und Audh zu einer Provinz Britisch-Indiens erklärt. Doch noch fehlte dem Werke die Krönung, noch gab es nämlich in Delhi den Kaiser von Indien, den Nachfahren der Großmoguln, der dem Rechte nach der Oberherr aller indischen Fürsten und somit auch der Ostindischen Kompanie war. Mochte auch die tatsächliche Macht der letzten Kaiser noch so schattenhaft sein, es konnte doch geschehen, dass sie eines Tages wieder emporstieg. Bisher hatte man es nicht gewagt, die Träger des ehrwürdigen Titels anzutasten, ja bis 1835 hatten die Münzen der Kompanie noch das kaiserliche Hoheitszeichen gezeigt. Jetzt aber fühlte man sich stark genug, die Maske der Unterordnung fallen zu lassen. Ja, der Generalgouverneur Lord Canning wartete nicht einmal den Tod des fast neunzigjährigen Kaisers Bahadur Schah ab, sondern verfügte 1856, dass mit dessen Ableben der Kaisertitel als erloschen zu gelten und die kaiserliche Familie den Palast in Delhi zu verlassen habe.

Die Schlacht bei Miani Der Einfall in den Staat Sind am Unterlaufe des Indus (1843) gehört zu den brutalsten Völkerrechtsbrüchen der britischen Kolonialgeschichte. Die Engländer hatten die Unabhängigkeit des Staates feierlich anerkannt und benutzten lächerliche Vorwände, das tapfere Volk der Belutschis trotzdem zu unterjochen. – Gemälde von Armitage.
Treu und Glauben verletzen, beschworene Verträge brechen und dabei doch von den Indern Treue verlangen – das war also jetzt die englische Politik in Indien. Dabei merkten die leitenden Stellen in Kalkutta gar nicht, dass sie im Begriff waren, den Bogen zu überspannen. Die Einziehung der Fürstentümer hatte viele, die früher zu den Besitzenden gehörten, hart getroffen; englische Beamte schoben sie aus den Verwaltungsstellen; mancher Besitztitel auf Grund und Boden wurde von den neuen Herren nicht anerkannt; entlassene eingeborene Soldaten mussten betteln gehen; gerade die höheren, stolzen Kasten der Hindus wurden durch das rigorose Vorgehen der Engländer in Armut gestürzt. Und dazu kam der Unwille über die Abschaffung vieler religiöser Gebräuche, von denen gewiss manche, wie die Witwenverbrennung oder die Ertränkung von Kindern im Ganges, für europäische Begriffe etwas unheimlich Barbarisches hatten, die aber doch durch jahrtausendelange Übung geheiligt waren. Früher hatte man, an mancherlei Fremdherrschaft gewohnt, auch die der Engländer mit Ergebenheit hingenommen; jetzt aber begann man zu fragen, ob diese Weißen nicht mit bösen Geistern im Bunde seien, um so mehr, als sie bei allen ihren befremdlichen Maßnahmen geflissentlich über die Empfindungen der Bevölkerung hinweggingen; sie sahen von der Höhe ihrer Zivilisation verächtlich auf sie herab.
In diese Stimmung des wachsenden Misstrauens kamen die Nachrichten vom Krimkrieg. Sie liefen von Mund zu Mund durch Indien. Die englischen Truppen konnten vor Sebastopol keine Erfolge erringen: Krankheiten hatten gewütet, der Sanitätsdienst versagt. Wieder einmal also hatte sich erwiesen, dass England nicht unverwundbar war!

Englands Rache an Indien Dieses Photo von 1857 wurde 1939 von der englischen Zeitschrift“ Picture Post“ veröffentlicht. Es zeigt die Methoden, mit denen die englischen Behörden nach der Niederwerfung des Sepoy-Aufstandes vorgingen. „Die Hinrichtungen von Eingeborenen geschahen ganz summarisch und wahllos“, berichtet ein englischer Augenzeuge.
Und jetzt die Absetzung des Kaisers! Sie musste vor allem die Mohammedaner empören; denn mit ihr war die letzte Erinnerung an die großen Zeiten des Islam in Indien ausgetilgt. Aber die Regierung in Kalkutta merkte nichts von dem Bedrohlichen, das sich gegen sie vorbereitete. Sie wusste nicht, dass Prophezeiungen im Volke umliefen, die englische Herrschaft würde nur hundert Jahre währen, müsse also, da sie mit der Schlacht bei Plassey 1757 begonnen hatte, im Jahre 1857 ein Ende finden. Sie achtete nicht auf die Sturmzeichen, die unverkennbar am Himmel standen. Bengalische Regimenter weigerten sich, zu Schiff in eine andere Garnison zu gehen, weil ihre Kastenvorschriften ihnen die Seereise verboten. Kalkutta forderte darauf von jedem Rekruten eine Erklärung, nach der er sich verpflichten musste, auch jenseits des Meeres zu dienen. Ein neuer Beweis, wie wenig die Engländer, die die Gottesfurcht ständig im Munde führten, bereit waren, auf die Gottesfurcht anderer Völker Rücksicht zu nehmen. Begreiflich genug, dass sich nun unter den den höheren Kasten angehörigen Soldaten die Sorge verbreitete, die Regierung wolle sie ihrer Kaste berauben. Unter solchen Umständen bedurfte es nur noch eines geringfügigen Anlasses, das Gewitter zur Entladung zu bringen. Die kleinste Unachtsamkeit gegenüber den religiösen Vorstellungen der Inder musste die gewaltigsten Folgen nach sich ziehen.
Nun hatte man vor kurzem in der britisch-indischen Armee ein neues Gewehrmodell eingeführt, das Enfield-Gewehr. Es hatte die Eigentümlichkeit, dass beim Laden ein Stück der Patronenhülse weggerissen werden musste, was am schnellsten ging, wenn die Soldaten die Zähne dazu benutzten. Da die Patronen eingeschmiert waren, kamen also die Lippen der Soldaten bei diesem Vorgang mit Fett in Berührung. Ob nun wirklich die Militärverwaltung in der Munitionsfabrik von Dum-Dum bei Kalkutta zur Einfettung der Patronen Rinder- und Schweinefett benutzte oder ob sie nur verabsäumte, die Soldaten ausdrücklich davon in Kenntnis zu setzen, dass weder Rinder- noch Schweinefett benutzt wurde, lässt sich nicht mehr feststellen; in beiden Fällen hatte sie sich jedenfalls der Achtlosigkeit gegenüber den religiösen Gefühlen der Sepoys schuldig gemacht, und somit trug sie die Verantwortung für alles, was nun geschah.
Das Schicksalsjahr 1857 hatte nämlich eben begonnen, als es sich begab, dass ein Soldat, der der Brahmannenkaste angehörte, einem Munitionsarbeiter, der ein Paria war, einen Trunk Wasser verweigerte. Höhnisch erwiderte ihm der Paria: sie alle würden nun bald Parias sein; denn ihre Lippen seien beim Laden der neuen Gewehre mit Rinder- und Schweinefett in Berührung gekommen! Mochte nun das, was der Paria sagte, der Wahrheit entsprechen oder nicht – mit unheimlicher Geschwindigkeit verbreitete sich die Kunde von diesem neuen Sakrileg der Engländer unter den eingeborenen Soldaten und mit ihm Entsetzen und Empörung – auch bei den Mohammedanern; denn ihnen war Schweinefett ein Greuel.

Hinrichtung aufständischer Sepoys. Für die Vollstreckung der massenhaften Todesurteile an den aufständischen indischen Soldaten erfanden die englischen Offiziere eine neue Hinrichtungsart: die Verurteilten wurden vor Kanonen gebunden und so „in die Luft geblasen“. Gemälde des russischen Malers Wassilij Wereschtschagin
Aber noch immer tat die Regierung in Kalkutta nichts. um den aufziehenden Sturm zu beschwichtigen. Sie hielt es nicht einmal für nötig, das Gerücht (wenn es eins war) zu dementieren. Als sich dann aber bei einer Schießübung eine ganze Formation, neunzig Mann, weigerte, die Patronen zu berühren, wurde sie vor ein Kriegsgericht gestellt und zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Das geschah zu Mirat unweit Delhi, der stärksten Garnison des Nordwestens. Am nächsten Tage schon meuterte die gesamte Garnison, befreite die Gefangenen, tötete ihre englischen Offiziere und marschierte nach Delhi, wo sich ihr die mohammedanische Bevölkerung anschloss. Der neunzigjährige Kaiser Bahadur Schah wurde zum Herrscher Indiens ausgerufen …
Entsetzlich rächten sich nun die Sünden der britischen Verwaltung. Die Landschaft um Delhi, ganz Audh und große Teile Mittelindiens standen in offenem Aufruhr. Es gab Orte, wo die gesamte weiße Bevölkerung den Tod erleiden musste, und die Verluste der englischen Truppen gingen in die Zehntausende. Wenn es der Regierung trotzdem gelang, des Brandes Herr zu werden, so nur deshalb, weil sie auch jetzt wieder sich der inneren Gegensätze in Indien bedienen konnte. Noch wurzelten in manchen Gebieten die uralten Feindschaften tiefer als der Hass gegen England. Die Panjabi, eine der wehrhaften Gemeinschaften im Fünfstromlande, verabscheuten die Hindus, die Sikhs die Mohammedaner von Delhi – beide wurden von den Engländern als Verbündete gewonnen, und so verhalfen noch einmal indische Truppen England zur Herrschaft über Indien.

Englands Kulturmission in Indien
Die hemmungslose Grausamkeit und Willkür, die die englische Soldateska nach der Niederwerfung des Sepoy- Aufstandes von 1857 gegen Frauen und Kinder walten ließ, erregte in ganz Europa Empörung. – Zeichnung von Gustave Dorè.
Wild und unbarmherzig war der Kampf geführt worden, und es wäre zu begreifen gewesen, wenn die Engländer gegen die unterlegenen Aufständischen ein strenges Gericht hätten ergehen lassen. Aber was sie, wieder im Besitz der Macht, übten, war mehr als Strenge – es war grausame Lust an der Rache. Sie, die angeblich nach Indien gekommen waren, um dort die Segnungen der Zivilisation und der Humanität zu verbreiten, boten jetzt dem indischen Volke das Schauspiel blutrünstigster Barbarei. Unschuldige wie Schuldige verfielen der hemmungslosen Vergeltungswut. Dörfer wurden angezündet, die Bewohner ohne Gerichtsverfahren an den Bäumen der Straße erhängt, Frauen und Kinder hingemordet, und für die aufständischen Sepoys wurde eine neue Art der Todesstrafe ersonnen: sie wurden vor die geladene Kanone gebunden…
Aber nicht nur Indien selbst, sondern auch der Weg nach Indien musste gesichert werden. Zu der Gefahr, die man von Russland drohen sah, gesellte sich die andere, dass England von Indien abgeriegelt werden könnte. Den Weg nach Indien zu einer englischen Straße zu machen, musste also ein wichtiges Ziel der englischen Politik sein. Um dieses Zieles willen hatte England auf dem Wiener Kongress von der holländischen Kolonialbeute gerade Ceylon und die Kapkolonie, das „Haus auf dem halben Wege nach Indien“, behalten, während es den wirtschaftlich gewiss ergiebigeren Sunda-Archipel an Holland zurückgab. Der ungehinderte Seeweg nach Indien, der in Kriegszeiten sowohl Truppen als Waren zugute kommen sollte, war eine Voraussetzung der englischen Weltherrschaft geworden. Darum hatte London aus der Teilung des napoleonischen Reiches eine weitere Station an sich gebracht: die Insel Manritius auf dem halben Wege zwischen Afrika und Indien. Denn solange England die türkische Sperre selbst wirksam erhielt, war nicht das Mittelmeer, sondern der Ozean die lebenswichtige Straße. An diesem Interesse an „Unterkunftshäusern“, wie sie der gemütlich-zynische Lord Palmerston nannte, erklärt sich auch ein neues Raubstück der britischen Politik: die Besetzung von Aden. Dass dieser Platz einmal durch das Mittelmeer von großer Bedeutung sein könnte, daran dachte damals niemand in London.

Ein Bild aus Indiens Kampf um die Freiheit Zwar werfen die indischen Baumwollspinnereien, an denen fast nur englisches Kapital beteiligt ist, hohe Dividenden ab, in manchen Jahren 400 Prozent. Aber ein Fünftel der indischen Bevölkerung ist unterernährt. Allein in den Jahren 1860-1909 starben 30 Millionen Menschen den Hungertod. Wer aber für ein menschenwürdiges Dasein demonstriert, wird mit der blanken Waffe bekämpft.
Ein willkommener Vorwand bot sich, als im Jahre 1837 der Scheich, zu dessen Gebiet Aden gehörte, einen gestrandeten englischen Dampfer als Strandgut behandelte, nach den arabischen Gesetzen durchaus zu Recht. Die Verhandlungen, die der englische Kapitän Heines im Angesicht der Mündungen englischer Schiffsgeschütze mit dem Scheich führte, endeten programmgemäß mit der Abtretung des Hafens gegen eine jährliche Summe, und als der Scheich im nächsten Jahre so unvorsichtig war, die Gültigkeit des erpressten Vertrages in Zweifel zu ziehen, da bot sich die Gelegenheit, Aden nach vorangegangenem Bombardement zu stürmen und es dann ohne Entschädigung dem britischen Kolonialreich einzuverleiben. Es wurde eine der wichtigsten, aber auch unbequemsten Kolonien, die England je gehabt hat; das mörderische Klima machte eine Versetzung von Beamten und Offizieren, dorthin jedes Mal zur Strafversetzung, und die unablässigen Versuche der arabischen Fürsten, mit Waffengewalt ihr Eigentum zurückzugewinnen, gestalteten den Aufenthalt nicht erfreulicher. Aber an Aden wurde zäh festgehalten.
Ebenso zäh widersetzte sich England allen Versuchen, die türkische Sperre an der für den Weg nach Indien entscheidenden Stelle zu durchbrechen: an der Landenge von Suez. Noch einmal sollte sich hier der charakteristische Zug in der Entwicklung des britischen Weltreichs wiederholen: England sah mit Widerstreben zu, wie andere die Verhältnisse der Welt umformten, und stellte sich dann in letzter Stunde ein, um seine Forderungen auf Beteiligung anzumelden …
Ursprünglich hatte England gehofft, auch Ägypten werde sich im Verbande des Türkischen Reiches halten lassen. Möglichst wenig Fortschritt, möglichst wenig Zivilisation in jener Gegend – das war ja nun sein Prinzip geworden. Darum war es ihm höchst unlieb gewesen, dass es dem Nillande unter der Führung des tatkräftigen Mehemet Ali im Jahre 1839 gelungen war, sich praktisch von dem Sultan unabhängig zu machen. Vollends peinlich überrascht aber war man in London, als während des Krimkrieges (1854) der eigene Verbündete, Frankreich, sich vom Sultan eine Konzession für den Bau eines Kanals durch die Landenge von Suez erteilen ließ. Als daher der unermüdliche Verfechter des Kanalprojekts, Ferdinand von Lesseps, den Londoner Geldmarkt für die Aufbringung des nötigen Kapitals zu interessieren versuchte, winkte die Regierung energisch ab. „Das Projekt“, so erklärte Lord Palmerston, „ist den Interessen unseres Landes ausgesprochen feindlich und widerspricht der Politik, die England hinsichtlich der Verbindung Ägyptens mit der Türkei verfolgt.

Gemordete indische Nationalisten – ein alltägliches Bild
Über ein Drittel der Staatsausgaben Britisch- Indiens werden für den Heeresetat verwandt, also zur Aufrechterhaltung der englischen Zwangsherrschaft, nur ein Sechzehntel dagegen für soziale und kulturelle Zwecke. Die indische Nationalpartei kämpft einen zähen Kampf um die Hebung des materiellen und des geistigen Niveaus der Massen.
Die offenkundige politische Absicht des ganzen Unternehmens ist, die Trennung Ägyptens von der Türkei zu erleichtern, und dahinter stehen Spekulationen, „wie man leichter zu unseren indischen Besitzungen gelangen kann, eine Andeutung, die ich nicht näher auszuführen brauche…“ Kein patriotischer Engländer also durfte es wagen, eine Aktie für diesen umstürzlerischen Kanal zu erwerben, und in der Tat musste Lesseps auf England verzichten. Französische Kapitalisten zeichneten die eine Hälfte des benötigten Aktienkapitals, der Pascha von Ägypten die andere. So kam auch diese wahrhaft Epochemachende Tat, weit- politisch wohl die wichtigste seit der Entdeckung Amerikas, ohne englische Mitwirkung zustande. Allerdings stand hinter Londons ablehnender Haltung die Hoffnung, dass aus dem Projekt nichts werden würde; hatten doch englische Fachleute den Kanalbau für eine technische Unmöglichkeit erklärt. Je mehr der Bau nun aber voranschritt, desto aufmerksamer musste man in London auf die Folgen sehen, die sich aus seiner Vollendung ergeben würden. Auch England konnte dann nicht umhin, den neuen kürzesten Seeweg nach Indien zu benutzen – und es hatte doch weder wirtschaftlich noch politisch einen Einfluss auf die Verwaltung des Kanals! War

Nach dem Muster des Burenkriegs: Konzentrationslager für Inder Auch der schärfste Terror kann die indischen Nationalisten nicht von dem Kampf um die Lebensrechte ihres Volkes abschrecken. Schmachten die Führer hinter dem Stacheldraht der Konzentrationslager, so treten andere für sie ein.
diese Sorge nicht ein starker Anreiz, sich wieder einmal, wie schon so oft in der Geschichte der englischen Weltherrschaft, der Früchte fremder Arbeit zu bemächtigen, sobald sich eine günstige Gelegenheit bot?
Die Vollendung des Suez – Kanals erfüllte Palmerstons Prophezeiung: Ägypten wurde nunmehr ganz unabhängig von der Türkei, und zum äußeren Zeichen dessen erhielt der Pascha den Titel „Khedive“, Vizekönig. Aber trotz dieser Rangerhöhung stand es bald sehr schlecht um die ägyptischen Staatsfinanzen. Der Khedive Ismail war in seinen jungen Jahren ein rechter levantinischer Geschäftsmann und Börsenspekulant

Ein Plan des Suez-Kanals aus der Zeit seines Baues
Ferdinand von Lesseps, nicht nur der Erbauer des Kanals, sondern auch ein gewandter Propagandist seiner Unternehmung, gab diesen Prospekt heraus. Vergeblich hatte England aus egoistischen Gründen den Durchstich der Landenge zu verhindern gesucht. – Nach einer Veröffentlichung der englischen Zeitschrift „Picture Post“ aus dem Jahre 1939.
gewesen, und er ließ auch als Monarch von diesen Gewohnheiten nicht. Sein Ehrgeiz war nicht nur, Ägypten zum ersten Baumwolland der Welt zu machen, sondern auch an der Baumwollproduktion groß zu verdienen. Dazu musste aber erst einmal viel Kapital hineingesteckt werden, und da die ägyptische Volkswirtschaft durch den Suez-Kanal eher Einbuße erlitt als Vorteil gewann, musste er Auslandsanleihen aufnehmen, und dann wieder neue Anleihen, um den Zinsendienst der alten zu bestreiten. Die erwarteten schnellen Gewinne blieben aus, und so wurde das Anleihesystem eine Schraube ohne Ende. Die ägyptischen Staatspapiere standen tief im Kurs auf den europäischen Börsen, und es war zu befürchten, dass eine neue Anleihe nicht mehr unterzubringen sein würde. In dieser Lage kam Ismail auf den verzweifelten Gedanken seine Suez-Kanal-Aktien zu verkaufen.
Ein kleiner französischer Bankier in Alexandria, dessen Geschäftspartner Ismail früher gewesen war, erhielt den Auftrag, ein Konsortium von Käufern zu finden, und er versuchte sein Glück natürlich zuerst in Paris, wo aber die Börsenwelt nur wenig Lust zeigte. Während hier die Verhandlungen sich festliefen, machte ein gewisser Henry Oppenheim, ein jüdischer Bankier, der früher selbst zu den Finanziers des ägyptischen Staates gehört hatte, den Londoner Rothschilds Mitteilung von den Absichten des Khedive, und durch Rothschilds Vermittlung erfuhr die englische Regierung davon. Der jüdische Premierminister Disraeli war schnell gewonnen. Da das Parlament in den Ferien war, setzte er sich kurzerhand über die Verfassungsbestimmungen hinweg und veranlasste Rothschild, dem Schatzamt die erforderliche Summe vorzustrecken. Im tiefsten Geheimnis wurden die Verhandlungen mit Kairo geführt, derweil Oppenheim es unternahm, durch Scheingebote die Pariser Geschäftswelt an der Nase herumzuführen. Der Streich gelang, die Welt war völlig überrascht, als die Abendzeitungen am 26. November 1875 zu berichten wußten, dass die britische Regierung die Hälfte der Suez – Kanal – Aktien zu einem Preise von 4 Millionen Pfund Sterling (etwa einem Zehntel des wirkliches Wertes, wie sich später herausstellte) gekauft hatte. So hatte England also doch noch nachträglich den Schlüssel zu Indien gelegt, und Disraeli versäumte nicht, sich für diese Tat gebührend preisen zu lassen. Ja, er machte sogar eine patriotische Ruhmestat ersten Ranges daraus.
Denn er erzählte den ehrfürchtig lauschenden Engländern, wie nur durch sein Wachsamkeit vermieden worden sei, dass „Agenten einer fremden Macht“ die begehrte Beute an sich rissen. Tatsächlich streute er der Mitwelt bewusst sand in die Augen. Denn die Regierung der Republik in Paris hatte nicht die mindeste Neigung, als Konkurrent aufzutreten. Zum ersten wünschte sie nicht, sich England zum Feinde zu machen, und zum zweiten fürchtete sie die Rückwirkungen auf den Kurs der ägyptischen Staatspapiere. Wirklich zogen diese auch, sowie bekannt wurde, dass England für das ägyptische Geschäft zusagte, in einer für den französischen Rentner und Spekulanten höchst erfreulichen Weise an.
So war von anderen die Bresche in die Sperre zwischen den mittelländischen und den indischen Bereich gelegt worden, und England hatte sich wohl oder übel mit in sie hineinstürzen müssen. Seine Befürchtungen, dass die Durchstechung der Landenge zwischen Mittelmeer und Rotem Meer seiner Handelsüberlegenheit nachteilig sein werde, sollten sich im Laufe der Zeit als nur zu berechtigt erweisen. Bisher waren die Häfen des Mittelmeergebiets – Triest, Genua, Marseille, Odessa – ausschließlich Levantehäfen gewesen; für den Handel mit Indien und dem Fernen Osten, der sich in eben diesen Jahrzehnten dem Verkehr mit Europa öffnete, hatten sie keine Bedeutung gehabt. Die Weltbeherrschende Stellung der englischen Wirtschaft beruhte nicht zuletzt darauf, dass die meisten europäischen Länder genötigt waren, in London das einzukaufen, was sie an asiatischen Waren gebrauchten. Nun lagen durch den Suez Kanal diese Häfen näher an Indien und China als London, und es konnte nicht lange währen, bis England seine Position als Verteiler auf dem Weltmarkt einbüßte. Es ist nie die starke Seite englischer Staatsmänner gewesen, die Folgen weltpolitischer Umwälzungen klar vorauszusehen und ihre Maßnahmen danach einzustellen. Hätte Disraeli von dieser Regel eine Ausnahme gemacht, so müsste er jetzt alles darangesetzt haben, für den zu erwartenden Ausfall Ersatz zu schaffen, die Produktionsmethoden der Industrie zu verbilligen, kurz: dafür zu sorgen, dass der Vorsprung, den die industrielle Revolution für Englands Industrie, Handel und Schiff-Fahrt gebracht hatte und von dem es nun seit Beginn des Jahrhunderts zehrte, erhalten blieb. Aber er tat nichts dergleichen. Er merkte sowenig wie die damaligen Herren der City, dass England nunmehr den Zenit seiner Laufbahn überschritten hatte und dass nur neue, ungeahnte Anstrengungen einen Abstieg verhindern konnten. Er sonnte sich im Glanz seiner Erfolge, und eine leichtgläubige Nachwelt hat ihm seine Redensarten nachgebetet und ihn als den Begründer des englischen Imperialismus gefeiert, während er doch in Wahrheit der Mann war, unter dessen Leitung der englische Imperialismus in die Defensive übergehen musste. Mit dem Coup der Suez- Kanal- Aktien fing es an; durch ihn sollte den anderen Mächten gezeigt werden, dass England Anspruch auf die wichtigste Handelsstraße der Welt erhob. Das nächste war die Erhebung der Queen Victoria zur Kaiserin von Indien (1877), ein theatralischer Abschluss der Eroberung Indiens, der dadurch nur noch widerwärtiger gemacht wurde, dass die Verkündung in der alten Kaiserstadt Delhi in den Wochen einer Hungersnot erfolgte, so dass dem indischen Volke der Segen der neuen Kaiserherrlichkeit unzweideutig fühlbar gemacht wurde.

Benjamin Disraeli. Der „kleine Orientale“, wie Bismarck ihn nannte, war von 1874 bis 1880 englischer Ministerpräsident. In diesen Jahren krönte er die Eroberung Indiens durch die Komödie der Errichtung des „Kaiserreiches Indien“, presste dem Sultan die für England nahezu wertlose Insel Zypern ab und bereitete den Raub Ägyptens vor.
Nachdem nun einmal das geheiligte Prinzip der Unteilbarkeit des Türkischen Reiches preisgegeben worden war, durfte auch England bei der Teilung der Beute nicht zurückstehen. Also bot Disraeli dem Sultan eine Garantie seines asiatischen Besitzes gegen russische Angriffe an, unter der Bedingung, dass dafür die Insel Zypern an England abgetreten werde. „Zypern ist der Schlüssel zum westlichen Asien“ erklärte er der in geographischen Dingen überaus gläubigen Königin. Der Außenminister, Lord Derby, war zwar anderer Ansicht und zog es vor, den Abschied zu nehmen, statt für den Raub einer Insel die Verantwortung zu übernehmen, die eine rein griechische Bevölkerung hatte und überdies nach Ansicht vieler Sachverständiger für England keinen Wert hatte. Doch war es nicht mit Jamaika und so manchem anderen Land ähnlich gewesen? Wert hin, Wert her – wenn es nur die anderen ärgerte! Die Zustimmung des Sultans ließ auf sich warten, weil gerade eine Palastrevolution in Konstantinopel entdeckt wurde, die sein Leben bedrohte. Aber auch als sie niedergeschlagen war, wollte Sultan Abdul Hamid nicht in das englische Begehren willigen, so dass der englische Botschafter schon Anstalten traf, ihn „im Interesse der Sicherheit des Staates und unserer lebenswichtigen Interessen“ durch eine neue Palastrevolution aus der Welt zu schaffen. Zum Glück für Disraeli war Abdul Hamid keine Kämpfernatur; er zog es vor zu unterschreiben. Zum Glück für Disraeli kam es auch nicht dazu, dass England seine Garantieversprechen mit den Waffen einlösen musste; Bismarcks Autorität verhinderte den Bruch und wahrte auf dem Berliner Kongress (1878) den Frieden. Das hinderte England nicht, vom Sultan zu verlangen, dass er das Versprechen für die Tat nehme und den Preis, nämlich Zypern, zahle. Jetzt galt es, Ägypten den Wünschen der Londoner City gefügig zu machen. Die Hälfte der Kanalaktien genügte noch nicht, um England wirklich den Griff auf die Hauptstraße der Macht zu sichern; das Nilland selbst war von entscheidender strategischer Bedeutung geworden, und England durfte es niemand anderem überlassen. Weder einer europäischen Macht noch etwa den Ägyptern selbst. Denn diese waren eben jetzt zu nationalem Selbstbewusstsein erwacht und hatten einen Führer gefunden, der die Parole ausgab: „Ägypten den Ägyptern!“, einen Mann aus dem Nillande, einen Fellachen, der die Nöte des Volkes und seine Sehnsüchte kannte: Arabi Pascha. Das bankerotte und korrupte Regime des Khediven war, das zeigte sich nur allzu bald, auch durch eine englische Finanzkontrolle nicht zu halten, und es sah schon so aus, als solle die Macht auf kaltem Wege an England gelangen, da schuf die Erhebung der ägyptischen Offiziere und Soldaten, deren Führung Arabi Pascha hatte, eine neue Lage. Der Khedive kapitulierte vor ihren Forderungen, die auf eine Selbstbestimmung des ägyptischen Volkes hinausliefen, und Arabi konnte als Kriegsminister an den Aufbau einer ägyptischen Autonomie gehen.

Moses in Ägypten
Der jüdische Premierminister Disraeli hat durch einen geschickten Coup den Besitz des Vizekönigs von Ägypten an Suez- Kanal- Aktien in die Hände des englischen Staates gebracht und verfügt nun über den „Schlüssel nach Indien“. Karikatur von John Tennier aus dem“ Punch“ (1875).
Doch das war nicht im Sinne Englands. Zusammen mit Frankreich, das ganz in seinem Schlepptau lief, forderte es in einem Ultimatum an den Khediven die Entfernung Arabi Paschas aus dem Lande, und um dieser Forderung den nötigen Nachdruck zu verleihen, erschienen englische und französische Kriegsschiffe im Mai 1882 vor Alexandria. Dass damit das ägyptische Volk zu offener Empörung gedrängt werden musste, fügte sich bestens in den englischen Plan. Denn als am 11. Juni in spontan ausbrechenden Unruhen eine Anzahl Europäer getötet worden war, führte man das englischerseits nicht auf die verantwortungslose eigene Politik zurück, die so viel Zündstoff sich hatte anhäufen lassen, und berücksichtigte auch nicht, dass Arabi sogleich die Ruhe wieder herstellte, sondern fuhr in der Methode der Drohungen fort. Um die Unabhängigkeit Ägyptens zu sichern, hatte Arabi begonnen, Alexandria zu befestigen. Am 3. Juli verlangte „der britische Admiral die Einstellung der Arbeiten, widrigenfalls die militärische Intervention erfolgen werde. Arabi beachtete das Ultimatum nicht; war seiner guten Sache sicher glaubte wohl auch nicht, daß die beiden Westmächte in ihrer Brutalität so weit gehen würden, der Stadt ernstlichen Schaden zuzufügen. In der Tat zog sich jetzt Frankreich aus dem üblen Handel heraus; es wollte England das Odium des gewaltsamen Vorgehens allein überlassen. So dampften die französischen Schiffe aus den ägyptischen Gewässern ab, während die englischen am 11. Juli um 7 Uhr morgens das Bombardement auf die volkreiche und so gut wie unbewehrte Stadt eröffneten. Die ersten Schüsse gingen in die eben aufgeschütteten Erddämme, die nächsten aber in die Stadt, und am Mittag bereits war Alexandria ein einziges Flammenmeer.
Nun erwies es sich doch als nützlich, dass England sich in Zypern eingenistet hatte. Ein von dorther und aus Malta herbeigerufenes Expeditionskorps wurde in Ägypten gelandet, und Arabi war gezwungen, sich zum Kampfe zu stellen. Der leidenschaftliche Kämpfer war ein schlechter Stratege; er verlor die Schlacht und fiel in die Hände der Engländer. Die „Sieger“ krönten ihren Gewaltstreich durch eine beschämende Prozeßkomödie, bei der ein englisches Kriegsgericht den ägyptischen Obersten Arabi Pascha wegen Meuterei und Aufruhrs gegen den Khediven zum Tode verurteilte und dann zugleich als Gnadeninstanz das Urteil in lebenslängliche Verbannung nach Ceylon umwandelte. Damit war Ägypten führerlos und eine Beute Englands geworden …

Das „Kaiserreich Indien“ in französischer Beleuchtung Das ausgemergelte indische Volk als „Motiv“ für die Kamera der reisenden Lady, neben der ein englischer Feldwebel Wache halten muss. Denn selbst vor Hunger zu Tode erschöpft, könnten die Inder noch aufbegehren . . . – Aus der französischen Wochenschrift „Le Rire“
Das Bild des auf der Höhe seiner Macht befindlichen britischen Weltreichs wäre unvollkommen gezeichnet, wenn wir nicht einiger Einzelheiten gedächten, die zwar welthistorisch nicht ins Gewicht fallen, aber doch anschaulich genug den Spruch von der Katze belegen, die das Mausen auch dann nicht lässt, wenn sie es gar nicht mehr nötig hat. Da ist etwa der schamlose Raub der Falklandinseln zu nennen, schamlos einmal deshalb, weil er gegenüber einem jungen Staate begangen wurde, den ins Leben gerufen zu haben sich England ganz besonders rühmte, zum andern deshalb, weil die Räuber, ganz wie damals im Falle Jamaikas, noch lange Zeit hindurch gar nicht wussten, was sie mit dem Raub eigentlich anfangen sollten.

Königin Victoria
Ihre lange Regierungszeit (1837-1901) stellt den Höhepunkt der britischen Weltmacht dar. Die Herrscherin selbst verkörperte viele Züge des britischen Nationalcharakters: die Selbstgerechtigkeit und die frömmelnde Scheinheiligkeit, hinter der sich der rücksichtslose Machtdrang verbirgt.
Von rechtmäßigen Ansprüchen Englands auf diese sturmumtoste Inselgruppe im südlichen Atlantik konnte nicht im mindesten die Rede sein. Weder auf Grund dessen, dass ein Engländer sie „entdeckt“ hätte; denn die Geographen hatten längst festgestellt, dass das Land, das der elisabethanische Seeräuber Hawkins einst gesehen und „Hawkins‘ Jungfernland“ benannt hatte, nicht die Falklandinseln, sondern ein Stück des südamerikanischen Kontinents gewesen war. Auch nicht auf Grund dessen, dass etwa die erste Besiedlung durch Engländer vorgenommen wurde; denn es war vielmehr der Franzose Bougainville gewesen, der mit einer Schar französischer Kanadier zuerst versucht hatte, auf den unfruchtbaren Inseln menschliche Wohnstätten zu gründen. Die französische Siedlung war damals bald nachher auf spanischen Einspruch hin von der französischen Regierung wieder aufgegeben worden, ebenso wie eine englische, die an einer anderen Stelle der Inselgruppe ein wenig später unternommen worden war. Auch hier hatte die spanische Regierung ihr Souveränitätsrecht mit Erfolg geltend machen können. Das war im Jahre 1774, als der Ausbruch der Rebellion in Nordamerika ein Zurückweichen vor Madrid ratsam erscheinen ließ. Zwar erreichte es England, dass eine gewaltsame Vertreibung seiner Kolonisten, die der Vizekönig von Buenos Aires auf eigene Hand vorgenommen hatte, wieder rückgängig gemacht wurde; aber in dem gleichen Abkommen, in dem es dieses Zugeständnis von Spanien erhielt, verpflichtete sich England, die Inseln alsbald nach der Besetzung wieder zu räumen. Ein Versprechen, das es – eigentlich ganz unenglisch- auch einlöste. Aber es war, als ob die Reue, ausnahmsweise einmal ein Versprechen gehalten zu haben, die englischen Staatsmänner nicht ruhen ließ. Kaum hatten sie es dahin gebracht, dass das amerikanische Kolonialreich sich von Spanien löste, kaum hatten sie sich in den Hauptstädten der neuen Staaten Südamerikas als Helfer zur Freiheit feiern lassen, da beschlossen sie, ein Exempel zu statuieren und den Befreiern zu zeigen, dass England Herr der Meere war.

Die Verkündung des indischen Kaiserreiches in Delhi Um den Indern die Macht des „unbesieglichen“ Englands deutlich zu machen, wurde auf Betreiben Disraelis die Königin Victoria 1877 in Delhi, der alten Residenz der Großmoguln zur Kaiserin von Indien“ ausgerufen Gleichzeitig herrschte in Indien eine furchtbare Hungersnot
Gewiss hatte die junge argentinische Republik in den ersten Jahren ihres Hartumkämpften Bestehens wenig Zeit gehabt, sich um die Besiedlung der Falklandinseln zu kümmern. Aber die Engländer waren ihr keineswegs mit gutem Vorbild vorangegangen, vielmehr war es abermals ein Franzose gewesen, Vernet, der sich um die wirtschaftliche Erschließung des Archipels, und zwar mit Erfolg, bemüht hatte. Vernet unterstellte sich selbstverständlich der argentinischen Staatshoheit, und es wäre für England ein Leichtes gewesen, sich von der Regierung in Buenos Aires durch Verhandlungen ein Recht auf Anlage einer Vorratsstation für seine Handelsschiffe zu erwirken. Aber Lord Palmerston, der britische Außenminister, verschmähte den diplomatischen Weg. Er zog den offenen Raub vor. Am 2. Januar 1833 erschienen englische Kriegsschiffe vor dem Hafen der Insel; die kleine argentinische Besatzung musste das Fort räumen, und der Union Jack wurde gehisst, wobei London gleichzeitig in Buenos Aires wissen ließ, dass jede Gegenaktion als ein Casus belli aufgefasst werden würde. Zwar verließ die englische Flotte sogleich nach Erfüllung ihres Auftrages die Gewässer der Falklandinseln wieder und die Einwohner der Schutzlosigkeit.
Aber was kümmert sich London um die Pflichten der Humanität, wenn es gilt, einem schwächeren Staate zu zeigen, wer der Herr ist?
So kurz entschlossen England sich hier bei der Gewinnung eines Flottenstützpunktes im Südatlantik über Recht und Billigkeit hinwegsetzte, so zaghaft war anfänglich sein Vordringen in die Welt des Fernen Ostens.. Dass im Jahre 1819 mit der Erwerbung von Singapore die wichtigste Verbindungsstelle zwischen Indischem und Stillem Ozean der englischen Herrschaft gewonnen wurde, war nicht das Ergebnis weitblickender Weltraumpolitik Londoner Staatsmänner, sondern das Verdienst eines kühnen Außenseiters, des Beamten der Ostindienkompanie Stamford Raffles, der, unzufrieden mit der Rückgabe der Sunda-Inseln an Holland und ein vertrauter Kenner der malaiischen Völkerwelt, kurzerhand auf eigene Faust einen Vertrag mit den eingeborenen Fürsten schloss und sich das damals ganz öde Gelände von Singapore übereignen ließ. Es dauerte Jahre, bis man zuerst in Kalkutta, dann in London gewahr wurde, welche Vorteile die widerwillig angenommene Erwerbung mit sich brachte – es dauerte zwei Jahrzehnte, bis der nächste Schritt zur Festsetzung im Fernen Osten getan wurde.
Natürlich geschah auch dieser Schritt in der Form, die für die Entstehung des britischen Weltreichs charakteristisch ist: Durch Anwendung unredlicher Methoden und dann, wenn der durch diese Methoden benachteiligte Staat Widerstand leistet, durch Krieg im Namen des beleidigten Rechtes und der Zivilisation.

Los von England!
Obwohl die englische Regierung den Zyprioten bei der Besitzergreifung 1878 versprach, sie wolle aus der Insel ein „Paradies des Ostens“ machen, hat sie die Lebensnotwendigkeiten der Bevölkerung immer hinter den eigenen Machtinteressen zurückgesetzt.
Vor dreihundert Jahren hatten die „wagenden Kaufleute“ die Nordost- und die Nordwestpassage gesucht, um englische Wolle nach China zu exportieren. Inzwischen stand englischen Schiffen längst der Weg nach China frei, aber es hatte sich gezeigt, dass China weder für englische Wolle noch überhaupt für englische Waren einen Markt abgeben konnte. Irgendwie aber musste denn doch die Handelsbilanz ausgeglichen werden, und zu diesem Zweck erwies sich das Opium, das auf den indischen Mohnfeldern geerntet wurde, als höchst willkommenes Produkt. Die chinesische Bevölkerung zeigte sich sehr anfällig gegenüber den Lockungen dieses Rauschgiftes, und es wurde den englischen Kaufleuten nicht schwer, ihre Ware auf dem Markt in Kanton abzusetzen. Doch die chinesischen Behörden sahen dieser Schwächung der Volkskraft nicht schweigend zu, sondern erließen ein Verbot der Opiumeinfuhr. Vergeblich, denn es fiel den englischen Kaufleuten nicht schwer, sich vom regulären auf den Schmuggelhandel umzustellen, und der Import des Giftes vervielfachte sich von Jahr zu Jahr.
Da griff der Provinzgouverneur von Kanton zu einer einschneidenden Maßnahme: er verfügte am 15. März 1839 die Beschlagnahme und Vernichtung des gesamten in chinesischen Küstenplätzen lagernden Opiums und forderte von den englischen Kaufleuten, sie sollten wieder zum ehrlichen Handel zurückkehren. Als sie sich weigerten und sich samt ihren Opiumvorräten in ihrer Faktorei verschanzten, ließ er seine Truppen vorgehen und das Gift mit Gewalt holen. Dass er bei alledem nichts tat, als dem chinesischen Gesetz Achtung zu verschaffen und seine Landsleute vor den verheerenden Wirkungen des Giftes zu bewahren, wird kein billig Denkender bestreiten können. Für London aber stellten sich die Dinge durchaus anders dar. Die Beschlagnahme des Opiums und seine Versenkung ins Meer galt hier als Raub, die Ausweisung der britischen Kaufleute aus Kanton als ein „Angriff auf Leben und Eigentum britischer Untertanen“. Und der Generalgouverneur von Indien erhielt Anweisung, alle verfügbaren Truppen und Schiffe nach China zu entsenden, um das beleidigte Recht wiederherzustellen. So begann der Krieg Englands gegen China, der unter dem Namen „Opiumkrieg“ als beschämendes Kapitel in den Annalen der britischen Gewaltpolitik fortlebt. Bombardements friedlicher Städte, Niedermähung chinesischer Soldaten mit Geschützen, denen sie keine gleichwertigen Waffen entgegenzustellen hatten – so wurde die chinesische Regierung zum Nachgeben gezwungen. Vom Februar 1840 bis zum August 1842 währte der ungleiche Kampf. Dann wurde in Nanking der Friede diktiert: China musste die Insel Hongkong an England abtreten und Schadenersatz für das vernichtete Opium leisten, ja außerdem England die Kosten seines Raubkrieges ersetzen …
Ein anderer Staat, der auf diese Weise die Hand Englands zu fühlen bekam, war das junge Griechenland. In diesem Falle spielte überhaupt kein irgendwie geartetes Interesse Englands mit, sondern nur der Wunsch, seine Macht fühlen zu lassen.
Das Objekt, an dem England diesen Versuch aufführte, war so unwürdig wie nur möglich, Es war nämlich ein aus Portugal gebürtiger Jude, der auf den so milde klingenden Namen Pacifico hörte. Er hatte, ehe er sich in Athen als Halsabschneider niederließ, eine Zeitlang in Gibraltar gewohnt, und nahm also die britische Staatsbürgerschaft in Anspruch. Damit bot er Palmerston den Anlass, als Kämpfer für das „Recht“ (in Wahrheit: für das Recht des Stärkeren) aufzutreten. Die Athener hatten nämlich an den wucherischen Praktiken des britischen Staatsbürgers Pacifico begreiflichen Anstoß genommen und ihm eines Tages in seiner Abwesenheit kurzerhand sein Haus in Brand gesetzt. Die Rechnung auf Schadenersatz legte Paeifico wohlweislich nicht der griechischen, sondern der englischen Regierung vor; denn in Athen hätte man wohl nähere Nachforschungen nach der Glaubwürdigkeit seiner Angaben angestellt. Palmerston jedoch verzichtete großzügig auf jede Nachprüfung. Er machte alle Forderungen des Juden ohne jeden Abstrich zu Forderungen der englischen Regierung an die griechische. Insgesamt gab Pacifico den Wert seines Ameublements mit 8.000 Pfund, also 160.000 Mark an. Dazu kamen gänzlich unkontrollierbare 27.000 Pfund an portugiesischen Staatspapieren, die nach des Juden beweglicher Klage bei der Feuersbrunst vernichtet sein sollten. Die Rechnung war um so phantastischer, als der angeblich so schwer Geschädigte erst vor nicht allzu langer Zeit sein „Geschäft“ mit einem Kapital von ganzen 30 Pfund, die ihm die Bank von Athen vorstreckte, begonnen hatte. Aber es kam Palmerston auch gar nicht auf die Rechtmäßigkeit der Forderung an, sondern nur darauf, dass Griechenland, dieses „Schoßkind des Absolutismus“, wie er es nannte (also Russlands, des großen Gegners) „endlich einmal gezüchtigt werde“.
So ließ er denn sofort den Machtapparat des seebeherrschenden Albion spielen. Ein Geschwader von vierzehn Schiffen wurde nach Athen beordert, und der griechischen Regierung wurde ein vierundzwanzigstündiges Ultimatum gestellt: entweder restlose Begleichung von Pacificos Forderungen oder Blockade! Da die griechische Regierung die Rechtsauffassungen Pacificos und Palmerstons nicht teilte, liefen die vierundzwanzig Stunden ab, ohne dass der Jude seine unverschämte Forderung beglichen bekam, und am 18. Januar 1850 wurde wirklich zum fassungslosen Staunen der gesamten Welt die Blockade über das Land verhängt.

Der Berliner Kongress Als ehrlicher Makler verhinderte Bismarck, dass sich 1878 aus dem Russisch-Türkischen Krieg ein Krieg zwischen England und Russland entwickelte. England dankte es ihm durch gehässige Angriffe. – Gemälde von Anton von Werner.
Denkwürdig bleibt der Protest der griechischen Regierung gegen diese kaum verhüllte Vergewaltigung: „Griechenland ist schwach“, so hieß es darin, „und konnte sich nicht versehen, dass es solche Schläge von einer Macht empfangen sollte, die es bisher mit Stolz und Vertrauen zu seinen Wohltätern rechnete.“ Denkwürdig ist aber auch die Art, wie Palmerston die Vermittlung der anderen Mächte zu hintertreiben wusste. Er erklärte sich nämlich auf französisches Ersuchen bereit, die Blockade für eine kurze Frist aufzuheben. Als aber zwischen Paris und London ein Kompromiss zustande gekommen war, der die Zahlung der immer noch viel zu hohen Summe von 8.000 Pfund vorsah, unterließ er es, diesen Kompromiss seinem Gesandten in Athen mitzuteilen. So lief die Frist ab, und die Blockade wurde wieder verhängt. Der griechischen Regierung aber blieb nichts übrig, als die gesamte Summe zu zahlen, wenn nicht Hungersnot über das Land hereinbrechen sollte. Als auch sie von dem Kompromiss erfuhr, war es zu spät – das Geld war schon angewiesen, und Palmerston dachte nicht daran, es zurückzuzahlen…
Ein neuer Rivale: Deutschland
Die Sorge vor Rußland war die Richtschnur für das Verhalten Englands in dieser ganzen Zeit gewesen, für seine Eroberungspolitik in Indien wie für seinen Zugriff nach dem östlichen Mittelmeer und dem Roten Meer. Alles war gewissermaßen eine Zurüstung für den Entscheidungskampf mit dem Zarenreich, der nach Ansicht aller englischen Politiker über kurz oder lang unvermeidlich war. An dem panischen Schrecken vor Rußland hatte sich auch jetzt, trotz der beträchtlichen Erweiterung der englischen Machtsphäre, nichts geändert. Noch im Jahre 1885 nannte Winston Churchills Vater, Lord Randolph Churchill, das Vordringen Rußlands „bald verstohlen, bald offen, bald wie das Gleiten einer Schlange, bald wie der Sprung eines Tigers“; es sei „eine dauernde Bedrohung für die Beständigkeit und das Fortschreiten der Regierung und des Volkes in Indien“. Ein Zusammenstoß russischer Truppen mit afghanischen, der sich aus einem Streit nomadisierender Stämme um Weideplätze ergeben hatte, wurde in London als Beginn der großen Auseinandersetzung angesehen; man mobilisierte die indische Armee und zog die Flotte im Mittelmeer zusammen. Zwar erwies sich alles als viel Lärm um nichts, denn die Russen verzichteten auch diesmal auf den Tigersprung und waren mit einem Kompromiß zufrieden. Aber in London fühlte man sich nach wie vor beunruhigt und suchte eifrig nach Festlandshilfe gegen den bösen Feind in Petersburg.
Ein Bündnisangebot, das Bismarck im Januar 1889 in London vorlegen ließ, wurde darum von dem englischen Kabinett mit großer Erwartung aufgenommen. Um so enttäuschter war man dann aber, als sich herausstellte, daß Bismarck nur ein gemeinsames deutsch – englisches Vorgehen gegen Frankreich im Sinne hatte, keineswegs jedoch eines gegen Rußland. Deutschlands Armee für Englands Sicherheit in Indien zu opfern, das lag nicht im Entferntesten in Bismarcks Absichten.

So begann England seine „Kulturmission“ in Ägypten!
England konnte es nicht mit ansehen, daß der ägyptische Offizier Arabi Pascha versuchte, sein Vaterland zu einem unabhängigen Staat zu machen. Es benutzte einen nichtigen Vorwand, um 1882 große Teile der unbefestigten Stadt Alexandria in Asche zu legen. – Nach einer Veröffentlichung der englischen Zeitschrift „Picture Post“ aus dem Jahre 1939.
Dabei wäre eine solche Bereitschaft Deutschlands in diesem Augenblick den Leitern der englischen Politik doppelt willkommen gewesen und hätte sie über eine Entwicklung getröstet, die ihnen seit dem letzten Jahrzehnt viel Kummer bereitete: über den Aufschwung der deutschen Industrie und des deutschen Welthandels. Zehn Jahre waren vergangen, seitdem die „Times“ mit souveräner Verachtung ihren Lesern berichtet hatte, Fürst Bismarck beabsichtige, im Deutschen Reich Schutzzölle einzuführen; „sollte ihm das gelingen“, hatte sie höhnisch hinzugefügt, „so wird die wichtigste Folge die sein, daß sein Ruf als kluger Staatsmann schweren Schaden leidet“. Aber nicht nur Deutschland, auch Rußland, Frankreich, Italien gingen vom Freihandel zum Schutzzoll über, und die „Times“ war wieder und wieder genötigt, über den Unverstand so vieler Regierungen den Kopf zu schütteln, die es in so kurzsichtiger Weise verschmähten, ihren „Untertanen die großen Wohltaten zugute kommen zu lassen, die aus dem Freihandel entspringen“. Daß die Errichtung der Zollschranken nicht nur darauf abzielte, die Länder von der industriellen Vormacht Englands unabhängig zu machen und also die Dividenden der City, diese wesentlichste aller „großen Wohltaten des Freihandels“, zu beschneiden, sondern dass das gewählte Mittel diesen Zweck auch wirklich erreichen werde, davon ließ sich die Schulweisheit des wirtschaftlichen Liberalismus, die mit den Interessen der Plutokratie so glänzend harmonierte, damals noch nichts träumen.

Erschießung ägyptischer Freiheitskämpfer Da sich die Freiheitsbewegung Arabi Paschas auch gegen den engelandhörigen Vizekönig richtete, hatte England eine prächtige Gelegenheit, den Aufstand mit eigenen Truppen „im Namen des Khedive“ rücksichtslos niederzuschlagen und so die ägyptische Unabhängigkeit im Keim zu ersticken. – Zeichnung eines englischen Augenzeugen.
Aber trotzdem war es dahin gekommen, daß in den Jahren seit 1880 die englische Industrie und der englische Handel auf den europäischen wie auf den überseeischen Märkten empfindlich beiseite gedrängt wurden, und diejenigen, die den englischen Kaufleuten das Leben sauer machten, waren neben den Amerikanern vor allem die Deutschen. Von dieser Seite her hatte man am allerwenigsten eine Bedrohung der wirtschaftlichen Weltherrschaft Englands erwartet, denn seit den Zeiten der Hanse hatte Deutschland immer nur als Abnehmer britischer Waren (und außerdem als Festlandsdegen) einen Posten in der englischen Rechnung dargestellt. Spanien, Portugal, Holland, Frankreich, Rußland – sie alle waren nacheinander die Gegner gewesen, die es niederzuringen galt. Noch war man mit dem letzten, mit Rußland, nicht fertig und nun meldete sich schon ein neuer? „In jedem Gebiet des Erdballs“ , so schrieb Ende 1888 der britische Generalkonsul in Hamburg in seinem amtlichen Jahresbericht, und seine nüchterne Schilderung ist ungewollt zu einem Ruhmeszeugnis für deutschen Fleiß und deutsche Tüchtigkeit geworden“, in jedem Gebiet des Erdballs dehnt Deutschland seine Handelstätigkeit mit stetiger und erfolgreicher

Mit Marineartillerie auf wehrlose Bewohner
Arabi Pascha hatte Befehl gegeben, den in Alexandria gelandeten Engländern keinen bewaffneten Widerstand zu leisten. Trotzdem „säuberte“ englische Artillerie die Straßen der brennenden Stadt. – Zeichnung eines englischen Augenzeugen.
Beharrlichkeit aus. Deutsches Tuch hat seinen Weg auf die marokkanischen Märkte gefunden. Die Japaner werden allmählich gute Kunden für deutsche Tuche und deutschen Buckskin. Die Marktberichte aus Yokohama zeigen, daß etwa drei Viertel des Handels mit halbseidenem Stoff en in deutscher Hand liegen. Tunis kauft deutsche Schmucksachen und Lampen; andere Fabrikate, auch Baumwollwaren finden ihren Weg nach Port Elisabeth in Südafrika. Manila nimmt von Deutschland billige Baumwollstoffe. In Porto Alegre in Brasilien ist die Einfuhr aus Frankreich von 30 Prozent auf 7 Prozent gesunken, und in demselben Umfang hat Deutschland seine Ausfuhr dorthin vermehrt. In Venezuela breitet sich der deutsche Einfluß aus, und es wird mit deutschem Kapital eine Eisenbahn von Caracas nach Victoria gebaut. Auch in Europa ist der deutsche Export im Steigen, besonders nach Norwegen und Dänemark.“ Der Beobachter läßt seinen Bericht in eine Warnung ausklingen: „Gewiß hält Großbritannien noch immer den größeren Teil des Welthandels in seiner Hand. Aber darum dürfen seine Kaufleute und Industriellen nicht übersehen, daß aus kleinen Anfängen Großes entstehen kann. Wenn sie ihren Konkurrenten erlauben, sie von kleinen Märkten zu verdrängen, so können am Ende die Ergebnisse der Entwicklung katastrophaler sein, als wir sie jemals für möglich gehalten hätten. . .“

Britisches „Heldentum“ in Ningpo Der englische Leutnant John Ouchterlony, der dabei war, hat diese Zeichnung gemacht, auf der man sieht, wie englische Geschütze während des Opiumkrieges (1841) in den Straßen von Ningpo ein Blutbad unter der hilflosen chinesischen Bevölkerung anrichten.
Es währte nicht lange, und aus dem Warnungsruf war ein vielstimmiges Geschrei geworden, ein Geschrei der Wut über den neuen Rivalen, der sich erfrechte, das Monopol der britischen Plutokratie anzutasten. Noch ehe das Jahrhundert zu Ende ging, hatte der deutsche Alpdruck ebenso große Dimensionen angenommen wie bisher der russische, und das zwanzigste Jahrhundert fand die Londoner Plutokratie nicht mehr im Gegensatz zu Rußland, sondern im Gegensatz zu Deutschland. Das Karthago, zu dessen Zerstörung alle Völker, die großen und die kleinen, aufgerufen wurden, hieß jetzt Deutschland …
Wenn England einen Gegner aufs Korn nimmt, pflegt es um verlogene propagandistische Schlagworte nicht verlegen zu sein. So war es mit Spanien, mit Holland, mit Frankreich, mit Rußland – sollte es mit Deutschland anders sein? Nicht lange, und eine leichtgläubige Welt fiel auch auf diese neue Propaganda herein. Da wurde Deutschland als der brutale Mann im Kürassierstiefel hingestellt, unter dessen Tritten die Erde erdröhnt, es wurden die „plumpen Gewaltmethoden“ der deutschen Handelspolitik angeprangert und geschildert, wie sich der deutsche Kaufmann durch sein schroffes und herrisches Auftreten in der ganzen Welt verhaßt mache. Seit dem Ende des Jahrhunderts konnte dann der deutsche Flottenbau als neuer Beweis dafür angeführt werden, daß das Deutsche Reich eine wahre Eroberungsbestie sei und daß die Völker zusammenhalten müßten, sich vor ihr zu schützen. Wie sehr dann diese Propaganda im Weltkrieg gegen uns ausgewertet worden ist, haftet uns allen noch in nur zu guter Erinnerung.

Warum England den Opiumkrieg entfesselte
Diese Zeichnung von Jean Grandville aus dem „Charivari“ (1840) trägt die Unterschrift: „Ihr müßt dies Gift sofort kaufen“, sagt der Engländer, „wir wollen, daß ihr euch vollkommen vergiftet, damit wir genug Tee haben, um unsere Beefsteaks zu verdauen.“
Die geschichtliche Wahrheit erfordert dem gegenüber vor allem eine Feststellung: alle angeblichen politischen Gegensätze wurden von England erst nachträglich konstruiert, grundlegend dagegen war der wirtschaftliche Neid. Die Wurzel für die Feindseligkeit gegen Deutschland liegt weder in der Flottenpolitik noch auch in der zur Schau gestellten Sorge um deutsche Eroberungspläne auf dem europäischen Festland; sie lag überhaupt nicht in Europa und seinem vorgeblich bedrohten „Gleichgewicht“, sondern einzig und allein in der Angst um die Erhaltung der englischen Welthandelsvormacht. Wer den unversöhnlichen Charakter des englischen Hasses gegen Deutschland begreifen will, muß daher einen Einblick in die, Entwicklung haben, die sich in den achtziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts vorbereitete und in den neunziger Jahren zur ersten Reife gelangten, waren die Jahre, in denen der deutsche Weltgeltung errang und der britischen Plutokratie jenes ständig wachsende Unbehagen erregte, das sich dann im Weltkrieg, in der Nachkriegszeit und in dem freventlich heraufbeschworenen Entscheidungskampf, in dem wir heute, stehen, Luft zu machen versuchte.
Welche Methoden waren es, mit denen der deutsche Kaufmann seine Weltgeltung errang? Die Frage beantwortet sich am eindeutigsten, wenn wir, statt den englischen Propagandalügen unsere eigenen Versicherungen entgegenzusetzen, einem objektiven und unvoreingenommenen neutralen Forscher das Wort geben, dem amerikanischen Wirtschaftshistoriker Ross J. S. Hoffman. Er schildert die Vorgänge nicht nach dem für die Weltöffentlichkeit fabrizierten englischen Hetzmaterial, sondern nach den für den internen Dienstgebrauch bestimmten Berichten der britischen Konsuln in aller Welt – und seine unparteiische Darstellung wird unversehens zu einer Anklage gegen die Methoden der Londoner Plutokratie.
Mit welchen Mitteln, so fragt er, ist es dem deutschen Industriellen und dem deutschen Kaufmann gelungen, den Engländern auf so manchen Märkten der Welt den Rang abzulaufen? Nicht, wie die englische Propaganda behauptet, mit Brutalität und Betrug, sondern mit ganz anderen. Hören wir, das Ergebnis seiner Untersuchungen: „In seinem Bericht für 1886 bemängelte der britische Generalkonsul in Tokio, daß die englischen Industriellen sich nur auf Erledigung sehr umfangreicher Bestellungen einlassen wollen, und noch 1897 bemerkte ein Konsul in Spanien: Der Brite will nur verkaufen, wenn er große Orders bekommt. Andererseits wurde aus Argentinien berichtet, daß der wachsende Erfolg der Deutschen auf ihre Bereitwilligkeit, auch mit einer kleinen Verdienstspanne zufrieden zu sein, und auf die Mühe. die sie sich auch um eine kleine Order gaben, zurückzuführen sei.
Die gleiche Beharrungstendenz der englischen Wirtschaft äußert sich auch in ihrer Unlust, sich auf die Herstellung billigerer Warensorten für die neu erschlossene Märkte umzustellen. Lange Zeit hindurch war sie gewöhnt gewesen, immer die gleichen Artikel für immer die gleichen Märkte zu liefern, und so war jetzt außerstande, die wenig zahlungskräftigen Bevölkerungen von Rußland, Osteuropa, Asien, Afrika d Südamerika sowie die weniger entwickelten Kolonien des eigenen Weltreichs mit leichtverkäuflichen Waren zu versehen, ja auch nur die Notwendigkeit einer solchen Produktion zu begreifen.
Ferner bezeugen die Berichte eine unüberwindliche Abneigung der englischen Industriellen, sich mit den kaufmännischen Vertretern in das Risiko zu teilen oder ebenso großzügig in der Befristung von Krediten zu sein wie die Deutschen und andere Nationen. Wo britische Firmen sofortige Zahlung verlangten oder höchstens sich auf ein Ziel von drei Monaten einließen, gewährten deutsche Firmen durchweg vier, sechs, neun Monate oder noch mehr, und dies war zweifellos einer der wichtigsten Gründe dafür, daß der Handel mehr und mehr den Deutschen zuneigte. Die verbreitetste und fundamentalste Schwäche des britischen Geschäftsgebarens war das Unvermögen, sich Einblick in den wirklichen Bedarf der Märkte zu verschaffen und die Produktion dem wechselnden Geschmack und der wechselnden Nachfrage anzupassen. Eine hochmütige Verachtung für die Wünsche der Kundschaft und ein stures Beharren auf veralteten Dessins und Schmuckformen war für die britische Industrie in der ganzen Welt charakteristisch – im Gegensatz zu der deutschen Anpassungsfähigkeit und zu dem sorgfältigen Studium der Märkte durch die Deutschen, was diese Kritik veranlaßt. Einer der wichtigsten Gründe für diese Unfähigkeit, sich auf die Nachfrage einzustellen, war die erstaunliche Knappheit an britischen Handelsreisenden, und die Bemühungen, diesem Mangel dadurch abzuhelfen, daß man statt dessen geradezu verschwenderisch Preislisten und Kataloge versandte, blieben schon deswegen erfolglos, weil diese Schriftsachen meist nur in englischer Sprache abgefaßt waren. Die Zeit, wo britische Waren sich von selbst verkauften, ohne daß es der Werbung bedurfte, war jetzt, wo eine sehr tätige Konkurrenz auftrat, vorüber. Ohne ein wohlgeschultes Heer reisender Verkäufer war ein Fortkommen für eine auf Export angewiesene Industrie nicht mehr möglich.
Diejenigen Handelsreisenden aber, die von den britischen Firmen verwandt wurden, waren ihren Konkurrenten zumeist in verschiedenen, sehr wichtigen Dingen unterlegen. Zunächst einmal nahmen sie überallhin ihren englischen Lebenszuschnitt mit und wurden dadurch den Firmen unverhältnismäßig teuer. Der britische Konsul in Barcelona z. B. fand 1886 die Haupthemmnisse für den englischen Spanienhandel in den Lebensgewohnheiten ausländischer Vertreter, verglichen mit den Engländern. Betrachten wir etwa die Deutschen, so schrieb er weiter, die bei weitem die zahlreichsten sind: sie leben unglaublich sparsam, ihre Gehälter sind oft kaum der Rede wert, ja, manche sind ohne jede feste Entschädigung für ein Handelshaus tätig, nur um ins Geschäft zu kommen. Ihre geringen Ersparnisse gehen nicht wie bei unseren Engländern für Cafès und Theater drauf. Solch ein karges, aufopferndes Leben erspart ihren Auftraggebern viele Unkosten. Dieses Bild der deutschen Reisenden in Barcelona hatte für alle Teile der Welt Gültigkeit, und ebenso der Kontrast zu den Engländern.
Ein weiterer Hemmschuh für den Erfolg der britischen Reisenden war ihre mangelhafte Vorbildung. Das wird nicht nur durch die Konsularberichte, die sich unaufhörlich darüber verbreiten, bezeugt, sondern auch durch die große Aufmerksamkeit, die man gegen Ende des Jahrhunderts in der Presse und in politischen Reden der Frage der kaufmännischen Ausbildung widmete. Eine solche, so versicherte etwa die ,Westminster Gazette‘, sei die Grundlage des deutschen Erfolges. Wenn wir es nicht verstehen, unserem kaufmännischen Personal eine ebenso wirksame Vorbildung zu geben, dann werden wir auch weiterhin auf vielen Märkten nur die zweite Geige spielen können.‘ Noch bedenklicher war die Unterlegenheit der Engländer gegenüber den Deutschen im Gebrauch fremder Sprachen. Ich höre oft, schrieb der britische Konsul in Moskau 1896, daß Engländer hier ankommen, ohne irgend etwas anderes als Englisch zu sprechen, während die Deutschen durchweg sich auch russisch verständigen können.“

Australische Eingeborene als Jagdobjekt Die eingeborene Bevölkerung des australischen Kontinents wurde zum Freiwild für die sadistischen Instinkte der englischen „Kulturträger“ gemacht. Es gelang, sie innerhalb weniger Jahrzehnte zum größten Teil auszurotten. – Nach einer alten Lithographie.
Soweit der amerikanische Forscher und seine unverdächtigen Zeugen, die britischen Konsuln. Das Bild rundet sich: die Bequemlichkeit der englischen Geschäftsleute, ihre Unlust, die eingefahrenen Geleise zu verlassen, ihr Hochmut gegenüber dem Kunden, dessen verdammte Pflicht und Schuldigkeit es ist, britische Waren zu kaufen, ihre geringe Wendigkeit, ihre Faulheit im Erlernen fremder Sprachen und im Einfühlen in anderer Völker Lebensgewohnheiten – und auf der anderen Seite der Deutsche, fleißig, anspruchslos, aufopfernd, auf Sachkenntnis bedacht, gewinnend im Umgang, bescheiden und intelligent. Ein Kontrast der für sich selbst spricht. Nur allzu gut verstehen wir jetzt, warum die englische Propaganda der Jahre nach 1900 vor allem den deutschen Handlungsreisenden aufs Korn genommen und ihn gerade zum Gegenstück des „habsüchtigen Pfeffersacks“ von einst gemacht hat – mit seinem „aufdringlichen Gebaren“, seiner „unfreien Haltung“ seinem Mangel an Sinn für „practical jokes“ und englischen „Humor“. Dieses Zerrbild, das mit der Wirklichkeit nichts gemein hat, schuf der englische Cant, um sein Gewissen über die versäumte Pflicht zu beruhigen. England hatte die wirtschaftliche Weltherrschaft verscherzt, und der Grund durfte unmöglich bei ihm selbst liegen.

Kolonisten als Zugtiere
Wie mit so vielen ihrer geraubten Kolonien, wußten die Engländer auch mit dem von Kapitän Cook entdeckten Australien lange nichts Rechtes anzufangen und verwandten es als Sträflingskolonie. Die Deportierten wurden dann, wie unser Bild nach einer alten Lithographie zeigt, von den Offizieren und Beamten als Zugtiere verwandt.
Es mußte irgendein böser Dämon sein Spiel mit ihm treiben. Die englischen „Witz“blätter wurden nicht müde, diesen Dämon abzubilden. Er trug einen Schnurrbart nach der Mode „Es ist erreicht“, einen ellenhohen Stehkragen, war Reserveoffizier und überhaupt sehr unsympathisch. Sein Beruf war der, den es in England zum Schaden der englischen Geschäftswelt nicht gab: er war Handelsreisender. Ein fluchwürdiger Beruf, denn er brachte England um den bequemen Genus seiner Dividenden aus dem Weltgeschäft. Es dauerte allerdings eine Weile, bis sich die englische Bestürzung derart in Entrüstung und Haß verwandelte. Vor der Jahrhundertwende brachten die Engländer noch eine gewisse Ehrlichkeit gegenüber sich selbst auf. Da stellte das Kolonialamt noch fest, daß die „deutsche Konkurrenz, auf die die britischen Waren heute überall treffen, als durchaus fair zu bezeichnen ist“, und strafte so im voraus schon alle späteren Äußerungen englischer Staatsmänner Lügen.
Und ein Mann, der sich um die Erhaltung der englischen Vormachtstellung mehr Sorgen machte als die, die „auf den Kontorstühlen ihrer Großväter saßen“, und der überhaupt zu den wenigen aufrichtigen englischen Imperialisten gehörte, E. J. Dillon, hielt seinen Landsleuten den Spiegel vor: „So unbequem uns auch die deutsche Konkurrenz ist, wir können nicht behaupten, daß die Deutschen gegen die Regeln eines fairen Spiels verstoßen. Nein, was auch unsere optimistischen Minister sagen mögen, es ist die bittere Wahrheit, daß der Rückgang unseres Handels die Folge unserer kaufmännischen Minderwertigkeit gegenüber den Deutschen ist und daß wir uns niemals gegen unsere festländischen Vettern werden behaupten können, solange wir nicht offen diese Tatsache eingestehen und versuchen, ihre Gründe ernstlich abzustellen. Je eher wir anfangen, bei Deutschland in die Schule zu gehen, statt ihm Moral zu predigen, desto besser für uns.“
Aber die englische Plutokratie dünkte sich zu erhaben, um bei den Deutschen in die Schule zu gehen. Aus der Partnerschaft, die in jenen Jahren auch manchem Deutschen vorschwebte, wurde eine Feindschaft, mußte es werden, weil Neid und Mißgunst gegen die Erfolge eines anderen von jeher die Kainszeichen der britischen Plutokratie waren. Nur eins hätte dem Weltgeschehen des zwanzigsten Jahrhunderts ein anderes Gesicht geben können: Deutschlands Verzicht auf friedliche Weltgeltung. Diesen Verzicht haben unsere Väter nicht geleistet. Sie haben die „Fairness“, die das Kolonialamt an ihnen rühmte, auch weiterhin bewährt und nicht glauben wollen, daß die Erde nicht genug Platz habe für mehrere tüchtige Völker. Sie trugen keinen Groll gegen England, sie wollten nicht das Inselreich aus der Welt verdrängen, wie dieses es einst mit ihren Vorvätern, den hansischen Kaufleuten, getan hatte und dann mit den Spaniern, den Portugiesen, den Holländern, den Franzosen; sie wollten wirklich nur, wie es ein geflügeltes Wort der Zeit sagte, den „Platz an der Sonne“, den ihnen die Jahrhunderte der Zerrissenheit nicht gegönnt hatten. Aber weil sie ihn nicht nur wollten, sondern auch tüchtig genug waren, ihn zu erringen, wurden sie in den Augen der britischen Plutokratie zu bösen Geistern, die Englands angestammtes und heilig verbrieftes Recht auf die alleinige Ausbeutung der Welt bedrohten. Welcher Frevel, daß diese Leute England zwangen, sich zu regen, welch boshafte Ruhestörung!

Die Dreckschleuder So vornehm die “ Times“, das Leibblatt des englischen Hofes, bisweilen tun kann, so hemmungslos toben sich dann wieder die Haßgefühle der britischen Plutokratie in ihren Spalten aus, wenn die Dividenden in Gefahr sind. Dieses treffende Bild von ihr zeichnete 1887 – der Engländer M. F. Morgan!
Bald genug stellte sich heraus, daß die Konsuln umsonst gemahnt hatten. Die englische Öffentlichkeit war entschlossen, die Schuld für das Versagen der englischen Wirtschaftsmethoden auf dem Weltmarkt nicht bei den eigenen Plutokraten, sondern bei den Deutschen zu suchen. Ein seitdem weltberüchtigt gewordener Leitartikel der „Saturday Review“ (1897) formulierte unter dem unzweideutigen Titel „Germaniam esse delendam“ (Deutschland muß vernichtet werden) das, was bis zum heutigen Tage unverändert das Kriegsziel der britischen Plutokratie geblieben ist.
„Es gibt in Europa zwei große, unversöhnlich gegensätzliche Kräfte, zwei große Nationen, deren jede die ganze Welt zu ihrem Herrschaftsbereich machen und ihr den Tribut des Handels auferlegen will“. (Bezeichnend, daß der Soldschreiber der britischen Plutokratie sich die deutschen Ziele nur verständlich machen kann, indem er sie den englischen, die er allerdings sehr gut versteht, gleichsetzt!) „England mit seiner langen Geschichte erfolgreicher Angriffe (!), mit seiner wunderbar sicheren Überzeugung, daß es, indem es seine eigenen Interessen verfolgt, Licht unter den in der Finsternis wohnenden Völkern verbreitet“ (welch glänzende Kennzeichnung des britischen Cant!) „und Deutschland, Fleisch vom selben Fleisch, Blut vom selben Blut, mit geringerer Willenskraft(!), aber vielleicht mit schärferer Intelligenz – beide stehen in jedem Winkel des Erdballs miteinander im Wettbewerb. In Transvaal, am Kap, in Zentralafrika, in Indien, im Fernen Osten und im Fernen Nordwesten, überall dort, und wo wäre das nicht geschehen? – die Flagge der Bibel gefolgt ist (!) und der Handel der Flagge, dort kämpft der Deutsche mit seinem Musterkoffer“ (der verkörperte böse Geist!) „gegen den englischen wandernden Händler. Wenn irgendwo ein Bergwerk auszubeuten, eine Eisenbahn zu bauen, ein Stamm von Eingeborenen von der Affenbrotfrucht zur Konservennahrung und von der Abstinenz zum Gin zu bekehren ist, dann wollen der Deutsche wie der Engländer den ersten Platz haben. So setzen sich Millionen kleiner und kleinster Reibereien zu der gewaltigsten Kriegsursache zusammen, die die Welt je gesehen hat. Wenn Deutschland morgen von der Welt vertilgt würde, so gäbe es übermorgen nicht einen einzigen Engländer in der Welt, der nicht dadurch reicher geworden wäre. Nationen haben schon jahrelang um eine Stadt oder ein Thronfolgerecht Krieg geführt. Müssen sie da nicht für 250 Millionen Pfund jährlichen Handels Krieg führen?“
Mit diesem klassischen Zeugnis brutalster Offenherzigkeit hatte die britische Plutokratie die Parole für das zwanzigste Jahrhundert gegeben. Die zweideutige Schlusswendung ließ es absichtlich offen, welche von den beiden „unversöhnlich gegensätzlichen Kräften“ zuerst um Kriege schreiten werde. Aber von ihr ist es nur noch ein kurzer Schritt bis zu der Behauptung, dass das Ziel. der deutschen Politik die Vorbereitung eines Krieges gegen England sei, eben wegen der 250 Millionen Pfund. Eine weitere englische Propagandalüge ergibt sich daraus als logische Folge: Indem England Deutschland einkreiste und schließlich in den Weltkrieg hineinzog, hat es nichts anderes getan, als dem Krieg, mit dem Deutschland „die Welt erobern wollte“, vorzubeugen. 1897, 1914, 1939 – das Gesicht der britischen Plutokratie hat sich nicht verändert.
Es war gewiß kein Zufall, daß der scheinheilig-zynische Leitartikler der „Saturday Review“ unter den Gebieten, wo die Tüchtigkeit deutscher Kaufleute der Trägheit britischer Kuponschneider unbequem wurde, an erster Stelle Transvaal nannte. Denn gerade in Südafrika zeigte sich England besonders empfindlich für die deutsche Konkurrenz, und die Furcht, hier von den Deutschen überflügelt zu werden, hat einen wesentlichen, wenn nicht gar den entscheidenden Anlass gegeben zu dem letzten großen Länderraub Englands vor dem Weitkriege, der zugleich durch die zynische Nachlässigkeit, mit der er durchgeführt wurde, eine Leidenszeit ohnegleichen über ein tapferes und freiheitsliebendes Volk heraufbeschwor.

Der unersättliche John Bull
Eine gemütvolle Verherrlichung der britischen Erfolge über die anderen Seemächte zugleich eine scharfe Anklage gegen den hemmungslosen Machthunger der britischen Plutokratenclique. – Zeichnung von James Gillray.
Wir sprechen von dem Raubkriege gegen die Burenrepubliken Transvaal und Oranje (1899-1902), dessen weltpolitischer Zusammenhang nur richtig begriffen wird, wenn man erkennt, daß der Schlag gegen die Buren in erster Linie ein Schlag gegen Deutschland sein sollte.
Die Vorgeschichte des Burenkrieges beginnt, unter diesem weltpolitischen Gesichtspunkt gesehen, mit der Gründung der deutschen Kolonien in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts. Die ersten Schritte der deutschen Kolonialpolitik – 1884: Togo, Kamerun, Südwest, 1885: Deutsch-Ost und Neu-Guinea, um nur die wichtigsten zu nennen – hatten in London noch geteilte Gefühle hervorgerufen. Es überwog eine überhebliche Geringschätzung, die den Versuchen der deutschen Kolonialpioniere, eines Lüderitz, Nachtigal, Carl Peters, keine lange Lebensdauer prophezeite.

England ist sich immer gleich geblieben Im Jahre 1878 veröffentlichte der Pariser „Charivari“ diese Zeichnung, deren Text mit gewissen Abwandlungen noch heute Gültigkeit hat: „Sind Sie nun also für Italien?“ – „Nein.“ – „Für Rußland?“ – „Nein … . .. Für die Türkei?“ – „Nein, ich bin nur für mich selbst.“
Weite Kreise in England waren geneigt, die Gründung deutscher Kolonien mit ähnlichen Augen betrachten wie die Schutzzollpolitik: als eine Belästigung Englands, die über kurz oder lang jedoch in dem Belästiger – Bismarck – mehr Schaden bringen mußte als den Belästigten. Die britische Kolonialverwaltung und ihre Außenbeamten legten den Deutschen soviel Steine in den Weg als es nur irgend ging, aber die englische Öffentlichkeit nahm die Ereignisse mit Gelassenheit hin. Sie hatte damals vorwiegend andere Sorgen: der Aufstand des Mahdi im Sudan drohte die englische Herrschaft in Ägypten zu überwältigen, General Gordon war bei Khartum getötet, seine Expeditionsarmee vernichtet worden. Man mußte ernstlich für die Sicherheit des Weges nach Indien fürchten und hatte nicht die Muße, sich über Afrika den Kopf zu zerbrechen. Ungeteilt jedoch waren die Gefühle, die der weitere Verlauf der Entwicklung hervorrief. Seit 1889 hatte die Deutsche Ostafrika- Linie einen regelmäßigen Dienst mit den Häfen der afrikanischen Ostküste eingerichtet, und die weitsichtige Tarifpolitik, die Adolph Woermann, der Leiter der Linie, bei diesen Fahrten zugrunde legte, förderte den deutschen Export zusehends. Die britischen Konsuln in jenen Häfen wußten bald von den Fortschritten des deutschen Handels zu berichten, und, was dem Kolonialamt in London sehr zu denken gab, besonders von den Fortschritten an denjenigen Küstenorten, die mit den im Binnenlande liegenden Burenrepubliken im Handelsverkehr standen. Es waren dies vor allem der portugiesische Hafen Lourenco Marquez an der Delagoa-Bai. Besondere Sorge machte den Engländern die Eisenbahn von Lourenco Marquez nach Pretoria, die auf burischem Gebiet einem deutsch-holländischen Syndikat gehörte, und deren portugiesische Strecke die Buren anzukaufen suchten.

Deutscher Kolonialbesitz vor dem Kriege
Das, was nach englischer Ansicht später einmal für die Polen ein lebenswichtiges Recht sein sollte, der wirtschaftlich unbehinderte Zugang zum Meer, das war, wenn die Buren es erstrebten, eine Verletzung geheiligter englischer Interessen. So sorgte denn der Vorkämpfer der britischen Vorherrschaft in Afrika, der damalige Premierminister der Kapkolonie Cecil Rhodes, im September 1894 für einen kleinen Eingeborenenaufstand in Lourenco- Marquez (die portugiesische Regierung fand nach der Niederschlagung die Beweisstücke für die englische Anstiftung), der programmmäßig zu der Entsendung englischer Kriegsschiffe und zur Landung englischer Truppen „zum Schutz des britischen Konsulats“ führte. Daß es damals Deutschland war, das den Raub der portugiesischen Kolonie verhinderte, indem es gleichfalls zwei Kriegsschiffe nach Lourenco – Marquez beorderte und in London wissen ließ, es sei nicht gesonnen in die Annexion portugiesischer Besitzungen einzuwilligen, mußte das Unbehagen des Kolonialamtes noch verstärken. Nun folgte Verdruß auf Verdruß. Die statistischen Veröffentlichungen ergaben, daß sich der deutsche Export nach Transvaal in dem Jahrfünft von 1889 bis 1894 versechsfacht hatte. Die deutsche Beteiligung an den Goldminen in der Umgegend von Johannisburg war im Wachsen – kurz, es war klar erkennbar, daß Deutschland die Burenrepubliken zu einer Domäne friedlicher wirtschaftlicher Expansion ausbaute, ein Vorgang, gegen den niemand in der Welt etwas einwenden konnte und gegen den am allerwenigsten die Buren selbst etwas einwandten.
Sie fuhren gut bei den Beziehungen mit Deutschland, das ihnen gute Waren lieferte und sachkundige Ingenieure ins Land schickte, das aber keinerlei Absichten auf politische Bevormundung hatte. Von Kapstadt und von London her dagegen hörte man zwar immer davon sprechen dass Englands heiligstes Prinzip der Freihandel und die „offene Tür“ für alle Nationen sei, in der Praxis aber zeigte sich immer wieder das Bestreben die Tür zu den Burenrepubliken für den Handel anderer Völker zu schließen.
Zum Unglück für die Engländer war das Staatsoberhaupt der Transvaal- Republik, der Präsident Paul Krüger, fest entschlossen, die Tür offen zu halten. Er, der in seiner Knabenzeit den Auszug der Buren aus der Kapkolonie, den „Großen Trek“ (1839) mitgemacht und der dann als Mann an führender Stelle allen englischen Annexionsversuchen zum Trotz die Anerkennung der Autonomie des Landes, das seine Väter gegründet, hatte erkämpfen helfen – er kannte die Engländer. Er wußte, daß der Einstrom englischen Kapitals nur die Vorstufe war zur allmählichen Eingliederung Transvaals in das britische Kolonialreich, und darum sorgte er, so sehr er konnte, dafür daß die Engländer sich nicht ein Export- und Kapitalmonopol aneigneten. Seine Beziehungen zu Deutschland waren deshalb so freundlich, weil er mit Hilfe der deutschen Kaufleute und Ingenieure die Wirtschaft seines Landes vor der englischen Überfremdung bewahren konnte.
Diese vom natürlichen Gebot der Selbsterhaltung diktierte Politik paßte nun aber schlecht zu den Sorgen der Londoner City über den wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands und den politischen Expansionsplänen Cecil Rhodes‘, der nicht mehr und nicht weniger wollte, als den ganzen afrikanischen Kontinent unter britischer Flagge vereinigen. So bereitete denn Cecil Rhodes unter stiller Mitwisserschaft des Londoner Kolonialamts und seines Leiters Joseph Chamberlain einen Handstreich vor, der Deutschland vor eine vollendete Tatsache stellen sollte. Er hielt die Meinungsverschiedenheiten, die zwischen den in Johannisburg lebenden Europäern und der Transvaal Regierung über den Einfluß ortsansässiger Ausländer auf die Gesetzgebung der Republik entstanden waren, für einen willkommenen Anlas, diesen „Ausländern“ durch einen Überfall zu Hilfe zu kommen. In den Tagen um die Jahreswende 1895/1896 brach Cecil Rhodes‘ vertrautester Freund, der Administrator von Süd-Rhodesien Dr. Jameson, mit 600 Mann in Transvaal ein.
Doch die Sache klappte nicht. Die „Ausländer“, zu deren Beten die Aktion in Szene gesetzt wurde, rührten sich nicht; dagegen waren die Buren auf dem Posten. Einen Tagesmarsch vor dem Ziel mußten sich Jameson und seine Streitmacht ihnen ruhmlos ergeben. Selbstverständlich wälzten nun alle amtlichen englischen Stellen die Verantwortung für den Überfall von sich ab, der unter dem Namen Jameson-Raid einen traurigen Nachruhm in der Geschichte erworben hat.
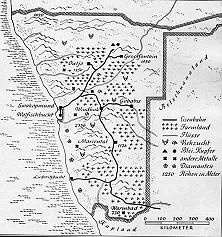
Deutsch-Südwestafrika
Noch ehe sich aber herausstellte, daß Chamberlain es wegen der Aussichtslosigkeit einer weiteren Verfolgung der Annexionspläne im Augenblick vorzog, sie zu verleugnen und Jameson, das Werkzeug, das versagt hatte, zur Verurteilung zu ziehen, erhielt die britische Plutokratie einen neuen Anlaß, zu moralischer Entrüstung. Der deutsche Kaiser nämlich sandte ein Telegramm an den Präsidenten Krüger, in dem er ihn beglückwünschte, daß es ihm „mit seinem Volke gelungen sei, in eigener Tatkraft den Frieden wiederherzustellen und die Unabhängigkeit des Landes gegen Angriffe von außen zu wahren“. Ausbrüche haßerfüllter Angst waren die Folge dieser Kundgebung; zum Zeichen, daß England bereit sei, es auf das Äußerste ankommen zu lassen, ließ es seine Flotte auslaufen, und in politischen Kreisen erwog man, ob es nicht das beste sei, sogleich zum Schlage auszuholen und die deutschen Kolonien in Afrika zu besetzen.
Die „Krüger- Depesche“, die nicht, wie man später wohl gefabelt hat, einer spontanen Eingebung des Kaisers entsprungen war, sondern Überlegung aller verantwortlichen deutschen Staatsmänner entworfen und abgesandt wurde, sollte England darauf aufmerksam machen, daß Deutschland einer gewaltsamen Annexion der Burenrepubliken nicht gleichgültig zusehen könne. Sie hat diesen Zweck auch durchaus erfüllt; denn England schlug von nun an andere Mittel in seiner Südafrika-Politik ein. Wenn es später die Welt hat glauben machen wollen (was ihm in nicht geringem Maße, auch bei deutschen Lesern, geglückt ist), Deutschland habe mit der „Krüger- Depesche“ den Buren militärische Hilfe versprechen wollen und dann später dies Versprechen nicht gehalten, so war das eine bewußte Propagandalüge. Denn niemand mußte besser wissen als die Engländer, dass die deutsche Regierung in den Tagen des Jameson- Raids den Präsidenten Krüger wieder und wieder zur Mäßigung gemahnt und ihn vor einem Gegenangriff gegen England gewarnt hatte.
Doch die deutsche Politik der nachbismarckischen Zeit war in ihrem Kurse nicht sicher und gleichmäßig. Die Hoffnung, daß England doch noch friedlich in eine „Junior- Partnerschaft“ des Deutschen Reiches in Übersee einwilligen würde, brachte eine Neigung zu Konzessionen mit sich, und auf diese Neigung vermochte England sich zu stützen, als es 1898 ein Abkommen mit Deutschland abschloß: Für den Fall, daß Portugal nicht imstande sei, seine südafrikanischen Besitzungen zu halten, sollte eine Teilung dieser Besitzungen zwischen England und Deutschland erfolgen. Welche Absichten England damit verfolgte, daß es das Fell eines noch gar nicht erlegten Bären zur Verteilung brachte, ergibt sich aus der Tatsache, daß es im nächsten Jahr ein Geheimabkommen mit Portugal schloß (von dem Deutschland also nichts erfuhr) und den Portugiesen den ungeschmälerten Besitz ihres gesamten Kolonialreiches garantierte. Sir Arthur Nicolson, der spätere Botschafter in Konstantinopel, der diese Verhandlungen führte, hat später einmal gesagt, sie seien „das zynischste Geschäft gewesen, das mir in meiner ganzen diplomatischen Laufbahn vorgekommen ist“, und selbst der offiziöse Geschichtssehreiber der britischen Außenpolitik, Seton- Watson, schließt seine Darstellung der Vorgänge mit den Worten: „Die Sache macht einen ausgesprochen unsauberen Eindruck“ – wobei er allerdings hinzusetzt, das gelte jür alle Partner, nicht nur für Großbritannien“.

Deutsch-Ostafrika
Doch dieser Versuch, das deutsche Verhalten zu diskreditieren, macht selbst einen „ausgesprochen unsauberen“ Eindruck. Denn die damalige Reichsregierung rechnete nur mit der aller Welt bekannten Tatsache, daß es Portugal fast unmöglich war, die finanziellen Mittel für seine Kolonialverwaltung aufzubringen, und also wohl geneigt sein werde, in einen Verkauf der Kolonien einzuwilligen. Für diesen Fall hatte es sich mit England über das Kaufobjekt geeinigt. Daran ist gewiß ebensowenig etwas Unsauberes wie an dem Verhalten Portugals, das sein Kolonialreich aufrechterhalten wollte. Unsauber ist, wie Nicolson richtig bemerkt, allein das Vorgehen Englands gewesen. Daß man in London allerdings vergeblich versuchte, auch nach dem Abschluß des Abkommens mit Portugal dieses zur Abtretung des Gebietes um Delagoa- Bay, des Schlüssels zum Transvaal oder wie man in England vorzog zu sagen, des „Schlüssels zum Frieden in Südafrika“, zu bewegen, paßte aufs beste zu allem, was vorhergegangen war. Damit war das Entscheidende erreicht: Deutschland war von Transvaal abgezogen und auf andere Gebiete zur Entfaltung seiner wirtschaftlichen Aktivität vertröstet. England hatte freie Hand gegen die Buren …
Wie England sich die freie Hand zunutze gemacht hat, ist bekannt. Zwar kreuzte sich das Ultimatum, mit dem der Krieg gegen die Buren eingeleitet werden sollte, mit einem Ultimatum Krügers, nach dessen Ablehnung dieser seine Truppen in Natal einmarschieren ließ, so daß formell England nicht der „Angreifer“ war. Auch auf den in der Tat höchst mangelhaften Stand der militärischen Bereitschaft im britischen Südafrika pflegt die englische Propaganda hinzuweisen, wenn sie die Kriegsschuld Paul Krügers beweisen will. Aber mangelhaft war auch die Rüstung der Buren, und allein die durch tausendfältige Erfahrung gewonnene Überzeugung, daß ihnen nur die Wahl zwischen ehrlichem Kampf und ruhmlosem Untergehen geblieben war, konnte sie zu dem äußersten Schritte treiben.

Kamerun (rechts) und Togo (links oben)
Überdies beweist die Korrespondenz zwischen Milner, dem Oberkommissar in Kapstadt, und Chamberlain, daß der englische Einfall in Transvaal nur eine Frage der Zeit war. Es geziemt sich, an dieser Stelle der Deutschen zu gedenken, die – ohne Auftrag von Berlin, und auch ohne Unterstützung von dort – den Buren in ihrem Kampf um Sein oder Nichtsein beistanden. Drei deutsche Freikorps wurden aus den in Johannisburg und Pretoria ansässigen Ausländer aufgestellt, die also damit noch nachträglich dokumentierten, wie überflüssig Cecil Rhodes‘ und Jamesons „Fürsorge“ für sie gewesen war, und außerdem ein holländisches, ein skandinavisches und ein irisches. Schiel, Graf Zeppelin, von Quitzow das sind die Namen, die damals bei den Buren hohen Klang gewannen.
Das Schlesische Korps war es, dem die Aufgabe des ersten Einmarsches nach Natal zufiel. Es hatte auch das erste schwere Gefecht mit regulären Truppen auszuhalten: bei Elandslaagte am 21. Oktober 1899. Die überlegene Artillerie der Engländer fügte dem Korps schwere Verluste zu und zwang es zum Rückzug. Auch der Korpsadjutant, Kapitänleutnant Graf Zeppelin, befand sich unter den Gefallenen. Ein Sieg der Engländer war es trotzdem nicht; denn die Vereinigung ihrer Heeresabteilungen zur Deckung des wichtigen Knotenpunktes Ladysmith war ihnen mißglückt. Dafür zeichneten sich die englischen Truppen, vor allem die Lanzenreiter, durch manchen Akt sinnloser Brutalität aus. In der deutschen Ambulanz lag am Abend u. a. ein schwer verwundeter deutscher Freiwilliger, unzähligen Lanzenstichen wie ein war.

Burenfrauen als Kugelfang
Eine ungarische Zeichnung aus der Zeit des Burenkrieges, in dem die englischen Truppen Burenfrauen vor ihren Abteilungen hermarschieren ließen, um sich auf diese Weise gegen Angriffe burischer Einheiten zu schützen.
Für den weiteren Verlauf des Krieges kam nun an, ob sich die Burengenerale, die bis jetzt nur den Krieg gegen Eingeborene kannten, die Ratschläge der ihnen an militärischer Erfahrung überlegenen Deutschen zunutze machen würden. Aber das geschah nur in ungenügendem Maße. Ja, selbst die entscheidende Niederlage der Buren, die dem englischen Heer den Weg in die Burenrepubliken freigab, die Einschließung des Generals Cronje mit 4000 Mann bei Paardeberg (27. Februar 1900), wäre vermieden worden oder doch nicht so vernichtend ausgefallen, wenn Cronje auf die Mahnungen des deutschen Majors Albrecht gehört hätte.
Doch auch nach der Niederlage in offener Feldschlacht gaben die Buren den Kampf um ihre Unabhängigkeit nicht auf. Am 27. Mai wurde der Oranie- Freistaat, am 2. September Transvaal durch den englischen Oberkommandierenden Lord Roberts zur britischen Kolonie erklärt. Damit galt offiziell der Feldzug als beendet; denn dank einer willkürlichen Auslegung der Verträge zwischen England und den Burenrepubliken behauptete man in London, daß diese keine souveränen Staaten seien, sondern der britischen „Souveränität“ unterstünden, so daß Großbritannien jederzeit befugt sei, das staatsrechtliche Verhältnis zu ändern. Die Annexion trat also an die Stelle eines Friedensschlusses, und das war ganz und gar nicht nur von formeller Bedeutung. Denn nun ergab sich die Möglichkeit, die weiterkämpfenden Buren als außerhalb des Gesetzes stehende „Räuberbanden“, als vogelfrei zu erklären. Und nicht nur sie, die den Kampf aktiv fortführten, sondern auch ihre Frauen und Kinder wurden als Vogelfreie behandelt.

Lord Kitchener (1850-1916) Er gestaltete nach Niederwerfung des Mahdiaufstandes im Sudan 1898 seinen Truppen zügellose Grausamkeiten gegen die wehrlose Bevölkerung. Im Burenkrieg (1898-1902) war er für die schonungslose Ausdehnung des Kampfes auf Greise, Frauen und Kinder verantwortlich.
Als in den ersten Wochen der burischen Erfolge der englische General White bat, die Frauen und Kinder aus dem eingeschlossenen Ladysmith abtransportieren zu dürfen, schlug ihm dies der Burengeneral Joubert zwar ab; aber er richtete statt dessen eine neutrale Zone ein, in die sich alle Nichtkämpfer begeben konnten und die durch eine weiße Flagge gekennzeichnet war. Jetzt, nach dem Siege im Felde, war es an den Engländern zu zeigen, ob sie die gleiche Ritterlichkeit aufbringen wollten – und jetzt zeigte sich die „Humanität“ britischer Kriegführung in vollstem Lichte. Mit der Verkündung der Annexion hatte Lord Roberts seine Aufgabe gelöst, und das Kommando ging an Lord Kitchener über, den Besieger des Malidi und Eroberer des Sudans. Er war ein harter und gefühlloser Befehlshaber und durch das, was nun geschah, wurde sein Name in der ganzen Welt, ja selbst in großen Teilen der englischen Öffentlichkeit gleichbedeutend mit dem eines mitleidlosen Henkers. Doch trägt er nur einen Teil der Verantwortung. Wäre es nach ihm gegangen, so hätte man jetzt mit den noch im Felde befindlichen Burenführern Frieden geschlossen. Es kam zu einer Unterredung zwischen ihm und dem Oberbefehlshaber der Buren, General Botha (Februar 1901), bei der die beiden Soldaten miteinander einig wurden. Aber die Versöhnung scheiterte an dem Widerspruch des Oberkommissars Milner in Kapstadt, der weder bereit war, den Buren der Kapkolonie, die sich gegen England erhoben hatten, Amnestie zu gewähren, noch den Buren in Transvaal und Oranje für die Zukunft Selfgovernment (Selbstregierung) in Aussicht zu stellen. Sächlich sah Kitchener weiter als Milner; denn später erhielten die „Kaprebellen“ doch Amnestie und die Buren Selfgovernment. Zunächst aber ging wegen dieser Meinungsverschiedenheit des Soldaten und des Politikers der Krieg weiter – und wurde von dem Soldaten mit der entsetzlichsten Unbarmherzigkeit geführt.
Die „Räuberbanden“ gingen in kleinen Abteilungen vor; ihr Ziel war, die englischen Verbindungen zu stören und den Engländern die Durchführung der Annexion so sehr als möglich zu erschweren. Es war eine Taktik, auf die die englischen Truppen nicht eingerichtet waren; denn ihnen fehlte es an dem, worin die Stärke der Buren lag: an der Beweglichkeit der Einheiten und an der Selbständigkeit des einzelnen Mannes.

Noch einmal Lord Kitchener
Die französische Zeitschrift „L‘ Assiette au Beurre“, aus der diese Zeichnung stammt, zitiert dazu treffend folgende Stellen aus dem offiziellen Bericht Kitcheners an das Kriegssamt: „Ich kann sagen daß der Krieg in Transvaal beendet ist. Das Land ist ruhig, und ich habe das ohne jedes Blutvergießen erreicht. Die Konzentrationslager, in denen ich Frauen und Kinder untergebracht habe, tragen das Ihre zur raschen Befriedung bei.“
Die Buren auf ihren schnellen Ponies waren überall da, wo die englischen Kommandeure sie nicht erwarteten, und die überlegene Führerbegabung des im Kriege zum Abgott seines Volkes gewordenen Botha hielt die vielen einzelnen Aktionen stets im Rahmen eines überlegten Planes. Da es Kitchener nicht möglich war, seine Offiziere und Soldaten auf diese Taktik umzustellen, bei der weder Artillerievorbereitung noch Massenangriffe fruchteten, gab es für ihn nur eins: er mußte den Buren die Basis ihrer Versorgung mit Nahrungsmitteln abschneiden. So wurde, damit die Kämpfer verhungerten, das Land selbst zum Opfer des Krieges. In allen Landstrichen, wo die Buren gefährlich werden konnten, wurden die Farmen niedergebrannt und die Lebensmittelvorräte vernichtet oder fortgeschleppt. Die Greise, Frauen und die Kinder aber „konzentrierte Kitchener in stacheldrahtbewehrten Lagern.
So weit konnte Kitcheners Kriegsführung noch die militärischen Notwendigkeiten für sich geltend machen. Welche Entschuldigung aber wollte England für die Zustände anführen, die in diesen Konzentrationslagern herrschten und von denen die Kunde bald über die Welt eilte?
Es gab nur eine Rettung: beharrliches Leugnen. Die citytreue Presse ließ sich das Stichwort nicht zweimal geben. Sie erklärte einfach alle Schilderungen für Greuelmärchen, erfunden von den Deutschen oder der Labour Party oder was sonst den Plutokraten unbequem war. Unter den Journalisten, die sieh damals durch Fälschung der Tatsachen ein besonderes Verdienst erwarben, befand sich auch der Vetter des Citymagnaten und späteren Premierministers Stanley Baldwin, der Dichter Rudyard Kipling. Will man ermessen, zu welchem Zynismus die Wortführer der britischen Weltherrschaft fähig sind, so muß man die Sätze lesen, die Kipling noch nach Jahrzehnten in seinen Lebenserinnerungen über diese Dinge geschrieben hat.
„Vom geschäftlichen Standpunkt aus“, so erklärt er, „war der Krieg lächerlich. Wir belasteten uns Schritt um Schritt mit der Obhut und Verpflegung der ganzen Burenschaft – Frauen und Kinder einschließlich.“ Ein wahrhaft klassischer Satz! Scheinbar wird hier die unrentable Form der Kriegführung verhöhnt und damit der Plutokratie eins ausgewischt. Dabei unterlässt es der grimmige Kritiker der finanzkapitalistischen Politik hinzuzufügen, daß die Unkosten für die Verpflegung der Burenfrauen und -kinder auf ein Minimum herabgedrückt wurden. Es herrschte ein unvorstellbarer Mangel an Lebensmitteln und sanitären Vorkehrungen in den Konzentrationslagern, und die englische Verwaltung tat nichts, um die Verhältnisse zu bessern. – Doch hören wir Kipling weiter: „Einige Preislisten der Warenhäuser für Armee und Marine wurden in die Konzentrationslager eingeführt, und die Frauen kehrten in das bürgerliche Leben mit einer Kenntnis von Korsetts, Strümpfen, Toilettenkästen und anderem Zubehör zurück, über welche ihre Geistlichen und Ehemänner die Stirn runzelten“. Welch ein drolliges Idyll, das der Satiriker hier zeichnet! „Sie kehrten in das bürgerliche Leben zurück. ..“ Soweit sie nämlich in der Lage waren zurückzukehren. Als nach anderthalb Jahren sinnloser Zerstörung Milner sich dann doch herablassen mußte, mit den „Räuberbanden“ einen regulären Frieden zu schließen (3. Mai 1902), waren über 26 000 Frauen, Greise und Kinder dem Hungertyphus und den Seuchen in den Konzentrationslagern erlegen. Die Sterblichkeit hatte – nach englischen Angaben – 40 v. H. und mehr betragen!
Das Land selbst war eine Einöde geworden. Schwelende Schutthaufen zeigten die Stellen an, wo einst Häuser und Bäume gestanden hatten. Aber das Ziel war erreicht: man hatte Deutschland den Weg zu den Goldminen von Johannisburg verlegt – was bedeutete da ein zugrunde gerichtetes Land? Und noch ein anderes war die Folge. Obwohl die englische Propaganda nur zu genau wußte, daß und warum Deutschland die Hände gebunden waren, verfehlte sie doch nicht, die begreifliche Enttäuschung der Buren über das Ausbleiben jeder Hilfe aus Europa in einen Haß auf Deutschland zu verkehren. Denn konnte nicht die Stunde kommen, wo man die Burenführer brauchte, um die deutsche Kolonie Südwestafrika zu rauben?
Die Einkreisung Deutschlands
Im März 1907 hatte der amerikanische Botschafter in London, Henry White, eine Unterredung mit Arthur James Ralfour, dem Führer der konservativen Partei und ehemaligen Premierminister aus der Zeit des Burenkrieges. Das Gespräch kam auf das Verhältnis Englands zu Deutschland und darauf, daß der deutsche Handel sich auch im neuen Jahrhundert vielerorts an die Stelle des englischen setze. Der Ankauf mehrerer englischer Schiffahrtslinien durch deutsche Gesellschaften wie die „Hapag“ und den „Lloyd“ hatte in der Londoner Geschäftswelt soeben arges Erschrecken hervorgerufen, und seitdem Deutschland angefangen hatte, sich eine Hochseeflotte zu schaffen, gingen immer wieder Vermutungen über einen bevorstehenden Überfall Deutschlands auf England um. Balfour hatte natürlich zuviel Einblick in die politischen Verhältnisse, um nicht zu wissen, daß diese Vermutungen Hirngespinste der Angst waren. Aber auf die Frage Whites, wie England sich der deutschen Konkurrenz zu erwehren gedenke, antwortete er doch in seiner immer etwas beiläufigen und saloppen Art: „Wahrscheinlich sind wir Narren, daß wir nicht einen Vorwand suchen, um Deutschland den Krieg zu erklären, ehe es zu viele Schiffe gebaut hat und uns den ganzen Handel wegnimmt.“ Der Amerikaner war nicht wenig bestürzt über dieses so leicht dahingeworfene Wort.

„Seit 18 Monaten Ruhe und Frieden … “ So heißt es in dem Bericht Kitcheners an das Londoner Kriegsamt über die Konzentrationslager in Südafrika, in dem diese mit echt englischer Heuchelei als Gipfelleistung der humanen Behandlung von Feinden geschildert wurden. Zeichnung von Jean Vèber in „L‘ Assiette au Beurre“.
Er wandte ein, daß Deutschland doch wohl ebenso gut wie England das Recht habe, eine Kriegsflotte zu unterhalten, und daß das Deutsche Reich seines Wissens keine Veranlassung gebe, es zum Kriege herauszufordern. Ob England nicht besser tue, seine ganzen Anstrengungen darauf zu konzentrieren, daß es in Zukunft der deutschen Konkurrenz besser gewachsen sei? Doch Balfour lächelte wieder sarkastisch. „Mit Deutschland wirtschaftlich gleichen Schritt halten“, erwiderte er, „bedeutet, daß wir unseren Lebensstandard senken müssen. Da ist es für uns einfacher, wir führen einen Krieg. „Fünf Monate später (31. August 1907) wurde die Welt davon in Kenntnis gesetzt, daß England und Rußland ein Abkommen getroffen hatten, das die so lange heiß umstrittene Frage nach dem Glacis vor Indien endgültig bereinigte. Der Inhalt des Abkommens war der: Tibet wurde von beiden Mächten als außerhalb ihrer Interessensphären stehend anerkannt; Afghanistan wurde von Rußland fallen gelassen, wofür sich England verpflichtete, seinen Einfluß dort nicht weiter auszudehnen; der dritte Pufferstaat endlich, Persien, wurde in drei Zonen eingeteilt: in eine „neutrale“ sowie in je eine der englischen und russischen Interessensphäre.

„König Eduards Galgen“
„Die Proklamation“, so schrieb Kitchener in seinem offiziellen Bericht, „in der ich alle bewaffneten Buren kurzerhand zu Rebellen erklärte, hat die günstigsten Ergebnisse gehabt. Ich habe sie überall gleichmäßig anwenden lassen was die beste Wirkung hervorrief …“ -Zeichnung von Jean Vèber.
Was war geschehen? England hatte die Partie, die es seit einem Jahrhundert gegen Rußland durchkämpfte, remis gegeben. Dabei war Rußland durch seine Niederlagen und seine schweren Prestigeverluste im Kriege gegen Japan, zu denen Englands unfreundliche Neutralität nicht wenig beigetragen hatte, im Augenblick kaum imstande, die Sicherheit Indiens zu gefährden oder auch nur dem Vordringen Englands in das „Glacis“ ernstlichen Widerstand entgegenzusetzen. Trotzdem verzichtete England auf weiteren Länderraub in Asien, und das Verhalten seiner Regierung in den nächsten Jahren bewies, daß dieser Verzicht ausnahmsweise, aber aus guten Gründen nicht nur auf dem Papier stand, sondern daß ein gutes Einvernehmen mit Rußland eine der Grundlagen der gegen Deutschland gerichteten englischen Außenpolitik geworden war. Der deutsche Botschafter in London, Graf Wolff-Metternich, erkannte das sehr wohl. Vergeblich versuchte Grey ihm einzureden, daß die militärische Entlastung Indiens der einzige Zweck der Wendung sei, die die englische Politik nach einem vollen Jahrhundert dauernder Kriegsbereitschaft gegen Rußland genommen hatte. „Der springende Punkt ist“, so schrieb Wolff-Metternich nach Berlin, „daß England bemüht ist, mit aller Welt auf bestem Fuße zu stehen außer mit uns.“ Das war in der Tat der springende Punkt. Durch das Abkommen mit Rußland von 1907 fügte England das entscheidende Glied in die Kette, mit der es Deutschland umspannen wollte. Zwischen Balfours zynischen Worten und der Verständigung mit Rußland besteht ein tiefer innerer Zusammenhang.

Cecil Rhodes, der Totengräber des Burenvolkes Die Interessen des jüdisch-britischen Kapitals an den Gold- und Diamantfeldern von Transvaal gaben den Anstoß zur Vernichtung des freien Burenvolkes. – Aus „L‘ Assielte au Beurre“ (1901).
Nicht nur von der offiziellen Propaganda, sondern auch von ernsthaften englischen Historikern ist immer wieder behauptet worden, daß es das, was wir mit Recht die „Einkreisung Deutschlands“ vor dem Weltkriege zu nennen pflegen, niemals gegeben habe. Es sei nicht die Absicht der britischen Staatsmänner gewesen, Deutschland mit einem Heer von Gegnern zu umgeben, die es eines Tages mit Krieg überziehen sollten: sie hätten vielmehr nur die Herstellung eines dauernden Gleichgewichtszustandes in Europa im Sinne gehabt, und der Weltkrieg sei dann an Gegensätzen entzündet worden, denen England als neutraler Zuschauer gegenüberstand – bis der deutsche Einmarsch in Belgien es zum Eintritt in den Krieg gezwungen habe. Bei dieser Beweisführung pflegen sie dann auf die britischen amtlichen Dokumente jener Zeit hinzuweisen, in denen weder dem Worte noch der Sache nach von Einkreisung die Rede sei.
Nun, man wird nicht erwarten, daß sich aus amtlichen Papieren der Gegenbeweis erbringen läßt. Wer die Geschichte der britischen Politik kennt, weiß, daß ein so zielbewußtes Vorgehen auch gar nicht in ihrer Art liegt. Was gegen den jeweiligen Hauptgegner, ob es nun Spanien war oder Holland, Frankreich oder Rußland, zu unternehmen sei, das ergab sich für die Londoner Staatsmänner erst aus der jeweiligen Konstellation. Nur gewisse allgemeine Maximen – wie z. B. die Maxime vom Festlandsdegen – kamen immer wieder zur Anwendung; sonst aber operierten sie je nach der augenblicklichen Sachlage, bald mit mehr, bald mit weniger Glück. Es hieße also die weltpolitische Klarsichtigkeit der verantwortlichen Leiter der britischen Außenpolitik von 1900 bis 1914 stark überschätzen, wenn man ihnen zutrauen wollte, sie hätten den Weltkrieg gegen Deutschland nach einem Vorbedachten Plane gerade so herbeigeführt, wie er gekommen ist.
Das ist es ja aber auch gar nicht, was wir Deutschen meinen, wenn wir von der Einkreisung sprechen. Es soll damit nur gesagt werden, was im Wesentlichen durch unsere Erzählung schon zur Genüge deutlich geworden sein wird: daß England seit der Jahrhundertwende in Deutschland das hauptsächliche Hindernis für den Ausbau seiner Weltmachtstellung sah und daß also damit Deutschland für die britische Plutokratie an die Stelle getreten war, die früher nacheinander Spanien, Holland, Frankreich und Rußland einnahmen. Daraus ergab sich mit Notwendigkeit die Gesamtrichtung der britischen Politik: alle Entscheidungen werden so gefällt, daß sich aus keiner eine Stärkung, aus jeder nach Möglichkeit eine Schwächung Deutschlands ergibt. Für diese Grundtendenz der britischen Politik läßt sich der Beweis unwiderleglich erbringen. Lassen wir die Tatsachen sprechen:
Noch während in Südafrika der Vernichtungsfeldzug gegen die „Räuberbanden“ geführt wurde, hatte Deutschland selbst durch die Initiative des Kaisers, der in London zum Sterbelager seiner Großmutter der Königin Victoria, gefahren war, ein erstes Bekenntnis der englischen Umstellung hervorgelockt. Er bot nämlich der englischen Regierung rund heraus ein Defensivbündnis an, das der Lage der Dinge nach ein deutsch – englisches Zusammengehen gegen Rußland bedeutet hätte. Angesichts des noch immer unbeendeten Burenkrieges und eines bedrohlichen Vorgehens Rußlands in Afghanistan und Tibet mußte ein solches Defensivbündnis, das England einen Festlandsdegen verschafft hätte, in London eigentlich willkommen sein. Fast gleichzeitig fragten die Japaner angesichts der unverkennbaren russischen Absichten auf Korea wegen eines englisch-japanischen Bündnisses an, und als die Verhandlungen eingeleitet waren, schlugen die japanischen Vertreter vor, das Bündnis durch die Hinzuziehung Deutschlands zu einem Dreibund zu erweitern.

Das Denkmal der Burenfrauen in Bloemfontein
Die ergreifende Inschrift hält die Erinnerung an eine der entsetzlichsten Schandtaten der englischen Geschichte wach: 26 370 Frauen und Kinder sind in den Konzentrationslagern umgekommen.
Dieser Dreibund hätte, daran ist wohl kein Zweifel möglich, den russischen Expansionsabsichten einen für London sehr erwünschten Riegel vorgeschoben und damit den Weltfrieden voraussichtlich für lange Zeit gesichert. Aber die Erwägungen des Auswärtigen Amtes in London führten zu einem anderen Ergebnis. Der höchste Beamte des diplomatischen Dienstes, der ständige Unterstaatssekretär Bertie – der Varisittart jener Jahre – legte in einer für den internen Gebrauch bestimmten Denkschrift dar, daß ein Bündnis mit Deutschland „die Verständigung mit Rußland ein für allemal erschweren würde“, und schloß mit den Worten: „Der Preis für ein deutsches Defensivbündnis könnte höher sein als der Verlust, den wir erleiden, indem wir unsere Freiheit, eine britische Weltpolitik zu führen, opfern.“
Also mit Rußland, dem Hauptgegner eines Jahrhunderts, wird schon jetzt die Verständigung gesucht, Deutschland dagegen würde als Verbündeter England der „Freiheit“, eine britische Weltpolitik zu verfolgen, berauben! Anders gesagt: so unbequem Rußland auch im Augenblick noch ist, Deutschland ist doch der eigentliche Widersacher! Das Ende der Bündnisverhandlungen, an die man in der deutschen Öffentlichkeit damals große Hoffnungen knüpfte, war nur folgerichtig: England nahm den japanischen Degen mit Dank an, den deutschen wies es kühl zurück. Nicht die Tatsache, daß England in jenen kritischen Wochen des Jahres 1901 ein Bündnis mit Deutschland für unzweckmäßig hielt, ist von grundsätzlicher Wichtigkeit, sondern die Gründe, aus denen heraus die britischen Staatsmänner ihren Entschluß faßten. Denn diese Gründe (die man Deutschland natürlich nicht bekannt gab) rückten die Ablehnung des deutschen Angebots in die Stellung einer weltpolitischen Entscheidung erster Ordnung. Die englischen Staatsmänner entschieden sich gegen Deutschland – aus keinem anderen Grunde, als weil sie nicht wußten, wie sie sonst das Gespenst der wirtschaftlichen Überflügelung durch Deutschland bannen sollten. Nicht ein einziger ihrer Schritte in den nächsten Jahren läßt darauf schließen, daß sie jemals in dieser Entscheidung schwankend geworden wären. König Eduard VII., der in diesen Wochen seiner Mutter auf den Thron folgte, war nicht, wie eine die wahren Grundlagen der englischen Politik verkennende Auffassung auch in Deutschland wohl gemeint hat, der eigentliche Erfinder der Einkreisungspolitik. Er hatte sich in den achtziger Jahren, als der deutsche Handel noch nicht so gefährlich schien, mit dem gleichen Eifer für ein englisch-deutsches Zusammengehen gegen Rußland eingesetzt, mit dem er nun als König an der Isolierung Deutschlands arbeitete.

Eduard VII., das Pulverfaß Die Ahnung des Malers, der den Sohn der Königin Victoria bei seiner Thronbesteigung als Kriegsstifter sah, erwies sich als wahr: Eduard VIL wurde der Einkreiser Deutschlands und damit der Wegbereiter des Weltkrieges. – Aus „L‘ Assiette au Beurre“ (1901).
Er folgte eben auch nur der neuen Richtung, die Englands Politik genommen hatte, und erwies sich allerdings diplomatisch als einer ihrer fähigsten Vertreter. Es geschah sicher nicht ohne seine Mitwirkung, daß schon in den Tagen seiner Krönung (August 1902) die ersten Besprechungen englischer und französischer Staatsmänner über die schwebenden Afrikafragen (Ägypten und Marokko) stattfanden, und daß die britische Regierung sich hierbei geneigt zeigte, der französischen Zugeständnisse zu machen, die sie noch vor zehn Jahren als weit unter ihrer Würde angesehen hätte. Die französische Konkurrenz in Afrika, so fühlbar sie seit der Loslösung Ägyptens aus dem türkischen Machtbereich gewesen war, sie war eben doch nach Ansicht Londons nicht entfernt so bedenklich wie die deutsche in der ganzen Welt.
Während die Verhandlungen mit Paris noch im Gange waren, traten zwei Ereignisse ein, die in der englischen Öffentlichkeit einen so unzweideutigen Widerhall fanden, daß niemandem ein Zweifel darüber bleiben konnte, wo England „den Feind“ erblickte: die Beteiligung Deutschlands gemeinsam mit England und Italien an einer Flottendemonstration gegenüber Venezuela, das seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachgekommen war, und die Konstituierung der Bagdadbahn-Gesellschaft unter deutscher Führung (Frühjahr 1903). Die Beteiligung Deutschlands an der Flottendemonstration wurde in den Presseorganen der Londoner Plutokratie als eine unverschämte Geste gebrandmarkt, wobei man nicht verfehlte, die albernsten Märchen über das „anmaßende“ Auftreten der deutschen Seeoffiziere aufzutischen. Das Bagdadbahn-Unternehmen denunzierte man als einen offenbaren Beweis für die deutschen Weltherrschaftspläne – wie man denn überhaupt immer mehr darauf ausging, Deutschland uferlose Eroberungsabsichten anzudichten; jedes Mal wenn ein deutscher Staatsmann von der „deutschen Weltmacht“ sprach, so übersetzten das die englischen Blätter so als habe er von der „deutschen Weltherrschaft“ gesprochen.
Der Außenminister Lord Lansdowne, von Haus aus ein nüchterner Mann, wunderte sich selbst über diese Ausbrüche einer ins Kochen gebrachten Volksseele; er schrieb in jenen Tagen bedauernde Worte von dem „antideutschen Fieber, an dem unser Land leidet“. Aber dieses Bedauern entband ihn nicht davon, der kochenden Volksseele Rechnung zu tragen. Im Falle Venezuela wie im Falle Bagdadbahn musste er sich gegen das deutsche Vorgehen wenden, obwohl seiner Ansicht nach kein Anlaß für die Aufrollung eines Konfliktes gegeben war. Besonders die Bagdadbahn blieb seitdem ein Schreckgespenst, mit dem die Plutokratenpresse immer wieder ihren Lesern Angstträume einjagte. Dabei war Deutschland von Anfang an bereit gewesen, auf der für England einzig wichtigen letzten Strecke dieser Bahn – von Bagdad bis war eben so, dass die Regierung selbst nicht mehr freie Hand hatte. Die öffentliche Meinung das heißt also die von Neid gepeitschte Plutokratie, ihre folgsame Presse und deren gläubige Leser forderten ihre Opfer und machten es damit der Regierung unmöglich, die Opposition gegen Deutschland zu widerrufen, selbst wenn sie es gewollt hätte.

„Deutschland muß zerstört werden…“
Bei Ausbruch des Weltkrieges griff der Deutschenhaß in England so stark um sich, daß der Londoner Pöbel deutsche Läden zerstörte. – Zeitgenössische Zeichnung nach englischen Photos.
Der Besuch Eduards VII. in Paris, der kurz nach diesen Vorgängen erfolgte und mit der Verkündung einer „Entente cordiale“, wie es die Diplomatensprache nannte, seinen weithin hörbaren Abschluß fand, ist demnach nicht ein so epochemachender Einschnitt in der geschichtlichen Entwicklung gewesen, wie man es wohl manchmal dargestellt hat. Mit der englischen Bereitschaft, Frankreich Konzessionen zu machen, und das heißt vor allem, Marokko auszuliefern“ war der wichtigste Schritt bereits seit Jahren getan, und die „Entente“ ist nur ein weiteres Glied in einer längst geschmiedeten Kette gewesen. Zugleich eine Vorbereitung auf das wichtigste Glied: die endgültige Verständigung mit Rußland, dessen Bundesgenosse ja Frankreich war. Denn noch lag diese Verständigung ja erst in der Absicht der britischen Staatsmänner Ihrer Verwirklichung stand noch mancherlei entgegen – vor allem der unausgetragene Konflikt Rußland mit Japan, dem asiatischen Helfer Englands.
Da war es denn nur folgerichtig, daß König Eduart VII. sogleich nach dem Ausbruch des Russisch-Japanischen Krieges (Anfang 1904) in Petersburg wissen ließ, es sei nach wie vor Englands Wunsch, eine Verständigung herbeizuführen. Damit war das Doppelspiel, das England in diesem Kriege trieb, eingeleitet: auf der einen Seite förderte es die russische Niederlage in Ostasien auf jede Weise, besonders offenkundig durch die unfreundliche Haltung gegenüber der russischen Ostseeflotte, die auf ihrer tragischen Fahrt nach Ostasien überall auf englische Erschwerungen stieß und ihren Untergang in der Seeschlacht bei Tsushima nicht zuletzt diesen englischen Schikanen verdankt. Auf der anderen Seite gab es aber Rußland immer wieder zu erkennen, daß dieser Krieg nur ein Zwischenspiel sei, nach dessen Beendigung man die Machtpositionen in Asien endgültig abzugrenzen gedenke. Diese auch von Paris (Delcassè) unterstützten Versicherungen verfehlten in Petersburg ihre Wirkung nicht. Ihnen vor allem ist es zuzuschreiben, daß sich der Leiter der russischen Außenpolitik, Graf Lamsdorff, gerade in den kritischen Wochen des Krieges absolut ablehnend gegen ein deutsches Bündnisangebot verhielt. Wohl zögerte er, den englischen Beteuerungen vollen Glauben zu schenken, aber er verstand sie doch so, daß im Augenblick kein Angriff von England zu befürchten sei, und zog es daher vor, die Hände frei zu behalten.

Ein Dokument britischer „Humanität“ Der englische Zeichner Hodgskin hat im „Graphic“ vom 12. Februar 1916 die Szene festgehalten, wie der englische Dampfer „King Stephen“ die Mannschaft des Zeppelinluftschiffes „L 19“ in Seenot ohne Hilfe ließ. Die Schriftleitung bemerkte dazu: „So ist anzunehmen, daß jeden einzelnen der babykillers‘ das Schicksal getroffen hat, das er verdient.“ Die Torpedierung der „Athenia“, der Piratenüberfall auf die „Altmark“, die Bombardierung offener Städte und zahllose andere Verbrechen beweisen, dass die Engländer sich durch die Jahrhunderte nicht geändert haben.
Denn ein Bündnis mit Deutschland hätte nicht nur das mit Frankreich unwirksam gemacht, sondern auch sogleich die Feindschaft mit England gebracht. Für Rußland aber bedeutete die Annäherung an England keine so radikale Wendung seiner Politik wie umgekehrt für England die Annäherung an Rußland. Denn der englisch-russische Gegensatz war ja, wie es nun der englisch-deutsche Gegensatz war, keineswegs in den Weltverhältnissen unabweisbar begründet, sondern nur von England konstruiert, eine Ausgeburt des schlechten Gewissens der Plutokratie.
Es war das Unglück der deutschen Staatsmänner jener Jahre – das Unglück, nicht die Schuld -, daß sie die tiefe Verworfenheit der britischen Plutokratie nicht in ihrem ganzen Ausmaß erkannten und die englische Politik für freier hielten als sie tatsächlich war. Der Kaiser und sein Reichskanzler Bülow operierten so, als sei allein der ererbte deutsch-französische Gegensatz wirklich einschneidend, alle anderen Gegensätze aber durch kluge Außenpolitik zum Ausgleich zu bringen.
Darum versuchten sie bald hier, bald dort das deutsche Gewicht in die Waagschale zu legen und mußten scheitern, weil sie gutgläubig waren und die ungeheure Tragweite der englischen Entscheidung nicht erkannten. Trotz Welthandel und Weltschiff-Fahrt, trotz Kolonien und Hochseeflotte war das deutsche politische Denken gerade an den verantwortlichen Stellen noch immer fast ausschließlich kontinental. Es bewegte sich, wie man gesagt hat, in dem „Dreieck Paris- Wien- Petersburg“ und rechnete mit London nur im europäischen Kräftespiel. Gerade diese, aus jeder staatsmännischen Äußerung jener Jahre abzulesende Befangenheit der höchsten politischen Stellen in Deutschland ist die schlagendste Widerlegung der englischen Propaganda, die von Angriffsabsichten des Deutschen Reiches auf das britische Weltreich fabelte.
Nur einer unter den führenden Männern Deutschlands sah damals klarer und vertrat die Auffassung, daß, für den Augenblick zumindest, der deutsch. englische Gegensatz infolge der Einstellung Englands die Weltpolitik und damit auch die europäische beherrsche. Das war der Schöpfer der deutschen Hochseeflotte, Alfred von Tirpitz. Gerade weil er der Schöpfer der deutschen Hochseeflotte war, wurde er, fast mehr noch als der Kaiser, die Zielscheibe der englischen Hetzpropaganda, die wohl fühlte, daß hier jemand war der ihr Treiben durchschaute. Auch in Deutschland steht die Gestalt dieses überragenden Mannes ja keineswegs jedermann so deutlich vor Augen, daß es sich hier erübrigte, einige Worte über ihn zu sagen.

Dublin nach dem Aufstande von 1916 – Die bewaffnete Erhebung der irischen Nationalisten am Ostermontag 1916 und die Proklamierung der Irischen Republik waren die ersten gewaltigen Sturmzeichen des neuerwachten Kampfes für die Unabhängigkeit Irlands. Die Bewegung wurde von den englischen Truppen blutig niedergeschlagen.
Um das Entscheidende vorweg zu nehmen: Tirpitz war nie der Ansicht, es sei Deutschlands Aufgabe, dem britischen Weltreich den Untergang oder auch nur Schaden zu bereiten. Wohl aber hatte er frühzeitig auf die Reaktionen geachtet, die der Aufschwung des deutschen Handels in England hervorrief, und nicht minder auf die Rufe, die sich in dem Schlagwort „Germaniam esse delendam“ zusammenfaßten. Er deutete diese Reaktionen anders als die Bülow und Holstein und später die Bethmann-Hollweg und Kiderlen, die in all dem nur Wallungen einer leicht erregbaren Masse sahen. Zwar folgte er der britischen Plutokratie nun keineswegs so weit, daß er den Krieg zwischen Deutschland und England als unabwendbar und den Bau der Hochseeflotte als Vorbereitung zu einer großen Auseinandersetzung mit den Waffen betrachtete. Im Gegenteil, es war seine Überzeugung, daß die plutokratischen und kriegstreiberischen Einflüsse am ehesten dann die Oberhand in England bekommen könnten, wenn ein kriegerischer Überfall auf Deutschland, seine Kolonien und seinen Welthandel kein Risiko für die englische Flotte mit sich brächte. Darum setzte er seine ganze gewaltige Kraft ein, eine solche Kriegsgefahr zu bannen.

Dublin nach dem Aufstande von 1916 – Die bewaffnete Erhebung der irischen Nationalisten am Ostermontag 1916 und die Proklamierung der Irischen Republik waren die ersten gewaltigen Sturmzeichen des neuerwachten Kampfes für die Unabhängigkeit Irlands. Die Bewegung wurde von den englischen Truppen blutig niedergeschlagen.
Denn, wie der intimste Kenner der Tirpitzschen Gedankengänge, Ulrich von Hassell, sagt: „Von einer Tatsache war er überzeugt, nämlich daß England nur durch reale Macht genötigt werden könnte, von dem Abwürgen des unbequem erstarkten Wettbewerbers Abstand zu nehmen, Deutschland zu respektieren, sich mit seiner Wirtschaftsblüte auch über See abzufinden und es, wie Tirpitz es auszudrücken pflegte, als selbständigen Partner in das Weltgeschäft aufzunehmen.“ Eine direkte Annäherung an England war also seiner Auffassung nach aussichtslos, solange Deutschland nicht auf jede Weltgeltung Verzicht leisten wollte. Die britische Kriegsneigung, so glaubte er, konnte nur durch ein starkes Deutschland im Zaum gehalten werden und, was nicht weniger wesentlich war, dadurch, dass man England die Möglichkeit nahm, seine alte Methode der Festlandsdegen gegen Deutschland anzuwenden.
Aus diesem Grunde wurde das Verhältnis zu Rußland von ausschlaggebender Bedeutung für Deutschland. Die Entente wäre für die britische Plutokratie nichts wert gewesen ohne die Verständigung mit Rußland, und wir dürfen jetzt hinzufügen: auch Englands Verständigung mit Rußland über die asiatischen Dinge wäre für die britische Plutokratie nichts wert gewesen, wenn es zu einer deutsch-russischen Verständigung über Südosteuropa gekommen wäre.

Sie hielten den Deutschen die Treue – Die eingeborenen Truppen in den deutschen Kolonien dachten nicht daran, sich nach Ausbruch des Weltkrieges gegen die Deutschen zu erheben, sondern hielten ihnen während des ganzen Krieges die Treue – der beste Beweis für die gute Behandlung der Eingeborenen durch die Deutschen
Denn das war das bedeutendste Ergebnis des englisch-russischen Abkommens, das nun am 31. August 1907 unterzeichnet wurde: daß Rußlands Energien, in Asien gebunden, für den Balkan frei wurden. Nicht mit Unrecht sah Grey den Haupterfolg dieses Abkommens für England darin, daß es zugleich eine „Garantie gegen ein deutsch-russisches Abkommen“ sei. Und das war es auch, solange Rußland nicht von Deutschland Zugeständnisse erhielt, die seinem Anspruch auf Schutzherrschaft über alle slawischen Völker Rechnung trugen. Solche Zugeständnisse aber konnte Deutschland nur auf Kosten der Doppelmonarchie an der Donau machen, und so wurde Deutschland durch das Abkommen zwischen London und Petersburg die schwerste aller Entscheidungen auferlegt: die Option für Petersburg gegen Wien. Im Jahre 1913″, so erzählt Ulrich von Hassell, legte ich Tirpitz unter dem Eindruck von Gesprächen mit einem russischen Diplomaten eine Denkschrift vor, in der ich die Notwendigkeit vertrat, klar ins Auge zu fassen, daß Rußland sich nicht mit Konstantinopel als Ziel begnügte, sondern in panslawistischer Tendenz Wien als Zentrum eines großen Teils der Westslawen auf die Dauer nicht mehr dulden werde; wir müßten uns daher bald entscheiden, ob wir weiter mit der österreichisch-ungarischen Monarchie als Subjekt Politik treiben wollten, oder dazu übergehen müßten, sie im Einvernehmen mit Petersburg zum Objekt zu machen. Tirpitz bemerkte dazu mit resigniertem Lächeln, daß es in der deutschen politischen Leitung keine Persönlichkeit gebe, die imstande wäre, ein derartiges Problem mit der Kühnheit und Entschlußkraft anzupacken, die dazu erforderlich wären.“
Wenn die britische Propaganda die Schuld für die Einkreisung Deutschlands und den Ausbruch des Weltkrieges von der britischen Plutokratie abwälzen will, so weist sie mit Vorliebe darauf hin, daß der Konflikt, aus dem der Weltkrieg entstand, der österreichisch-serbische, ein Konflikt war, der England „nichts anging“. Aber damit setzt sie die politischen Einsicht der britischen Staatsmänner herab. Denn diese haben schon im Schicksalsjahr 1907, klar erkannt, daß das nächste Kapitel der Weltgeschichte einen Zusammenstoß zwischen Deutschland und Rußland bringen müsse. Es ist schlechterdings nicht wahr, daß der österreichisch-russische Gegensatz in Südosteuropa England „nichts anging“. Wäre es gelungen, ihn zu bereinigen – was allerdings wohl, wie Tirpitz erkannte, nur durch Aufopferung der Donaumonarchie möglich gewesen wäre -, so wäre auch das von sehr großer Bedeutung für England geworden. Denn dann mußte es mit Recht befürchten, daß Rußlands Energien sich wieder dem asiatischen Felde zuwandten.
Es mag sein, daß Grey persönlich 1907 noch der Ansicht war, England sei jetzt zweier Konkurrenten auf einmal ledig und könne das Weitere dem freien Spiel der europäischen Kräfte überlassen, an deren „Gleichgewicht“ England allerdings nun nicht im mindesten mehr gelegen war. Tatsächlich aber hatte es sich durch die Verständigung mit Rußland selbst gebunden. Der Text des Abkommens enthielt zwar kein Wort von irgendwelchen gegenseitigen Beistandsverpflichtungen. Aber angesichts der Tatsache, daß die beiden Festlandsdegen Englands, Frankreich und Rußland, keine offensichtliche Überlegenheit über das Deutsche Reich und seine Verbündeten hatten, daß also der Ausgang eines ernsten Konfliktes durchaus ungewiß war, hatte England nur die Wahl, entweder Rußland beizustehen, oder es sich für spätere Zeit zum Feinde zu machen.

Die Beschießung von Dar-es-Salam durch die Engländer im November 1914 war ein neuer brutaler Völkerrechtsbruch der Engländer. Denn Dar-es-Salam, die Hauptstadt Deutsch-Ostafrikas, war ein offener, unverteidigter Platz.
Als die Mordtat von Serajewo geschehen war und die deutsche Unterstützung des Wiener Ultimatums an Belgrad keinen Zweifel mehr darüber ließ, daß der kritische Augenblick für die Erhaltung des europäischen Friedens gekommen war, da äußerten sich alle Diplomaten vom Fach, die Grey befragte, in ganz eindeutigem Sinne. „Russland“, bemerkte Nicolson „wird unsere Haltung in dieser Krise als Prüfstein betrachten, und wir müssen äußerst vorsichtig sein, es uns nicht zu entfremden.“ Und noch deutlicher äußerte sich der ständige Unterstaatssekretär, Sir Eyre Crowe: „Sollte England neutral bleiben, wie werden sich Rußland und Frankreich dann in dem Falle verhalten, daß sie siegen? Wie wird es dann mit Indien und dem Mittelmeer stehen?“ Und Buchanan, der Petersburger Botschafter, depeschierte: „Wenn wir Rußland jetzt im Stiche lassen, können wir nicht hoffen, jenes freundschaftliche Zusammengehen mit ihm in Asien fortzusetzen, das von solcher Lebenswichtigkeit für uns ist.“ Alle diese Worte wurden noch in den Tagen v o r dem Ausbruch des Krieges geschrieben und widerlegen also so deutlich wie nur möglich die Behauptung, England habe sich bis auf den letzten Augenblick für eine Vermittlung eingesetzt. Es war, wie wir sahen, dazu gar nicht mehr imstande; denn es hatte sich an den russischen Wagen gebunden. Die Leiter der deutschen Politik erkannten allerdings auch dieses nicht. Sie waren aufs äußerste bestürzt, als ihnen am 4. August 1914 die englische Kriegserklärung übermittelt wurde.

Karakulschafe bei der morgendlichen Zählung
Die Züchtung des Karakulschafes, dessen Fell den wertvollen Persianerpelz liefert, erfordert größte Mühe und Aufmerksamkeit. Obwohl der Neid der Engländer das vor dem Weltkrieg bestehende Ausfuhrverbot von Zuchttieren nach der Südafrikanischen Union teilweise aufgehoben hat, haben die deutschen Farmer in Südwest die Ergebnisse der Karakulzucht ständig steigern können.
In Wahrheit war seit dem Augenblick, da Deutschland als „der Feind“ in die politischen Berechnungen Londons eingestellt wurde, nichts mehr dem Belieben eines einzelnen Außenministers überlassen gewesen. Die Entscheidung, die damals, im ersten Jahre des neuen Jahrhunderts, gefällt worden war, sie trug jetzt bittere Frucht – die Frucht vierjährigen Völkermordens.
Der letzte Beutezug
Bedürfte es noch weiterer Beweise für die Motive aus denen England in den Krieg von 1914 gegangen ist, so würden sie durch die Methoden geliefert, mit denen es diesen Krieg führte.
Keiner der anderen Gegner Deutschlands setzte sich so über die Gesetze hinweg, die nach bisherigem Brauch auch im Kriege zwischen den Völkern gegolten hatten. Alle führten den Kampf als Krieg der Armeen – alle bis auf England. Wohl erklärten die Londoner Staatsmänner immer wieder, sie führten nur gegen den Kaiser und den Militarismus Krieg, genau wie sie 1939 scheinheilig erklärten, das arme deutsche Volk von der Herrschaft des Führers und des Nationalsozialismus „befreien“ zu wollen.

Sisalpflanzung in Deutsch- Ostafrika Die von Dr. Carl Peters erworbene, von den Engländern geraubte deutsche Kolonie ist fast doppelt so groß wie das Deutschland des Jahres 1914. Zu den wichtigsten Plantagenprodukten zählt der Sisalhanf. Er zeichnet sich durch Festigkeit und Geschmeidigkeit aus und bietet vielfache Verwendungsmöglichkeiten.
Aber ihre Taten bewiesen das Gegenteil. Was hatte es mit dem Kampf gegen den „Militarismus“ zu tun, daß England alles ihm erreichbare deutsche Privateigentum beschlagnahmte, alle deutschen Privathäuser und Fabriken, alle deutschen Guthaben auf den Banken Londons und der anderen Städte des britischen Weltreichs? Warum vergriff es sich an deutschen Patenten? Warum drückte es auf die Neutralen, daß sie die Handelsbeziehungen mit deutschen Firmen abbrächen, und führte Schwarze Listen ein, damit ein englischer Boykott gegen die Widerstrebenden organisiert werden konnte? Warum verweigerte es der neutralen Schiff-Fahrt die Kohlen, wenn sie sich nicht verpflichtete, ausschließlich für England zu fahren? Warum zwang es die wirtschaftlich von ihm abhängigen neutralen Mächte, Deutschland formell den Krieg erklären und die in ihren Häfen liegenden deutschen Handelsschiffe zu beschlagnahmen?
Wir sprechen hier nicht von den Verbrechen gegen das auch von England zu vielen Malen anerkannte Völkerrecht; nicht von der alle Seerechtsdeklarationen willkürlich außer Kraft setzenden Ausdehnung der Bannwarenlisten, mit der England die Hungerblockade über Deutschland verhängte; nicht von den heimtückischen U-Boot-Fallen, die ritterlichen deutschen Seeleuten den Tod brachten gerade deshalb, weil sie den Kampf ritterlich führten; nicht von dem feigen Überfall auf den Kreuzer „Dresden“ in chilenischen Hoheitsgewässern; nicht von „Beralong … .. King Stephan“ und den anderen Namen, die unauslöschliche Schande über die britische Flotte brachten.
Denn so abscheulich und verbrecherisch diese Handlungen waren und so sehr sich an ihnen zeigte, welchen Untermenschentums die auf ihre „Fairness“ so stolze britische Nation fähig ist, so decken sie doch noch nicht den ganzen Umfang der Absichten auf, die England in diesem Kriege leiteten. Auch die entartete und jedes Gefühls für Humanität bare Kriegführung richtet sich immer noch auf den unmittelbaren Zweck des Krieges: die Vernichtung der feindlichen Widerstandskraft. Also auf die Beendigung des Krieges, nicht auf das, was hinterher kommt. Mit seinem Griff nach dem deutschen Privateigentum und seiner Zerstörung der deutschen Handelsbeziehungen aber bewies England, daß ihm die Ellbogenfreiheit, die es durch den Kriegszustand erhielt, nur eine Gelegenheit war, Wünsche zu verwirklichen, die mit seinen angeblichen Kriegszielen nicht das mindeste zu tun hatten. Durch diese Gewalttaten, die keinem seiner Alliierten, sondern nur ihm selbst zugute kamen, offenbarte sich England im Weltkriege abermals als das, was es in seiner Geschichte von jeher gewesen war: als ein plutokratischer Raubstaat.

Kaffeepflücken in Deutsch- Ostafrika Die wertvollen, mit unendlichem Fleiß aufgebauten Pflanzungen wurden nach dem Kriege von den Engländern enteignet oder zu einem lächerlich geringen Preis – 3 v. H. des wirklichen Wertes! – versteigert.
Die militärische Macht, über die Deutschland in seinen Kolonien verfügte, konnte nicht entfernt eine Bedrohung des britischen Weltreichs darstellen, ebenso wenig wie der Bestand dieser Kolonien im Frieden eine Schmälerung der englischen Weltstellung bedeutete. Über die strategische Lage der deutschen Besitzungen hatte man in London immer sehr geringschätzig gedacht. Wenn also England trotzdem gleich nach Kriegsbeginn über die deutschen Kolonien herfiel, so geschah das nicht aus militärischen Erwägungen, sondern aus hemmungsloser Raubgier, hinter der das Verlangen stand, dem gefährlichen Konkurrenten der letzten zwanzig Jahre die Möglichkeit eines Wiederaufstieges zu seiner mühsam errungenen Weltgeltung zu nehmen. Der zwingendste Beweis dafür ist die Tatsache, daß man am Ende des Krieges auch nicht den mindesten stichhaltigen Grund für den Raub der deutschen Kolonien finden und weder ein wirtschaftliches noch ein strategisches Interesse geltend machen konnte, sondern nach längerem Kopfzerbrechen zu der infamsten aller Lügen seine Zuflucht nehmen mußte, die jemals von englischen Hirnen und Federn gegen Deutschland ausgeheckt worden war: zu der Kolonialschuldlüge. So weit hatte sich auch in den ärgsten Zeiten des „antideutschen Fieber“ vor dem Weltkriege nicht einmal der eingefleischteste Deutschenhasser in England verstiegen, daß er behauptet hätte, Deutschland sei „unfähig zum Kolonisieren“ und verstehe es nicht, diese menschlich zu behandeln. Und hätte er diesen Gedanken gefaßt, er hätte es nicht wagen dürfen ihn zu Papier zu bringen; denn nicht nur aus Deutschland sondern aus der ganzen Welt wäre ihm ein tausendfältiges Echo entgegengetönt, in dem die Worte Irland, Indien, Südafrika als vernichtende gegen England laut geworden wären.
Nichts vermag besser die Abgefeimtheit dieser Lüge zu erweisen als eine Erinnerung an den Verlauf der Raubfeldzüge gegen die deutschen Kolonien, zu denen die Engländer sich überall in der Welt Hilfe suchen mußten, weil sie sie dort nicht fand wo sie ihnen am willkommensten gewesen wäre: den Eingeborenen, die Deutschland so „unmenschlich“ behandelt hätte. Franzosen, Portugiesen, Belgier, Buren, Inder waren nötig, 300 000 Mann mit 146 Generalen allein in Deutsch- Ostafrika – alles, weil die Eingeborenen sich nicht gegen die deutschen Truppen erhoben.
Nicht in Togo, das von der kleinen deutschen Polizeitruppe nur wenige Wochen gegen französische Übermacht verteidigt werden konnte und als erste der afrikanischen Kolonien Deutschlands verlorenging (25. August 1914).
Nicht in Kamerun, in das die Franzosen und Engländer gemeinsam einrückten. Gegen ihre vereinigten Kräfte vermochte sich die deutsche Schutztruppe, der sich Tausende von eingeborenen Kriegern anschlossen unter der Führung ihres Kommandeurs, Oberstleutnant Zimmermann, und des Gouverneurs Ebermaier lange zu halten. Nicht eine Niederlage im Felde, sondern das Ausgehen der Munition machte dem Kampfe nach anderthalb Jahren ein Ende. Doch auch dann blieb das Gesetz des Handelns in deutscher Hand: die Truppe erreichte unbehindert von den Verfolgern das neutrale Gebiet der spanischen Kolonie Muni (Februar 1916), und ebenso lange verteidigte sich Hauptmann v. Raven mit seinen Leuten in der Bergfeste Mora in Nordkamerun. Nicht weniger als 50 000 Eingeborene folgten den Deutschen auf spanisches Gebiet – ein schlagender Beweis für ihre Sehnsucht nach der humanen Herrschaft der Engländer!

Jachthafen in Dar-es-Salam Die schönen Anlagen des deutschen Jachthafens einschließlich aller Klubgebäude wurden von den Engländern mit Beschlag belegt, während die Deutschen in Schilfhütten des Inderviertels verwiesen wurden. Englische Ritterlichkeit!
Für die Deutschen in Südwestafrika begann der Kampf erst in den letzten Wochen des Jahres 1914. Denn die Regierung der Südafrikanischen Union, der man von London aus die Besetzung der deutschen Kolonie aufgetragen hatte, wurde in den ersten Monaten des Krieges durch eine Aufstandsbewegung gelähmt. Ein Teil der burischen Führer aus dem großen Ringen mit England – die Delarey, de Wet und Maritz – hielt den Augenblick der Abrechnung mit England für gekommen und erhob sich gegen den anderen Teil – die Botha und Smuts -, der jetzt die Regierung bildete. Was Milner einst den „Räuberbanden“ verweigert hatte, war nun doch Wirklichkeit geworden: die Beteiligung der Buren an dem südafrikanischen Staat. Botha, der große Gegner Kitcheners, war der erste Premierminister des neuen Gesamtstaates geworden, und nun brachte der Ausbruch des Krieges ihn in Gegensatz zu vielen von denen, deren Führer er einst gewesen war. Das wurde die Tragik seines Lebens: er fühlte und dachte immer noch als Bur und sah in der Mitarbeit mit den Engländern nur etwas, das Notwendigkeit und Vernunft vorläufig geboten. So wurde er, obwohl seine Seele es anders meinte, das Werkzeug Englands, zuerst gegen diejenigen unter seinen Volksgenossen, die seine politische Ansicht nicht teilten, und dann gegen Deutschland. Er mußte erst den Aufstand mit Waffengewalt niederkämpfen und dann eine englisch-burische Armee gegen Deutsch-Südwest führen.
67 000 Engländer und Buren gegen 5000 Mann deutscher Schutztruppen, von denen nur 4000 felddienstfähig waren – der ungleiche Kampf konnte nicht lange währen. Dennoch hielten 35 000 Eingeborene den Deutschen in ihrer verzweifelten Lage die Treue.
Am 12. April 1915 zog Botha in Windhuk, der Hauptstadt der deutschen Kolonie ein, und seine Leute besetzten die von den abziehenden Schutztruppen zerstörte Großfunkstation. Damit hielt er den Auftrag den ihm die englische Regierung erteilt hatte, für erledigt und zeigte sich geneigt, mit dem Kommandeur der Schutztruppen, Oberstleutnant Franke, und dem Gouverneur Dr. Seitz einen Waffenstillstand bis zum Kriegsende abzuschließen. Aber das war nicht nach dem Sinne des britischen Generalgouverneurs in Kapstadt, Lord Buxton. Der verlangte die bedingungslose Übergabe der Deutschen und die Besetzung des gesamten Schutzgebietes. So schob er Botha in die Rolle gegen die Deutschen, in die einst Kitchener von Milner gegen die Buren gedrängt worden war, und es begann ein sinnloser und verlustreicher Feldzug von drei Monaten, bis dann Lebensmittelmangel und die gänzliche Erschöpfung der Reit- und Zugtiere am 7. Juli die Übergabe der deutschen Streitkräfte erzwangen. Immerhin erwirkte es Botha, daß die deutschen Reservisten in ihren Zivilberuf zurückkehren durften und daß überhaupt für die Dauer des Krieges das Leben in der Kolonie seinen Gang wie bisher ging.

Schulausflug in Deutsch- Ostafrika
Bis 1924 lebten in den deutschen Schutzgebieten mit Ausnahme von Deutsch-Südwest überhaupt keine Deutschen mehr. Erst dann begann allmählich und unter schwierigsten Verhältnissen der Wiederaufbau auf wirtschaftlichem und auch kulturellem Gebiet. Schon 1938 machte der deutsche Anteil mit rund 3000 Menschen mehr als ein Drittel der weißen Bevölkerung aus.
Hier, wo Buren ein gewichtiges Wort mitzureden hatten, wurde also das deutsche Privateigentum nicht angetastet, und als dann nach dem November 1918 die deutschen Südwester unter Bruch aller Zusicherungen, die man ihnen gegeben hatte, doch von ihrem Besitz vertrieben wurden, da geschah das nicht durch burische Initiative, sondern auf eine Weisung von London hin.
Die glänzendste Rechtfertigung der deutschen Kolonisierungsmethoden brachte aber das Verhalten der eingeborenen Soldaten und Träger während des einundfünfzig Monate langen Heldenkampfes in Deutsch- Ostafrika. 3000 Askaris und über 1000 Träger fanden hier den Tod, und doch dachten die Überlebenden nicht daran, die deutsche Truppe und ihren Führer Lettow-Vorbeck zu verlassen, obwohl es ihnen nicht verborgen bleiben konnte, daß ohne ihre Hilfe ein weiterer deutscher Widerstand unmöglich geworden wäre.

Deutsche Schule in Deutsch- Südwestafrika Bei der Besetzung von Deutsch- Südwest wurden natürlich auch die Schulen von den Engländern geraubt. Die Deutschen müssen sich mit primitiven Häusern am Rande der Stadt begnügen, denen nur deutsche Pflege und Sauberkeit ein einigermaßen freundliches Aussehen geben.
Auch hier überließen die Engländer den ernsten Kampf möglichst ihren Hilfsvölkern, zu denen auch diesmal wieder die Buren zählen mussten. Denn nachdem ein 8000 Mann starkes Landungskorps aus indischen Truppen in der viertägigen Schlacht von Tanga (2.-5. November 1914) von 250 Deutschen und 750 Askaris unter schweren Verlusten auf die Schiffe zurückgetrieben und ein Versuch zu Lande in die Kolonie einzufallen, durch den Sieg Lettow-Vorbecks bei Jassin (18. und 19. Januar 1915) vereitelt worden war, überließen die Engländer die weitere Führung des Krieges der Südafrikanischen Union. Im Januar 1916 begann der Feldzug, in dem der Feldherrnruhm des Generals Smuts ein klägliches Ende nehmen sollte. Mit 90 000 Mann erschien er an der Grenze von Deutsch-Ostafrika, dazu mit reichlicher Artillerie, Minenwerfern, Fliegern und zahllosen Kraftwagen und Reittieren. Doch als die Regenzeit begann, schmolz sein Heer zusammen. Die Buren, die schon unlustig ins Feld gezogen waren, kehrten scharenweise nach Hause zurück, und es blieb nichts übrig, als sie durch Neger, die man zum Teil sogar aus Jamaika herüberholen musste, zu ersetzen. Smuts gab das Kommando ab, das er so unrühmlich geführt hatte, und der neue Befehlshaber, General Deventer, konnte erst im Frühjahr 1917 zu einem großen Angriff ausholen. Doch auch er vermochte nichts gegen die kleine Schar Lettow-Vorbecks; nach der Niederlage in der viertägigen Schlacht bei Mahiwa (15.-18. Oktober 1917) gab er den weiteren Vormarsch auf. Und nun ergriffen die Deutschen die Offensive. Ein erfolgreicher Einfall in die portugiesische Kolonie Mozambique behob den Mangel an Gewehren, Munition, Verpflegung und Medikamenten. So vermochte Lettow-Vorbeck im nächsten Jahre bis zum Sambesi und über die Grenze von Rhodesien vorzudringen. Durch harte Verluste schwer getroffen, aber unbesiegt, stand die Schutztruppe in Feindesland, als sie am 25. November 1918 von Berlin aus die Weisung erhielt, die Waffen zu strecken. „Nur knirschend fügten sich die Askaris dem ihnen unverständlichen Befehl“ (Methner).
Erst der Zusammenbruch der Heimat gab unsere Kolonien in die Hand der Engländer, nicht deren soldatische Tüchtigkeit und noch weniger der Wille der von den Deutschen angeblich so schlecht behandelten Eingeborenen.
So verwerflich das Gewerbe des Räubers ist, so muß doch zugestanden werden, daß ein nicht geringes Maß von persönlichem Mut dazu gehört, es erfolgreich auszuüben. Es ist also verständlich, wenn der „kühne Räuber“, ein Robin Hood, ein Schinderhannes, ein Fra Diavolo, in den Liedern der Völker mit einem achtungsvollen Schauder genannt wird. Solch ein Nachleben wird dem englischen Raubstaat nicht beschieden sein. Denn es ist nur selten vorgekommen, daß er die Beute in kühnem Zugriff und unter Gefahr seines Kopfes gepackt hat. Dazu reichten bei ihm meistens weder Kraft noch Mut aus, und er mußte dann ein anderes Verbrechen zu Hilfe nehmen, eines, dem so ganz und gar kein romantischer Schimmer anhaftet: den Betrug.

Englische Schule in Deutsch- Südwestafrika
Während die deutschen Kinder in engen Räumen untergebracht sind, haben die Engländer für ihre Kinder in Windhuk nicht nur die alte deutsche Schule beschlagnahmt, sondern sich von den Erträgnissen deutschen Fleißes auch noch diesen Schulpalast errichtet.
So ging es auch mit den deutschen Kolonien. Es hieße England zuviel Ehre antun, wollte man sagen, es habe sie nur geraubt; es mußte sie sich, die Wahrheit zu sagen, auch noch erschleichen, um wirklich in ihren Besitz zu kommen.
Man konnte in London während der letzten Wochen des Weltkrieges nicht im mindesten darüber im Zweifel sein, daß die deutsche Regierung im Falle eines Waffenstillstandes eine Anerkennung ihres kolonialen Besitzstandes, wenn auch nicht in allen Einzelheiten, so doch im großen ganzen und zum mindesten im Prinzip erwartete. Denn allzu unzweideutig hatte sie erklärt, dass sie ihr Angebot eines Waffenstillstandes im Vertrauen auf die vierzehn Friedenspunkte des Präsidenten Wilson gemacht habe, also auch im Vertrauen auf den Punkt 5, der „eine freie, weitherzige und absolut unparteiische Regelung aller kolonialen Ansprüche“ als Voraussetzung eines gerechten Friedens nannte. „Unparteiische Regelung“ – darunter war nur zu verstehen, dass allen Kriegführenden Mächten, also auch Deutschland, ein Recht auf Kolonien zugestanden wurde. Oder war es anders zu verstehen? Eins ist jedenfalls auffällig: als Wilson nach dem deutschen Waffenstillstandsangebot in London fragte, ob die englische Regierung bereit sei, auf der Basis der vierzehn Punkte mit Deutschland in Verhandlungen einzutreten, da verlangten Lloyd George und Balfour über eine Anzahl von Punkten nähere Aufklärung, den Punkt dagegen, der die Kolonialfrage betraf, ließen sie unerörtert. Waren sie damals etwa noch bereit, Deutschland seine Kolonien zurückzugeben und wurden dann erst später anderen Sinnes?
Es gibt wenig Dinge, in denen es der englischen Propaganda so gut gelungen ist, den wahren Sachverhalt in sein Gegenteil zu verkehren und diese verkehrte Auffassung der Welt als die richtige aufzureden, wie in dem Verhalten Englands zu den deutschen Kolonien auf den Friedensverhandlungen. Es ist, als ob das schlechte Gewissen über den Raub auch durch die Erfindung, der Kolonialschuldlüge noch nicht zur Ruhe gebracht worden wäre, es musste auch noch die Schuld für den Betrug an Deutschland von den britischen Staatsmännern abgewälzt werden.

Der Reiter von Südwest Das schöne Denkmal ist das Wahrzeichen nicht nur Windhuks, sondern ganz Deutsch-Südwestafrikas. Es wurde nach den Aufständen der Hereros und Hottentotten (1904-1907) zur Erinnerung an die Gefallenen der Schutztruppe errichtet.
Darum wird es so dargestellt, als wäre man in London noch bis zum Beginn der Pariser Friedenskonferenz in echt englischer Ritterlichkeit bereit gewesen, auf die Annexion der deutschen Kolonien zu verzichten und erst durch andere Einflüsse, besonders aus den überseeischen britischen Dominions, dazu veranlaßt worden, einen anderen Standpunkt einzunehmen.
Tatsächlich hat Lloyd George diese Legende selbst in die Welt gesetzt, und zwar schon auf der Friedenskonferenz. Offenbar wollte er von vornherein allen Einwendungen vorbeugen, die etwa von französischer Seite gegen ein so starkes Anwachsen des britischen Weltreichs erhoben werden könnten. „Ich war immer der Ansicht“, so hat er einmal bei Beginn der Verhandlungen zu Clemenceau gesagt, „daß unser Kolonialreich eher schon zu groß ist. Neue Kolonien kosten nur und bringen uns nichts ein – was sollen wir damit? So denken wir in England – aber so denkt man nicht überall im Britischen Reich. Ich muß auf die Wünsche der Regierungen von Südafrika, von Australien, von Neuseeland, von Kanada Rücksicht nehmen. Sie haben mit eigenen Truppen Deutsch-Südwestafrika besetzt, Neu-Guinea, Samoa – sie erheben jetzt Besitzansprüche auf diese Eroberungen. Ich darf die Herren nicht enttäuschen – schließlich muß ich ja daran denken, daß es sich um Glieder des Britischen Reiches handelt, auf deren Hilfe wir auch später noch zu rechnen haben werden. Sie sagen, es seien wichtige strategische Gründe für sie, daß sie die Kolonien haben müssen, Sicherheitsgründe sozusagen . . .“
Danach mußte es so aussehen, als sei die englische Regierung selbst erst unmittelbar vor der Konferenz durch die begehrlichen Wünsche der Dominion-Regierungen umgestimmt worden. Um noch zu unterstreichen, daß die Initiative von diesen ausgegangen sei, veranstaltete dann Lloyd George ein paar Tage später jene berühmt gewordene Szene, bei der Wilson sich zu seiner Überraschung plötzlich den Chefs der Regierungen von Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika – dem zwergenhaften, skrofulösen Hughes, dem hünenhaften Massey, dem filmstarschönen Borden und dem wettergebräunten Smuts – gegenübersah, die ihn mit der Wucht ihrer Argumente erdrückten, während Lloyd George sich unparteiisch im Hintergrunde hielt. So entstand dann der für London so willkommene Eindruck, als seien es diese bösen Halbexoten aus Übersee gewesen, die es England unmöglich gemacht hätten, großherzig zu sein.
Zum Unglück für diese Legende wird sie aber von ihrem eigenen Urheber Lügen gestraft. Zwanzig Jahre nach dem Weltkriege, im Jahre 1938, erschienen nämlich in London zwei dicke Wälzer mit Erinnerungen Lloyd Georges an die Nachkriegszeit, betitelt „Die Wahrheit über die Friedensverträge“. Die wenigen Leser, die diese unförmigen Bände gefunden haben, werden nicht durch allzu viel Wahrheit in ihrer Erkenntnis bereichert worden sein. Aber in einem Punkte trägt das Werk seinen Titel doch nicht so ganz zu Unrecht: in dem Punkte des Raubes an den deutschen Kolonien. Denn Lloyd George veröffentlichte zum ersten Mal ein Sitzungsprotokoll des britischen Reichkriegskabinetts (Imperial War Cabinet) aus den letzten Dezembertagen 1918. Es waren die Tage, da Wilson, weil ihm die Zeit bis zur Eröffnung der Friedenskonferenz zu lang wurde, nach England gekommen war. Lloyd George hatte mit ihm eine erste hochpolitische Unterredung gehabt und berichtete nun dem Kabinett über das Ergebnis.

Der deutsche Friedhof am Waterberg– Hier ruhen Seite an Seite mit den Gefallenen aus dem Hereroaufstand die tapferen Männer der Schutztruppe, die bei der Verteidigung Deutsch-Südwests während des Weltkrieges gegen eine mehr als zehnfache englisch-burische Übermacht ihr Leben ließen.
Er stellte eine erfreuliche Übereinstimmung der Meinungen zwischen der amerikanischen und der englischen Regierung fest, besonders auch in einer Frage, bei der man von Wilson doch wohl anderes erwartet haben mochte. „Was die deutschen Kolonien betrifft“, so konnte er nämlich zur Befriedigung der übrigen Kabinettsmitglieder, besonders des Generals Smuts, feststellen-, „so stimmt der Präsident völlig mit uns überein, daß sie keinesfalls an Deutschland zurückgegeben werden dürfen.“ Also noch vor Beginn der Konferenz hatte das britische Kabinett seine Meinung gebildet, ja, wir können hinzufügen: noch vor Beginn der Waffenstillstandsverhandlungen. Denn die Ansprüche Australiens und der anderen Dominions waren nicht erst heute oder gestern, sondern schon vor Jahr und Tag geäußert worden, und ebenso waren die Gründe, die für die Berücksichtigung sprachen, seit Jahr und Tag als zwingend anerkannt. Dafür stimmten sie ja mit den Gründen, die die einheimische Plutokratie für die Aneignung der deutschen Kolonien hatte, allzu gut überein. Willkommen war es nur, daß man jetzt mit verteilten Rollen spielen konnte: die Herren von Übersee, die sich dieser Rolle nicht schämten, als die unbarmherzigen Erpresser, die Herren aus London als die Gentlemen, die sich wohl oder übel in die Erpressung fügten, obwohl sie gar nicht wußten, was sie mit dem neuen Kolonialbesitz anfangen sollten.

Von Deutschland gebaut – von England geraubt Der Sitz der deutschen Regierung in Windhuk (Deutsch- Südwestafrika). Wie wenig die Eingeborenen aller deutschen Schutzgebiete mit den fremden Mandatsregierungen einverstanden sind, geht aus unzähligen Schreiben und Aufrufen hervor, in denen es immer wieder heißt: „Tausende und aber Tausende harren der Stunde, wo die große Mutter Deutschland sich ihrer Kinder wieder annehmen wird!“
In diesem letzten Punkt darf man Lloyd George schon Glauben schenken. Man hielt in London wirklich gar nichts von der neuen Beute – weder wirtschaftlich noch strategisch noch sonst irgendwie. Aber ist die Überzeugung von der Nutzlosigkeit einer Kolonie für die Londoner Plutokratie jemals ein Grund dafür gewesen, auf sie zu verzichten? Die Hauptsache war doch, daß die anderen sie nicht hatten.
Während also die Beute, die man Deutschland entriß, für England nur eine Belastung darstellte, verhielt es sich anders mit dem, was England aus dem Zusammenbruch des Türkischen Reiches an sich nahm.
Solange Rußland der Hauptgegner gewesen war, hatte England das Türkische Reich auf alle Art zu erhalten versucht. Sobald es aber die Option für Rußland gegen Deutschland ausgesprochen hatte, mußte es auch seine Politik gegenüber der Türkei revidieren. Es war nur folgerichtig, daß sich nach der englisch-russischen Verständigung die Türkei mehr und mehr an Deutschland annäherte; denn dieses war die einzige Großmacht, die nicht auf ihre Teilung hinarbeitete, sondern an der Erhaltung zum mindesten ihres asiatischen Machtbereiches interessiert war. Die Reorganisierung der türkischen Armee unter deutscher Leitung, die Förderung des Bagdadbahnprojektes durch den Sultan waren die sichtbarsten Zeichen dieser Annährung. Lloyd George beliebte das so auszudrücken: der Sultan (den die Engländer Rußland preisgegeben hatten!) habe sich „treulos an die Deutschen verkauft“.
Mit diesem „Verrat“ hatte das Türkische Reich nach englischer Auffassung seine Existenzberechtigung verwirkt. London, das einst bereit gewesen war, um jeden Zollbreit türkischen Bodens, der dem Sultan entrissen werden sollte, einen Weltkrieg zu entfesseln, konnte sich jetzt gar nicht genug darin tun, Pläne zur restlosen Aufteilung der Türkei zu ersinnen. Allen Verbündeten und auch denen, die es erst noch werden wollten oder besser sollten, wurden Portionen angeboten, so stellte sich bald heraus, daß England den Franzosen und den Juden Gebiete versprochen hatte, die zugleich den Arabern in Aussicht gestellt worden waren – so daß einer von beiden Teilen der Betrogene sein mußte. Nach Lage der Machtverhältnisse am Schluß des Krieges konnten diese Betrogenen nur die Araber sein.
1916 hatte der Sheriff von Mekka, Hussein, in dessen Amt ein großer Teil der Mohammedaner die Nachfolge des Kalifats erblickte, alle Gläubigen zum Kampfe gegen die türkische Fremdherrschaft aufgerufen, bewogen durch das Versprechen der Engländer, ihre militärische Hilfe zur Wiederherstellung des Kalifats leihen zu wollen. Eine genaue Abgrenzung des neu zu errichtenden arabischen Großstaates hatten zwar die englischen Unterhändler klüglich vermieden. Doch war an dem Sinn der Abmachungen nicht der geringste Zweifel möglich: der Umfang des Staates sollte sich auf alle Gebiete erstrecken, in denen es Anhänger des Kalifats gab. Sicherlich also auch auf das Land zwischen Euphrat und Tigris, auf Syrien und auf Palästina. Wollten die Engländer irgendein Land ausnehmen, so wäre es ihre Pflicht gewesen, das ausdrücklich zu sagen.

Orangenernte in Deutsch- Südwest Das subtropische und dabei recht trockene Klima Deutsch-Südwestafrikas bietet neben der bedeutenden Groß- und Kleinviehzucht auch dem Ackerbau Möglichkeiten. Die erfolgreiche wirtschaftliche Erschließung der Kolonie, eine Großtat zielbewußten deutschen Fleißes, die vor dem Weltkrieg ihre Früchte zu tragen begann, reizte die Begehrlichkeit der Engländer.
Im gleichen Jahre 1916 wurde aber zwischen einem englischen und einem französischen Unterhändler ein Abkommen geschlossen, das so genannte Sykes-Picot Abkommen, das von den beiderseitigen Regierungen bestätigt wurde. In ihm wurde die türkische Beute anders verteilt: Frankreich sollte Syrien, England Mesopotamien erhalten. Im nächsten Jahre sprach der englische Außenminister Balfour ein weiteres Gebiet des Kalifats, nämlich Palästina, den Juden zu. Die englische Propaganda hat zur Entschuldigung dieser beispiellos doppelzüngigen Politik lange Zeit hindurch aus schlechtem Gewissen heraus angeführt, es habe sich bei dem Abschluß der einander so widersprechenden Verträge gewissermaßen um eine Panne gehandelt. Die Männer, die mit dem Scherifen verhandelten, seien von dem Abkommen mit Frankreich nicht unterrichtet gewesen, und umgekehrt. Doch diese Entschuldigung hat kurze Beine. Denn der Mann, der mit Frankreich abschloß, Sir Mark Sykes, gehörte zu dem kleinen Kreise von Eingeweihten in Kairo, die die Aufwiegelung der Araber auf Grund des Kalifats-Versprechens vorbereiteten. Wie hätte also gerade er nicht wissen sollen, was er tat? Und andererseits der Mann, dem England den diplomatischen Erfolg in Mekka und weiterhin die Erfolge in der Kriegführung gegen die Türkei verdankte, der berühmte T. E. Lawrence, der Mann, den man zuerst vielfach und nicht zum wenigsten auch im Deutschland der Nachkriegszeit als das verkörperte gute Gewissen Englands gefeiert hat, als den vergeblichen Mahner zu Treu und Glauben, als den Märtyrer seiner Liebe zu Arabien!

Maifeier in einer deutschen Kolonie Das starke, einigende Band der nationalsozialistischen Bewegung hat seit der Machtübernahme auch den Deutschen in den geraubten Kolonien ein unzerstörbares Zusammengehörigkeitsgefühl, neue sichere Hoffnung auf die Zukunft und damit immer größere Kraft gegeben.
Doch nur so lange, bis man in seinem Nachlaß das Eingeständnis fand, daß er mit vollem Bewußtsein von der Tragweite seines Tuns die arabischen Führer hintergangen habe. Daß ihm persönlich dabei weh zumute war – denn er war kein Plutokrat, sondern auf seine Art ein Rebell -, wird man ihm glauben, und ebenso, daß er versucht hat, seine Schuld durch Auslöschung seiner politischen Existenz zu sühnen. Aber das ändert nichts am wesentlichen: daran nämlich, daß die Zertrümmerung des Türkischen Reiches nur durch einen verbrecherischen Betrug an den Arabern gelingen konnte.
Denn hätte Lawrence damals nicht die Araber irregeleitet, so wäre England niemals in die Lage gekommen, sich die Herrschaft über die strategisch und wirtschaftlich wichtigsten Länder des Vorderen Orients – Mesopotamien und Palästina – anzueignen. Auch bei der letzten Beute, die England errafft hat, der Beute aus dem Weltkriege, wiederholt sich also die Geschichte. Weder die deutschen Kolonien noch die türkischen Gebiete des Orients wurden von ihm aus eigener Kraft erobert. Fremde Anstrengungen gewannen die Beute, Betrug am Gegner und an den Hilfsvölkern ließ sie alsdann in englische Hände fallen.

Die dritte deutsche Kolonialgeneration
Trotz aller Schikanen der Engländer hat sich das Deutschtum in unseren Kolonien nicht ausrotten noch unterkriegen lassen. Stolz und zielbewußt wie dieser Junge aus Südwest blickt es im Vertrauen auf Großdeutschlands Macht und Stärke hoffnungsfreudig in die Zukunft.
DEM ENDE ENTGEGEN
Wir haben bis jetzt den Verlauf der Entwicklung nicht erst seit gestern oder heute, sondern von Anfang an Englands Treiben in der Welt verfolgt, nicht um Einzeltaten aneinander zureihen, sondern um das Gesicht Englands zu zeigen,von Anbeginn an ist ihm das Kainszeichen der Plutokratie aufgeprägt. Denn dieses Gesicht entschleiert sich nur dem der es in seinem Werden betrachtet, weil es von einem inneren Lebensgesetz gedrängt wird, die Welt zu gestalten, nicht aber wie die Perser, die Griechen, die Römer, die Germanen, wie Spanien, Holland, Frankreich, sondern weil es ein Großverdiener sein will. Und als es sein Ziel erreicht hat, als es die Wirtschaft der Welt beherrscht, da offenbart es erst so recht die innere Haltlosigkeit seines Wesens. Niemand mißgönnt ihm seine überragende Stellung, und doch fühlt es sich immer bedroht. Mit mimosenhafter Empfindlichkeit reagiert es auf die Fortschritte, die andere Völker machen. Es fühlt eben so gar nicht in sich selbst den Trieb zur Selbstentfaltung. Es ist unter den Völkern Europas – von denen Asiens ganz zu schweigen eines der jüngeren; die Deutschen, die Italiener, die Spanier, die Franzosen hatten schon eine nationale Kultur hervorgebracht zu einer Zeit, als England noch kulturell eine normannisch-französische Provinz war. Und doch fehlt ihm vom Augenblick seines Eintritts in die Geschichte an alles Jugendliche. Hager und greisenhaft wie die Königin, die den englischen Staat schuf, ist auch die ganze Nation von Anfang ihrer Existenz an gewesen. Der ganze Stolz der Heutigen auf die ununterbrochene „Tradition“, die Pflege mittelalterlichen Zeremoniells und barocken Perückenwesens, die Scheu vor dem Umdenken festgewurzelter, erstarrter Vorstellungen, das gänzliche Unverständnis für die Gedanken- und Gefühlswelt anderer Völker – was ist es anderes als die Halsstarrigkeit eines Verkalkten?

Englands Gesicht in Palästina 1916 hat England das Land den Arabern, 1917 den Juden versprochen, während es in Wirklichkeit aus wirtschaftlichen und strategischen Gründen – Ölzufuhr aus Mesopotamien nach dem Mittelmeer und Bewachung des Suez- Kanals! selbst hier Herr sein wollte.
Gewiss, England hat große Dichter hervorgebracht aber ist nicht das Schönste in ihren Dichtungen immer eine Weisheit, die uns als Altersweisheit anmutet? Gewiss, England hat Rebellen hervorgebracht, religiöse und soziale Erneuerer – aber niemals hat einer von ihnen den Samen seines Wirkens so tief in die Nation gelegt wie bei den Deutschen Luther, bei den Franzosen die Aufklärungsphilosophen des achtzehnten Jahrhunderts – so tief heißt das, dass die Nation sich aufgerufen fühlte, ihre Vergangenheit hinter sich zu werfen und auf die Gefahr des Unterganges hin ein neues Leben zu beginnen.
Darum gibt es auch nichts Unheimlicheres für England, als wenn irgendwo in der Welt etwas schlechthin Neues auftritt. Selbst über solche Gehirne, die sonst nur in Exportziffern und Dividenden denken können, kommt dann etwas wie ein religiöser Wahn, und Kreuzzugsgedanken schwirren durch die sonst so nüchtern-realistischen Blätter der Zeitungen. So war es, als Italien durch den Faschismus Kräfte sammelte und anspannte, die lange geschlummert hatten. Und so war es vor allem, als mit dem Jahre 1933 ein neues Deutschland erstand, das sich entschlossen zeigte, die Fesseln von Versailles abzustreifen. Da begab es sich, dass dasselbe England, das in den fünfzehn Jahrennach dem Kriege immer wieder versucht hatte, die Verantwortung für die politische und wirtschaftliche Knechtung Deutschlands von sich abzuwälzen und den Deutschen einzureden, daß alles nur die Schuld der französischen Unnachgiebigkeit gewesen sei, während England der wahre Freund Deutschlands wäre – dass dieses England sofort wieder in das „antideutsche Fieber“ verfiel. Was war der Grund für diese neuen Ausbrüche von Furcht und Hass? Die Handelskonkurrenz konnte es nicht sein. Denn noch war Deutschland unter dem Druck der Reparationen und der wirtschaftlichen Bevormundung durch die Siegermächte nicht imstande gewesen, seine alte Weltstellung wiederzugewinnen, geschweige denn England unbequem zu werden. Auch der weltanschauliche Gegensatz, mit dem die englische Presse den breiten Massen gegenüber operierte, war nicht die wahre Ursache. Denn wann hätte es England nicht verstanden, über die tiefsten weltanschaulichen Gegensätze – hießen sie nun protestantisch und katholisch, oder liberal und autokratisch – mit leichter Mühe hinwegzukommen, wenn seine Interessen es erforderten? Nein, genau wie überall im Leben moralische Überheblichkeit und Pharisäertum Anzeichen dafür sind, dass das betreffende Individuum vor sich und anderen einen Gemütszustand zu verbergen trachtet, dessen es sich eigentlich zu schämen hätte, so auch hier. Im Aufbau Deutschlands durch Adolf Hitler sieht England nicht etwa nur wie in dem Aufstieg Deutschlands um 1900 eine Bedrohung seiner wirtschaftlichen und politischen Vormacht in der Welt, sondern mehr als das: den weltgeschichtlich entscheidenden Angriff auf das Prinzip der Plutokratie überhaupt.
Die ersten Jahre der nationalsozialistischen Führung in Deutschland räumten nicht nur die Fesseln des Versailler Diktates hinweg. Damit, also mit der Wiedergewinnung der Wehrhoheit und der Wiederbesetzung des Rheinlandes, hätte England sich noch abfinden können. Erst als sich zeigte, daß der Nationalsozialismus nicht nur mit dem nationalen, sondern auch mit dem sozialistischen Aufbau der deutschen Nation ernst machte, versteifte sich Englands Widerstand. Nicht wie einst zu Tirpitz‘ Zeiten die Panzerschiffe, sondern die KdF-Schiffe machten England zum unversöhnlichen Gegner Deutschlands. Daß dem Bauernstande neue Dauer, daß dem Arbeiterstande Anteil an der Kultur gegeben wurde – das war es, was England bedrohte. Weil England nicht eine Nation ist, der es frei steht, aus den Quellen ihres Volkstums neues Dasein zu schöpfen, sondern weil die breiten Massen des englischen Volkes, ihrer natürlichen Lebensgrundlage beraubt, nur Werkzeuge der herrschenden Plutokratie sind und bleiben müssen, wenn nicht die Plutokratie in nichts zerfallen soll, weil eine Erneuerung des englischen Staatslebens, eine wahrhafte Volkwerdung, nicht mehr möglich ist – deshalb ist das nationalsozialistische Deutschland die schwerste Gefahr für England geworden. Nicht wie vor 1914 die Furcht vor der Überlegenheit des deutschen Kaufmanns, sondern die Furcht vor dem Beispiel, das das gesamte deutsche Volk der Welt geben würde, trieb England abermals in die Feindschaft zu Deutschland hinein. Zum ersten mal in der Weltgeschichte hieß der Gegensatz nicht: Großmacht gegen Großmacht, sondern: Plutokratie gegen Sozialismus.
Darum also begann die Aufrüstung Englands im gleichen Zeitpunkt, in dem der Nationalsozialismus bewiesen hatte, daß ihm die Befreiung Deutschlands nicht nur Theorie und Ideal bleiben, sondern Tat und Wirklichkeit werden würde. Und: England bereitete sich zum Kampfe gegen Deutschland vor, obwohl ihm von Deutschland nicht der mindeste Anlaß zur Gegnerschaft geboten wurde. Immer wieder betonte Adolf Hitler in Wort und Schrift, daß er einen dauerhaften Frieden zwischen Deutschland und England für eine der wichtigsten Voraussetzungen des Weltfriedens halte. Weder in seinen Reden noch irgendwo im nationalsozialistischen Schrifttum noch sonst wo in der deutschen Öffentlichkeit ertönte jemals so etwas wie ein Ruf „Britanniam esse delendam“. Nein, wie mancher aufrichtige Engländer, so war ganz Deutschland bereit, den Weltkrieg samt der Hassatmosphäre vorher und nachher für eine Kette tragischer Irrtümer zu nehmen, aus der sich beide Nationen zum Wohle der ganzen Welt befreien müßten. Aufmerksam und unvoreingenommen, ja wohlwollend verfolgten deutsche Beobachter die Vorgänge im britischen Weltreich und versuchten, gegenseitiges Verständnis zu wecken. Ereignisse wie das Regierungsjubiläum und der Tod König Georgs V., die Abdankung König Eduards VIII. und die Krönung König Georgs VI. fanden in breiten Kreisen des deutschen Volkes lebhafte Teilnahme. Es gab kaum jemanden, der nicht von Herzen ein freundschaftliches Verhältnis zu England wünschte. Mit freudiger Genugtuung wurde darum auch der Abschluß des Flottenabkommens von 1935 begrüßt; denn in ihm sah man ein Pfand für die endgültige Beilegung der einstigen Rivalität der Kriegsflotten, eine Garantie gegen alles verhängnisvolle Wettrüsten und eine Gewähr für gegenseitiges Vertrauen. Es mußte doch möglich sein, so glaubte man fest, die Ängste Englands vor einem deutschen Angriff durch offene Aussprache ein für allemal gegenstandslos zu machen.
Allerdings: so ernstlich die deutsche Staatsführung auch auf ein freundschaftliches Zusammenarbeiten mit England hinstrebte, so wenig war sie gesonnen, sich wie die deutsche Regierung vor dem Weltkriege in das Netz einer Einkreisung verstricken zu lassen für den Fall, daß es nicht möglich war, die erhoffte Verständigung mit England zu erreichen. Siegten in England die Erwägungen gesunder politischer Vernunft über plutokratische Angstpsychosen, so konnte nichts für Deutschland erwünschter sein als das. Würde aber das antideutsche Fieber zu einer Dauererscheinung, dann sollte das deutsche Volk nicht ein zweites Mal das Opfer allzu großer Vertrauensseligkeit seiner Regierung werden. Aufrichtig bereit zur Freundschaft, aber auch militärisch wie diplomatisch gerüstet zu schwerem Kampfe, so trat Deutschland der britischen Nation entgegen.

Auf dem Dach der deutschen Kirche in Birsalem
hat sich ein englischer Spähposten eingenistet, der die Bewegungen der um die Freiheit des Landes von englischer Unterdrückung kämpfenden Araber beobachten soll.
Und welche Aufnahme fand das deutsche Freundschaftsangebot in London? Die Abrüstungskonferenz in Genf brach auseinander, weil außer Frankreich auch England die Schaffung einer deutschen Wehrmacht mit allen Mitteln verhindern wollte. Baldwin erklärte anmaßend in einer Rede, die „Grenze Großbritanniens liege am Rhein“. Englands Politik gegenüber der Gründung des italienischen Imperiums, gegenüber der nationalen Erhebung in Spanien, gegenüber der Forderung auf Rückgabe der deutschen Kolonien – alles sprach gegen den erhofften Läuterungsprozeß in den Kreisen der verantwortlichen englischen Staatsmänner. Die plutokratische Presse begann, einen neuen weltanschaulichen Gegensatz herauszuarbeiten und ihren Lesern als den entscheidenden unserer Zeit aufzureden: den zwischen „Demokratien“ und „autoritären“ Staaten. Während also das welt-politische Dreieck Berlin- Rom- Tokio keinerlei aggressiven Inhalt gegen England hatte, suchte man in London das Dreieck London-Paris-Washington von neuem mit dem Geist von Versailles zu erfüllen.
Da zwangen die Ereignisse von 1938 England, Farbe zu bekennen. Die Heimkehr der Ostmark ins Reich, obwohl von England oft als notwendiges Glied in dem Prozess deutscher Einigung vorausgesehen, wurde von der englischen Presse als eine gewaltsame Invasion in ein unabhängiges Land dargestellt. Immer deutlicher wurde es, dass eine bestimmte Richtung in der herrschenden plutokratischen Partei – ihre Wortführer waren zunächst Churchill, Eden und Duff Cooper – damit beschäftigt war, im englischen Volke Wahnvorstellungen von deutschen Eroberungsplänen hervorzurufen.
Noch aber befand sich diese Richtung in einer äußerlichen „Opposition“ zu der Regierung, und diese vermied es, Farbe zu bekennen. Auch die Lügenmeldung der englischen Presse vom 21. Mai 1938 über deutsche Mobilmachungsaktionen an der tschechischen Grenze trug nicht amtlichen Stempel. Ja, selbst als Benesch dann im September versuchte, im Vertrauen auf die Unterstützung der Westmächte vollendete Tatsachen in Sudetendeutschland zu schaffen, lieh ihm die Londoner Regierung offiziell keine Unterstützung. Der Bevollmächtigte der Plutokratie, Lord Runciman, ließ sich sogar als Freund der Sudetendeutschen feiern, und Premierminister Chamberlain trat selbst für Abtretung der rein deutschen Gebiete ein. Als dann allerdings Adolf Hitler daraus die selbstverständliche Folgerung zog, daß die deutsche Wehrmacht zum Schutz gegen weitere Gewaltaktionen der Benesch-Horden in die abzutretenden Gebiete einrücken müsse, erklärte Chamberlain das für eine „ungerechtfertigte Machtdemonstration“ und ließ die Godesberger Besprechungen auffliegen. In München wurde ihm dann wenig später klargemacht, daß er nur die Wahl habe, zu seinem Worte zu stehen oder die Feindschaft offen zu bekennen, worauf er es vorzog einzulenken.

Das ist die „Pax Britannica“ im Heiligen Lande! Mit Sprengungen ganzer Straßenviertel geht das englische Militär gegen die arabische Freiheitsbewegung vor -und kann ihrer doch nicht Herr werden.
Noch einmal durfte man es für möglich halten, dass die Erwägungen gesunder Vernunft am Ende doch die Oberhand bekommen würden, als nämlich Chamberlain mit Adolf Hitler zusammen eine Erklärung unterzeichnete, die den Willen zur engen Zusammenarbeit im Dienste des Friedens bekundete. Doch bereits die nächsten Tage ließen solche Hoffnungen wieder vergehen. Denn die erste englische Tat, die dieser Bekundung folgte, war die Beschleunigung des Rüstungstempos. Die Erreger des antideutschen Fiebers, die Churehill, Duff Cooper und Eden, traten, wenngleich immer noch als einfache Unterhausmitglieder, mehr und mehr in den Vordergrund. Während sie in aller Öffentlichkeit die moralische Kriegsbereitschaft in den Massen des englischen Volkes zu wecken versuchten – wobei in unzweideutiger Absicht immer wieder die Erinnerungen an die Zeit vor 1914 beschworen wurden -, arbeitete der engere Kreis von Chamberlains Mitarbeitern an der Umstellung der englischen Wirtschaft auf den Kriegsfall. Schon um die Jahreswende 1938/1939

Gesprengtes Araberdorf
Dadurch, daß es die Juden nach Palästina ließ und ihnen die fruchtbarsten Gebiete des Landes zum Anbau überwies, hat England sich die arabische Bevölkerung zum unversöhnlichen Feinde gemacht. Die Methoden, mit denen es die arabische Freiheitsbewegung bekämpft, sind von rücksichtsloser Brutalität und nicht geeignet, einen wirklichen Frieden in Palästina herzustellen.
berichteten neutrale Beobachter aus England von den Kriegsvorbereitungen und stellten Betrachtungen über das Tempo an, in dem man zum Ziele kommen werde. ..“Da man die Anspannung der englischen Wirtschaft“, so schrieb als einer von vielen Zeugen der Korrespondent eines Schweizer Blattes, „nicht beliebig lange fortsetzen kann, so wird man etwa im Sommer 1939 den Höchstgrad der Rüstung erreicht haben“.
Es blieb also nur noch der Diplomatie vorbehalten, einen geeigneten Vorwand zu finden, um die Einkreisung einzuleiten. Einen solchen bot, wenn auch unter völliger Verdrehung der Tatsachen, der Schritt des tschechischen Staatspräsidenten Hacha, der sein Land dem Protektorat des Großdeutschen Reiches unterstellte. Die sachlich unvermeidlichen, staatsrechtlich bis ins letzte korrekten und überdies die englischen Interessen nicht im mindesten berührenden Vorgänge wurden dem gemäß nun auch von den offiziellen

An der Seite des ermordeten Sohnes Wie diese Frau, die an der Leiche ihres von den Engländern ermordeten Sohnes kniet, so klagt das ganze arabische Volk England an, das die Fackel des Krieges in das Land getragen hat.
Londoner Stellen als ein Angriff ohnegleichen auf die Freiheit der kleinen Völker angeprangert, woraus dann folgte, daß England, als der gegebene Schirmherr dieser kleinen Völker, fortab entschlossen war, ihre Interessen gegen Deutschland wahrzunehmen. „Wir haben uns“, erklärte Lord Halifax, als Außenminister ein würdiger Nachfolger der Castlereagh und Canning, der Palmerston und Disraeli, „in der Vergangenheit stets widersetzt, wenn eine einzelne Macht versuchte, Europa auf Kosten der Freiheit anderer Nationen zu beherrschen, und die britische Politik wird deshalb nur der unvermeidlichen Linie ihrer eigenen Geschichte folgen, wenn solch ein Versuch wiederholt werden sollte.“ In der Tat, die „unvermeidliche Linie britischer Geschichte“!
Wohin dieses Unternehmen der zweiten Einkreisung Deutschlands führte, ist uns allen zu bekannt, als daß es noch ausführlich erzählt werden müßte. Wir wissen aus den Dokumenten in allen Einzelheiten, wie Polen von England als der erste Festlandsdegen gewonnen wurde, wie es, auf die freigiebig und frivol erteilte englische Garantie gestützt, die Verständigung mit Deutschland von sich wies – dasselbe Polen, dessen Grenzen England unzählige Male als unklug gewählt und ungerecht gegenüber Deutschland bezeichnet hatte! Wie dann eine Reihe kleinerer Nationen – Griechenland, Rumänien, die Türkei -, ob sie wollten oder nicht, von einer englischen Garantie beglückt wurden. Und wie die Einkreisungspolitik ihre Katastrophe erlebte, als das entscheidende Glied, Sowjetrußland, ausfiel, weil es dem Führer gelang, eine Einigung mit Moskau herbeizuführen. Wie aber dann trotzdem, von der Furcht vor dem deutschen Rüstungsvorsprung getrieben, London Polen und Frankreich in den Untergang hetzte. Wir haben gesehen, wie die britische Politik im Laufe der Jahrhunderte der „unvermeidlichen Linie ihrer Geschichte“, wie Lord Halifax es nennt, gefolgt ist. Fürwahr, sie war „unvermeidlich“, weil sie immer von den gleichen Motiven geleitet wurde, weil England nie nach nationalen Interessen, die sich im Laufe der Entwicklung eines Volkes wandeln, sondern stets nach den immer sich gleich bleibenden Interessen der Plutokratie gehandelt hat und darum seine Tradition nicht ändern konnte. Heute ist es zu spät dazu. Die plutokratische Kaste in England sieht selbst mit Entsetzen, daß der Krieg den sie freventlich heraufbeschworen hat, für sie ein Kampf um Sein und Nichtsein geworden ist. Denn wie ihre Hoffnungen auf mächtige Verbündete, haben auch ihre Hoffnungen auf eine innere Schwächung Deutschlands getrogen. Aus jedem Wort und jedem Befehl des Führers, aus jeder Waffentat der deutschen Wehrmacht, aus der Haltung des gesamten deutschen Volkes spricht die Entschlossenheit, den von England heraufbeschworenen Krieg unerbittlich bis zur letzten Entscheidung zu führen. Diese Entscheidung aber ist gleichbedeutend mit dem Untergang der britischen Plutokratie, mit dem Ende der Weltausbeutung durch England, mit dem Sieg der sozialistischen Idee und mit dem Aufbau einer gerechten Ordnung in Europa und in der ganzen Welt.
L. La Rouche, und wie das Imperium der Plünderer über Deutschland herfiel. Nach ein paar Min. wirds interessant. Sehr dubioses Aussparen der US-Rolle am Krieg, dafür die Ermordung Rathenaus und „Machtübernahme“ H. Schachts. )

 Armageddon ist die Bezeichnung für einen Krieg, der sich gemäß Überzeugung der zionistischen Christen in der Endzeit in einer Gegend namens Meggido ereignen wird. Bei diesem Krieg werden die Kräfte Christi und des Anti-Christ, welche Sinnbild für Recht bzw. Unrecht sind, einander ein Gefecht liefern und schließlich werden die Kräfte Christi siegen. Danach werden die Juden die Herrscher auf der Erde und die anderen ihre Untertanen sein.
Armageddon ist die Bezeichnung für einen Krieg, der sich gemäß Überzeugung der zionistischen Christen in der Endzeit in einer Gegend namens Meggido ereignen wird. Bei diesem Krieg werden die Kräfte Christi und des Anti-Christ, welche Sinnbild für Recht bzw. Unrecht sind, einander ein Gefecht liefern und schließlich werden die Kräfte Christi siegen. Danach werden die Juden die Herrscher auf der Erde und die anderen ihre Untertanen sein. Ansichten und Ideale der zionistischen Christen
Ansichten und Ideale der zionistischen Christen Armaggedon – ein Nuklearkrieg!
Armaggedon – ein Nuklearkrieg! Die „Geheime Offenbarung des Johannes“, das letzte Kapitel der Bibel, deuten viele Zeitgenossen als den Zusammenbruch unserer derzeitigen Zivilisation. Eine große Rolle spielt dabei die „Hure Babylon“, die betrunken ist vom „Blut der Heiligen“ und vom „Blut der Zeugen Jesu“. … Weiterlesen
Die „Geheime Offenbarung des Johannes“, das letzte Kapitel der Bibel, deuten viele Zeitgenossen als den Zusammenbruch unserer derzeitigen Zivilisation. Eine große Rolle spielt dabei die „Hure Babylon“, die betrunken ist vom „Blut der Heiligen“ und vom „Blut der Zeugen Jesu“. … Weiterlesen  Völkermord durch Überfremdung. Ein UN-Dokument empfiehlt den Austausch der europäischen Bevölkerung mit 674 Mio Migranten ! / 181 Mio für die BRD Elite plante 1871 3 Weltkriege Veröffentlicht am 1. November 2010 von totoweise https://totoweise.files.wordpress.com/2012/07/planung-3-wk.pdf Albert Pike (Illuminati, Freimaurer, Mitbegründer Ku … Weiterlesen
Völkermord durch Überfremdung. Ein UN-Dokument empfiehlt den Austausch der europäischen Bevölkerung mit 674 Mio Migranten ! / 181 Mio für die BRD Elite plante 1871 3 Weltkriege Veröffentlicht am 1. November 2010 von totoweise https://totoweise.files.wordpress.com/2012/07/planung-3-wk.pdf Albert Pike (Illuminati, Freimaurer, Mitbegründer Ku … Weiterlesen  Die oft zitierten ‚jüdisch-christlichen Wurzeln des Abendlandes‘ sind nicht zu verteidigen, sondern auszureißen. Es handelt sich dabei nämlich gar nicht um unsere Wurzeln, sondern um ein orientalisches Kraut, das in unserem Garten nichts verloren hat. [Die christliche Lehre kam aus dem Norden] Unsere echten Wurzeln und Werte sind germanisch; die antike Religion, Kunst und Ethik ist unser eigentliches Erbe. Die 3 Wüsten-Religionen haben NICHTS, rein gar nichts auf dem germanischen Boden der Deutschen verloren oder zu suchen!!! Die gehören einzig dorthin, woher die kamen – in die Wüste!!
Die oft zitierten ‚jüdisch-christlichen Wurzeln des Abendlandes‘ sind nicht zu verteidigen, sondern auszureißen. Es handelt sich dabei nämlich gar nicht um unsere Wurzeln, sondern um ein orientalisches Kraut, das in unserem Garten nichts verloren hat. [Die christliche Lehre kam aus dem Norden] Unsere echten Wurzeln und Werte sind germanisch; die antike Religion, Kunst und Ethik ist unser eigentliches Erbe. Die 3 Wüsten-Religionen haben NICHTS, rein gar nichts auf dem germanischen Boden der Deutschen verloren oder zu suchen!!! Die gehören einzig dorthin, woher die kamen – in die Wüste!! Religiöser Glaube und das Für-wahr-Halten von Absurditäten, ist Ausdruck einer indoktrinierten Bewusstseinsbeeinträchtigung. Wer dich dazu bringt, die Absurditäten der abrahamitischen Religionen zu glauben, bringt dich auch dazu, Mensch und Natur verachtende Ungeheuerlichkeiten zu tun. Du brauchst keine Religion um Moral zu besitzen. Wenn du Gut nicht von Böse und Wahrheit von Lüge nicht unterscheiden kannst, fehlt es dir an Empathie und Bewusstsein und nicht an Religion und deren Bücher, die den Geist und den Leib der beseelten Geschöpfe und Kreaturen der Erde töten Religiöse Glaubenssysteme können wie Filter der Wahrnehmung funktionieren. In Kulturkreisen, die von Glaubenssystemen geprägt sind, kann die authentische Lebensrealität kaum bis in die Gehirne der Menschen vordringen. Folglich leiden sie unter Realitätsmangel bis hin zu Realitätsverlust. Dennoch fühlen sie sich innerhalb der Grenzen ihrer trügerischen Weltbilder völlig wohl, glauben sich im Recht und gebrauchen ihre politische Macht, um die geschaffenen Schieflagen zu erhalten. Sie verewigen und verschlimmern die Normalität der Dummheit und des Wahnsinns. Sie verlieren sich in Mensch gemachten Realitäten. weiterlesen
Religiöser Glaube und das Für-wahr-Halten von Absurditäten, ist Ausdruck einer indoktrinierten Bewusstseinsbeeinträchtigung. Wer dich dazu bringt, die Absurditäten der abrahamitischen Religionen zu glauben, bringt dich auch dazu, Mensch und Natur verachtende Ungeheuerlichkeiten zu tun. Du brauchst keine Religion um Moral zu besitzen. Wenn du Gut nicht von Böse und Wahrheit von Lüge nicht unterscheiden kannst, fehlt es dir an Empathie und Bewusstsein und nicht an Religion und deren Bücher, die den Geist und den Leib der beseelten Geschöpfe und Kreaturen der Erde töten Religiöse Glaubenssysteme können wie Filter der Wahrnehmung funktionieren. In Kulturkreisen, die von Glaubenssystemen geprägt sind, kann die authentische Lebensrealität kaum bis in die Gehirne der Menschen vordringen. Folglich leiden sie unter Realitätsmangel bis hin zu Realitätsverlust. Dennoch fühlen sie sich innerhalb der Grenzen ihrer trügerischen Weltbilder völlig wohl, glauben sich im Recht und gebrauchen ihre politische Macht, um die geschaffenen Schieflagen zu erhalten. Sie verewigen und verschlimmern die Normalität der Dummheit und des Wahnsinns. Sie verlieren sich in Mensch gemachten Realitäten. weiterlesen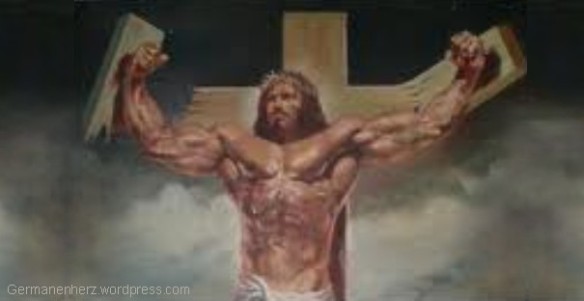
 .In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi, steht eine »große Stadt«, ja eine »Hure«, deren entlarvtes Angesicht erschaudern läßt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, daß »Babylon, die große Mutter aller Greuel der Erde« sei, eine Stadt auf … Weiterlesen
.In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi, steht eine »große Stadt«, ja eine »Hure«, deren entlarvtes Angesicht erschaudern läßt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, daß »Babylon, die große Mutter aller Greuel der Erde« sei, eine Stadt auf … Weiterlesen  In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi, steht eine »große Stadt«, ja eine »Hure«, deren entlarvtes Angesicht erschaudern läßt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, daß »Babylon, die große Mutter aller … Weiterlesen
In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi, steht eine »große Stadt«, ja eine »Hure«, deren entlarvtes Angesicht erschaudern läßt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, daß »Babylon, die große Mutter aller … Weiterlesen  Päpstliche Bulle oder kurz Bulle ist die Bezeichnung für Urkunden, die wichtige Rechtsakte des Papstes verkünden.
Päpstliche Bulle oder kurz Bulle ist die Bezeichnung für Urkunden, die wichtige Rechtsakte des Papstes verkünden. Die Wahrheit kommt ans Licht Die Lüge weiß, dass ich sie enttarnt habe, denn ich sehe alles und höre ALLES. Wer kann vorm Vater bestehen? Einige meiner Themenbereiche in meinem Blog Germanenherz sind unteranderem, Religionskritik, Philosophie, Mythologie, Rechtskunde und der Mißstand … Weiterlesen
Die Wahrheit kommt ans Licht Die Lüge weiß, dass ich sie enttarnt habe, denn ich sehe alles und höre ALLES. Wer kann vorm Vater bestehen? Einige meiner Themenbereiche in meinem Blog Germanenherz sind unteranderem, Religionskritik, Philosophie, Mythologie, Rechtskunde und der Mißstand … Weiterlesen 




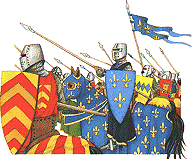





 Eine Strategie für Israel in den Achtzigern
Eine Strategie für Israel in den Achtzigern
 Der Zionismus ist der Feind des jüdischen Volkes und das Anti, zu einer gemeinsamen Kulturweltanschauung der Völker dieser Erde Vorab mal kurz zur Info. Da ich selbst judenstämmig bin, aber nichts mit deren zionistischen Ideologien gleichendes verspüre, möchte ich mich …
Der Zionismus ist der Feind des jüdischen Volkes und das Anti, zu einer gemeinsamen Kulturweltanschauung der Völker dieser Erde Vorab mal kurz zur Info. Da ich selbst judenstämmig bin, aber nichts mit deren zionistischen Ideologien gleichendes verspüre, möchte ich mich … 
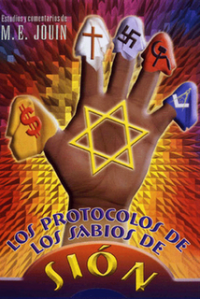






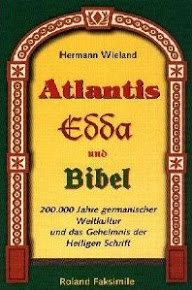







 Nun hat sich das Judentum mit dem Alten Testament selbst zum allein berechtigten Herrscher über die Völker der Erde erhoben auf Grund der Verheißung: … so wird dich der HErr, dein GOtt, das höchste machen über alle Völker auf Erden. …
Nun hat sich das Judentum mit dem Alten Testament selbst zum allein berechtigten Herrscher über die Völker der Erde erhoben auf Grund der Verheißung: … so wird dich der HErr, dein GOtt, das höchste machen über alle Völker auf Erden. … 








 Religiöser Glaube ist nicht gleichbedeutend mit dem Für-wahr-Halten von Absurditäten, sondern Ausdruck einer bestimmten Lebenshaltung. Die Artznei macht Kranke, Die Mathematik Traurige Und die Theology Sündhafte Leut. Luther. Keine Religion ist höher als die Wahrheit. Am Ende des Beitrages, gibt …
Religiöser Glaube ist nicht gleichbedeutend mit dem Für-wahr-Halten von Absurditäten, sondern Ausdruck einer bestimmten Lebenshaltung. Die Artznei macht Kranke, Die Mathematik Traurige Und die Theology Sündhafte Leut. Luther. Keine Religion ist höher als die Wahrheit. Am Ende des Beitrages, gibt … 






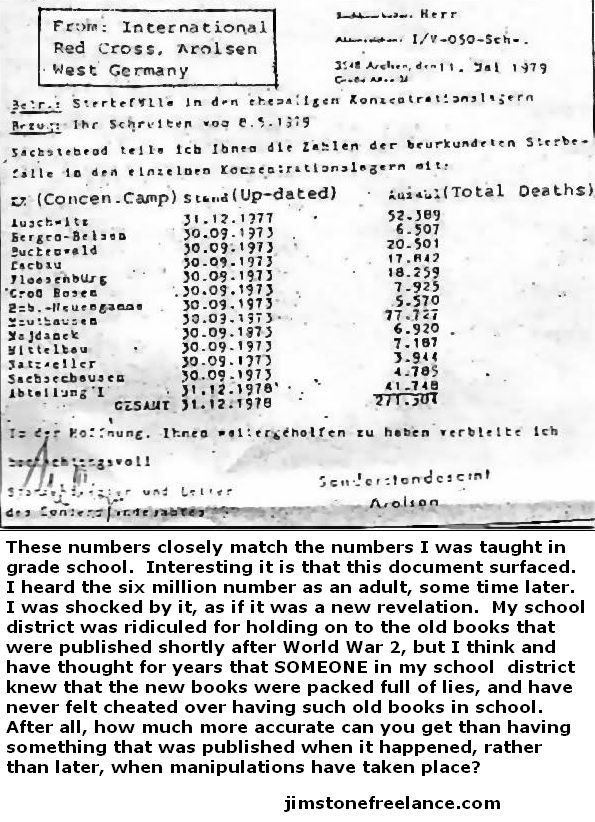






 In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi, steht eine »große Stadt«, ja eine »Hure«, deren entlarvtes Angesicht erschaudern läßt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, daß »Babylon, die große Mutter aller Greuel der Erde« sei, eine Stadt auf …
In Konkurrenz zur heiligen Stadt Jerusalem, zur Braut Christi, steht eine »große Stadt«, ja eine »Hure«, deren entlarvtes Angesicht erschaudern läßt. Die Bibel gibt den vielsagenden Hinweis, daß »Babylon, die große Mutter aller Greuel der Erde« sei, eine Stadt auf … 
 https://germanenherz.wordpress.com/2012/12/30/das-haavara-transfer-abkommen-die-geheime-zionistische-vereinbarung-mit-hitler/.
https://germanenherz.wordpress.com/2012/12/30/das-haavara-transfer-abkommen-die-geheime-zionistische-vereinbarung-mit-hitler/.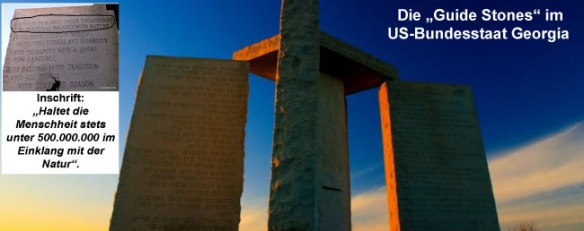



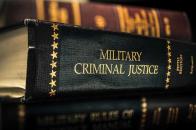


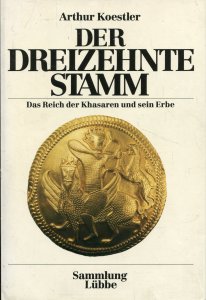


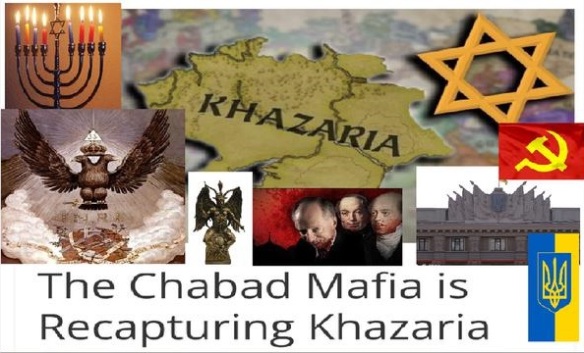

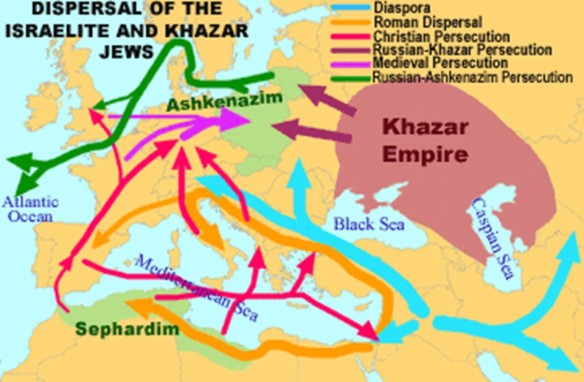
 Die meisten der heutigen Kirchenvertreter sind Handlanger der „Synagoge des Satans“ (Offenbarung). Sie stellen die universellen Werte der Schöpfung auf den Kopf. Mit menschenfeindlichen, „universellen Werten“ trachten sie, die göttliche Schöpfungsordnung zu ersetzen. Beispielsweise sollen sich die Völker, die in ihrer ethnischen Unversehrtheit dem Willen Gottes entsprechen bzw. „Gedanken Gottes sind“ (Herder), selbst auflösen, also Schöpfungs-Suizid begehen. Wer sein eigenes Volk durch andere Völkermassen austauschen will hat vor, Gott und sein großartiges Werk anzugreifen, die Schöpfung zu vernichten, ein wahrlich satanisches Begehren!
Die meisten der heutigen Kirchenvertreter sind Handlanger der „Synagoge des Satans“ (Offenbarung). Sie stellen die universellen Werte der Schöpfung auf den Kopf. Mit menschenfeindlichen, „universellen Werten“ trachten sie, die göttliche Schöpfungsordnung zu ersetzen. Beispielsweise sollen sich die Völker, die in ihrer ethnischen Unversehrtheit dem Willen Gottes entsprechen bzw. „Gedanken Gottes sind“ (Herder), selbst auflösen, also Schöpfungs-Suizid begehen. Wer sein eigenes Volk durch andere Völkermassen austauschen will hat vor, Gott und sein großartiges Werk anzugreifen, die Schöpfung zu vernichten, ein wahrlich satanisches Begehren!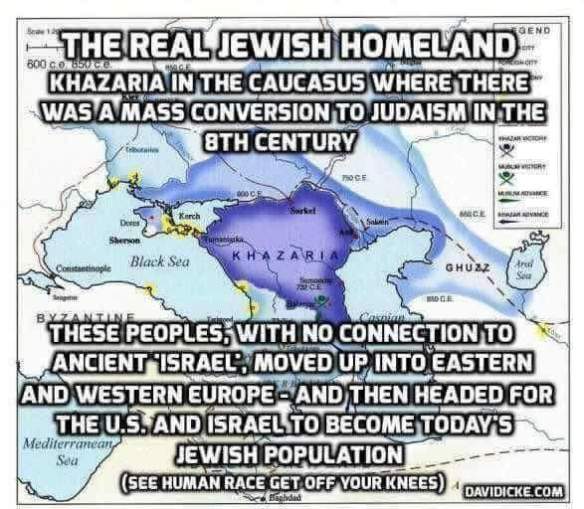


 Eine Lubavitcher Mischung mit den oberen Rängen der einzelnen Gastländer. Ihr Einfluss in den einzelnen Ländern ist unterschiedlich.Die kanadische Regierung hat der Sekte vor kurzem $800.000 für den Bau eines Chabad-Zentrums in Montreal gegeben. Die Beziehungen zu Russland sind weniger warm; die Russen haben sich vor kurzem geweigert, zwei große Text-Sammlungen der Chabad zu übergeben, die frühere sowjetische Regierungen beschlagnahmt hatten.
Eine Lubavitcher Mischung mit den oberen Rängen der einzelnen Gastländer. Ihr Einfluss in den einzelnen Ländern ist unterschiedlich.Die kanadische Regierung hat der Sekte vor kurzem $800.000 für den Bau eines Chabad-Zentrums in Montreal gegeben. Die Beziehungen zu Russland sind weniger warm; die Russen haben sich vor kurzem geweigert, zwei große Text-Sammlungen der Chabad zu übergeben, die frühere sowjetische Regierungen beschlagnahmt hatten.
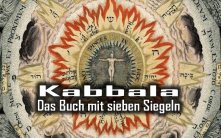
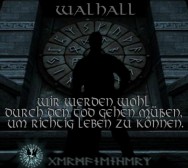




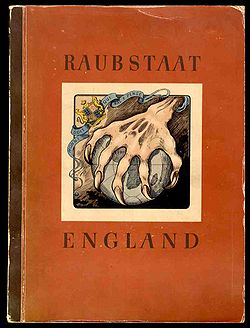



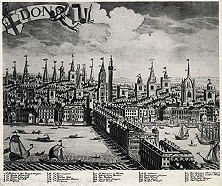

































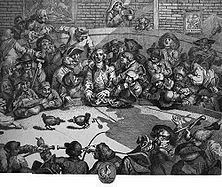









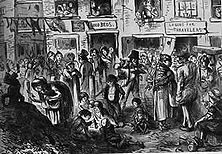






































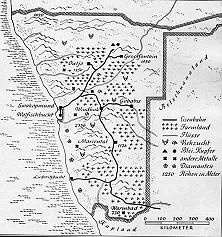



































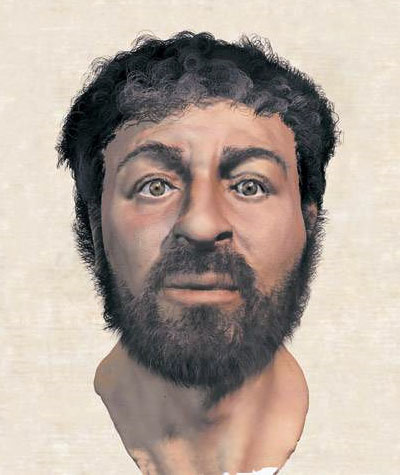


 Der von der NATO unterstützte Atlantic Council hat die Apartheid-Israel als Blaupause für eine hypermilitarisierte Ukraine vorgeschlagen, die aus Westlichen-Steuergeldern finanziert wird. Nur vierzig Tage nach Beginn des russischen Feldzugs in der Ukraine sagte der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj gegenüber …
Der von der NATO unterstützte Atlantic Council hat die Apartheid-Israel als Blaupause für eine hypermilitarisierte Ukraine vorgeschlagen, die aus Westlichen-Steuergeldern finanziert wird. Nur vierzig Tage nach Beginn des russischen Feldzugs in der Ukraine sagte der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj gegenüber …  Veröffentlicht am
Veröffentlicht am  Die westliche „Wertegemeinschaft“ zeigt einmal mehr ihr wahres, diebisches und kriegsgeiles naziertes Gesicht. Und ihr ungebildeten Dummköpfe, geht für die Nazis auf die Strasse und sammelt Spendengelder, Ihr habt aus der Geschichte nichts, aber auch gar nichts gelernt. Weder als …
Die westliche „Wertegemeinschaft“ zeigt einmal mehr ihr wahres, diebisches und kriegsgeiles naziertes Gesicht. Und ihr ungebildeten Dummköpfe, geht für die Nazis auf die Strasse und sammelt Spendengelder, Ihr habt aus der Geschichte nichts, aber auch gar nichts gelernt. Weder als … 





 Schauen wir vorab mal um zu Verstehen, wie tiefgreifend in unserem System, diese Vernichtungspläne von langer Hand geplant wurden, Was in den Redaktionsstuben bei Welt, zu diesen Thema geschrieben wurde. Meine Recherchen und Analysen, kommen im unteren Teil dieses Beitrags …
Schauen wir vorab mal um zu Verstehen, wie tiefgreifend in unserem System, diese Vernichtungspläne von langer Hand geplant wurden, Was in den Redaktionsstuben bei Welt, zu diesen Thema geschrieben wurde. Meine Recherchen und Analysen, kommen im unteren Teil dieses Beitrags …